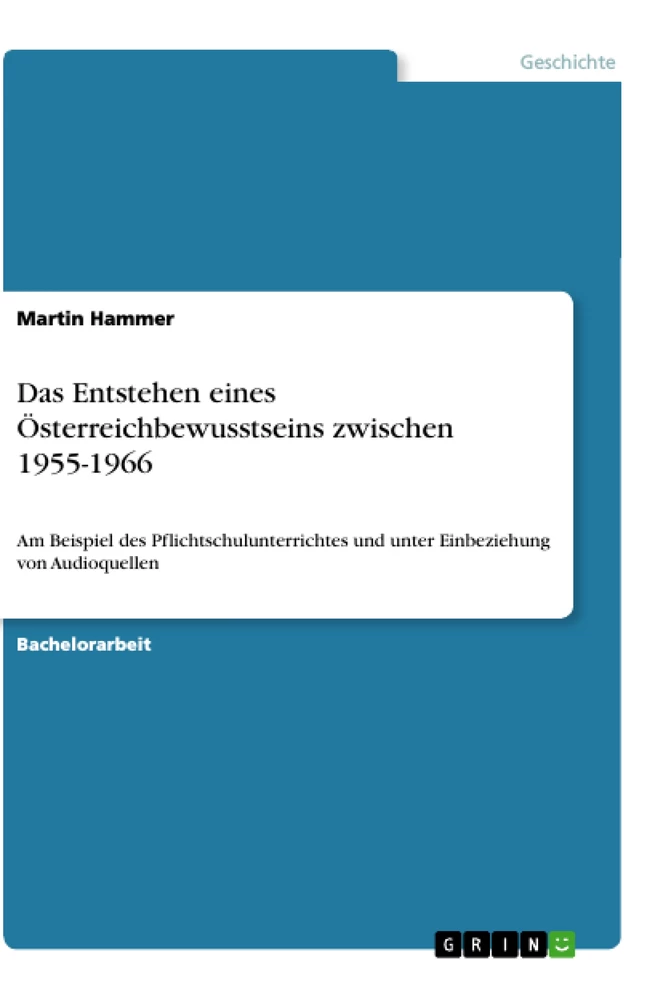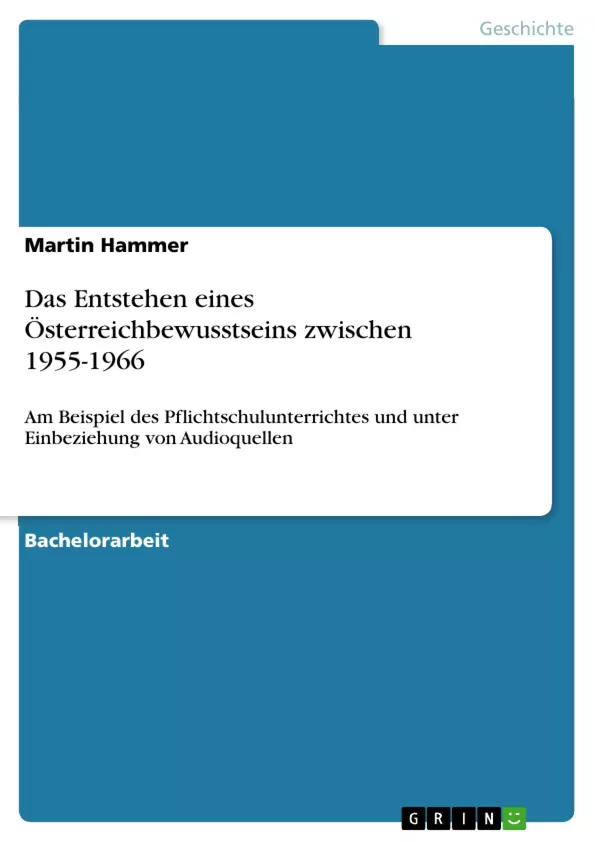Die Entwicklung einer gefestigten Österreich-Identität gehörte zu den vordergründigen Aufgaben der Zweiten Republik nach 1945. Bedingt wurde das neuformierte Österreichbewusstsein einerseits durch die Negativerfahrungen von Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg andererseits durch den Wiederaufbau und dem neuen weltpolitischen Klima des "Kalten Krieges", der sich in der österreichischen Neutralitätspolitik ausdrückte.
Aber auch institutionell sollten Österreichbilder verankert werden, die den republikanisch-demokratischen Kleinstaat, seine Wirtschaft und Politik legitimierten. Am Beispiel der Bildungspolitik, hier stellvertretend am Schulunterricht, zeigen sich Narrative, welche im Pflichtschulbereich erzählt und gefördert wurden. Den zeitlichen Rahmen der Arbeit bilden die Jahre 1955-1966, eine zentrale Phase im nation building Prozess des Landes, da sie die Phase von der wiedererlangten Unabhängigkeit Österreichs bis zum Ende der über 20 Jahre bestehenden Koalitionsregierung zwischen bürgerlicher Volkspartei (ÖVP) und Sozialdemokratie (SPÖ) 1966 sowie der Verabschiedung des Nationalfeiertagsgesetzes 1965 umfasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Quellenübersicht und -kritik
- 1.2 Forschungsstand zum und Definition vom Österreichbewusstsein
- 2 Was heißt Österreich? Wege von Bewusstseins- und Identitätsbildungen
- 2.1 Gedächtnis- bzw. Erinnerungsorte unter dem Gesichtsfeld von Pierre Nora - Beispiele von österreichischen Gedächtnisorten
- 2.1.1 Methodischer Ansatz: Überlegungen zum Werden des Österreichbewusstseins in den Jahren 1955-1966 mit besonderer Betrachtung von Pflichtschulkindern
- 2.1.2 Analyse der Lernmethoden: Differenzierungen zwischen „Soll- und Istwert“ des Unterrichtsstoffes an Pflichtschulen und die Frage der dabei vermittelten Tiefe des Österreichbewusstseins
- 3 Die ersten Nachkriegsjahre und ihre Auswirkungen auf die Pflichtschulkinder
- 4 „Österreich ist frei!“. Markante innen- und außenpolitische Ereignisse in den Anfangsjahren der Zweiten Republik nach Abschluss des Staatsvertrages und ihre Bedeutungen für das Österreichbild von Schulkindern
- 4.1 Staatsvertrag und „Tag der Fahne“
- 4.2 Der „Ungarische Volksaufstand“ 1956
- 5 Der Beginn einer neuen Ära: Verortung und Stellung des Österreichbildes im Schulunterricht zwischen 1955-1966
- 5.1 Volksschule
- 5.2 Haupt- und Mittelschule
- 5.2.1 Tradierung des Österreichbegriffs im Geschichtsunterricht
- 5.2.2 Territoriale und wirtschaftliche Identifikationselemente im Erdkundeunterricht
- 5.2.3 Kulturelle Komponente Teil I – Deutschunterricht
- 5.2.4 Kulturelle Komponente Teil II – Musikunterricht: Das musikalische Österreich
- 5.2.5 Kulturelle Komponente Teil III – Turnunterricht: Österreich als Sportnation
- 5.2.6 Kulturelle Komponente Teil IV – Von der Theorie in die Praxis: Ausflüge, Exkursionen und sonstige identitätsstiftenden Faktoren eines Österreichbewusstseins
- 6 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung des Österreichbewusstseins bei Pflichtschulkindern in Österreich zwischen 1955 und 1966. Die Arbeit analysiert, wie und in welchem Umfang ein nationales Bewusstsein in der Schule vermittelt wurde. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle verschiedener Schulfächer und außerschulischer Aktivitäten in diesem Prozess.
- Vermittlung eines Österreichbewusstseins im österreichischen Pflichtschulunterricht (1955-1966)
- Rolle von Schulfächern (Geschichte, Geographie, Deutsch, Musik, Turnen) bei der Identitätsbildung
- Einfluss von innen- und außenpolitischen Ereignissen auf das Österreichbild der Kinder
- Analyse von Lernmethoden und deren Wirkung auf die Entwicklung eines nationalen Bewusstseins
- Identifizierung von Kontinuitäten und Brüchen im Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung des Österreichbewusstseins bei Pflichtschulkindern in den ersten Jahren der Zweiten Republik. Sie begründet die Relevanz des Themas aufgrund des Mangels an Forschungsarbeiten und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf die Analyse von Schulbüchern, Lehrplänen und anderen Quellen stützt, um die Vermittlung von österreichischer Identität im Unterricht zu untersuchen. Die Arbeit betont die Rolle von Familie, Schule und Freundeskreis bei der Identitätsbildung.
2 Was heißt Österreich?: Dieses Kapitel untersucht die Wege der Bewusstseins- und Identitätsbildung im Kontext des Entstehens eines österreichischen Nationalbewusstseins. Es betrachtet österreichische Gedächtnisorte im Sinne von Pierre Nora und analysiert methodisch die Herausbildung eines Österreichbewusstseins bei Kindern zwischen 1955 und 1966. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Untersuchung von „Soll- und Istwerten“ im Schulunterricht und der Tiefe der vermittelten Inhalte.
3 Die ersten Nachkriegsjahre und ihre Auswirkungen auf die Pflichtschulkinder: Dieses Kapitel beleuchtet die unmittelbaren Nachkriegsjahre und ihre Auswirkungen auf die Kinder. Es analysiert, wie die Erfahrungen dieser Zeit – geprägt von Besatzung und Wiederaufbau – die Entwicklung ihres Österreichbewusstseins beeinflussten. Die soziale und politische Lage wird mit der schulischen Situation in Verbindung gebracht.
4 „Österreich ist frei!“: Das Kapitel analysiert markante innen- und außenpolitische Ereignisse nach dem Staatsvertrag, wie den „Tag der Fahne“ und den Ungarischen Volksaufstand 1956, und deren Bedeutung für das Österreichbild der Schulkinder. Es untersucht, wie diese Ereignisse im Unterricht aufgearbeitet und in die nationale Identität integriert wurden.
5 Der Beginn einer neuen Ära: Dieses Kapitel widmet sich der Verortung und Stellung des Österreichbildes im Schulunterricht zwischen 1955 und 1966, untersucht die Rolle verschiedener Fächer (Geschichte, Geographie, Deutsch, Musik, Turnen) und außerschulischer Aktivitäten (Ausflüge, Exkursionen) bei der Entwicklung eines österreichischen Nationalbewusstseins und zeigt regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede auf.
Schlüsselwörter
Österreichbewusstsein, Identitätsbildung, Pflichtschulunterricht, Zweite Republik, Nachkriegszeit, Staatsvertrag, Schulbücher, Lehrpläne, Geschichtsunterricht, Geographie, Deutschunterricht, Musikunterricht, Turnunterricht, Erinnerungsorte, Pierre Nora, Soll- und Istwert, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Österreichbewusstsein bei Pflichtschulkindern (1955-1966)"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Österreichbewusstseins bei österreichischen Pflichtschulkindern zwischen 1955 und 1966. Sie analysiert, wie und in welchem Umfang ein nationales Bewusstsein in der Schule vermittelt wurde und welche Rolle verschiedene Schulfächer und außerschulische Aktivitäten dabei spielten.
Welche Zeitspanne wird in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Jahre 1955 bis 1966, also die ersten Jahre der Zweiten Republik nach dem Staatsvertrag.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von Schulbüchern, Lehrplänen und anderen relevanten Quellen, um die Vermittlung von österreichischer Identität im Unterricht zu untersuchen. Die Rolle von Familie, Schule und Freundeskreis bei der Identitätsbildung wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche methodischen Ansätze wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse von Schulmaterialien und berücksichtigt den Ansatz von Pierre Nora zu Erinnerungsorten, um die Entwicklung des Österreichbewusstseins zu verstehen. Es wird auch ein Vergleich zwischen dem "Soll- und Istwert" des Unterrichtsstoffes vorgenommen, um die tatsächliche Wirkung des Unterrichts zu beleuchten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Vermittlung eines Österreichbewusstseins im Unterricht, die Rolle verschiedener Schulfächer (Geschichte, Geographie, Deutsch, Musik, Turnen) bei der Identitätsbildung, den Einfluss innen- und außenpolitischer Ereignisse (Staatsvertrag, Ungarischer Volksaufstand 1956) auf das Österreichbild der Kinder, die Analyse von Lernmethoden und deren Wirkung, sowie die Identifizierung von Kontinuitäten und Brüchen im Bildungsprozess.
Welche Schulfächer werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Geschichte, Geographie, Deutsch, Musik und Turnunterricht bei der Vermittlung eines österreichischen Nationalbewusstseins. Es wird untersucht, wie diese Fächer zum Aufbau von territorialer, wirtschaftlicher und kultureller Identifikation beitrugen.
Welche Rolle spielen außerschulische Aktivitäten?
Die Arbeit untersucht auch den Einfluss außerschulischer Aktivitäten wie Ausflüge und Exkursionen auf die Entwicklung des Österreichbewusstseins.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Effektivität der Vermittlung von österreichischer Identität im Schulunterricht der 1950er und 1960er Jahre und identifiziert mögliche regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Österreichbewusstsein, Identitätsbildung, Pflichtschulunterricht, Zweite Republik, Nachkriegszeit, Staatsvertrag, Schulbücher, Lehrpläne, Geschichtsunterricht, Geographie, Deutschunterricht, Musikunterricht, Turnunterricht, Erinnerungsorte, Pierre Nora, Soll- und Istwert, nationale Identität.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich im oberen Teil des bereitgestellten HTML-Dokuments.
- Citar trabajo
- Martin Hammer (Autor), 2013, Das Entstehen eines Österreichbewusstseins zwischen 1955-1966, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501004