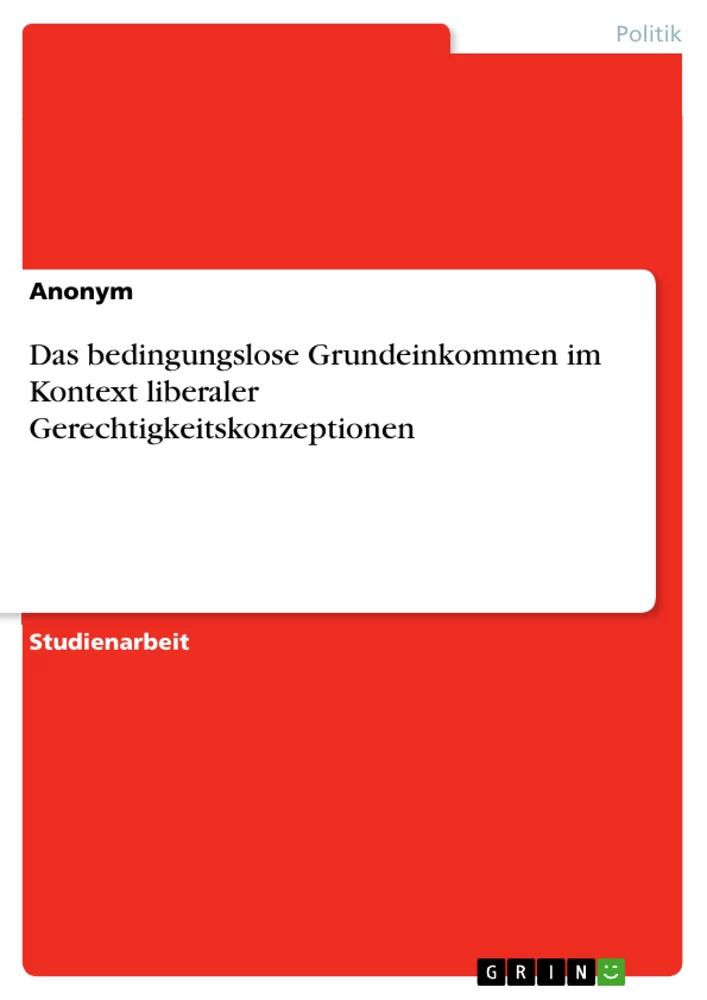Wie ist das bedingungslose Grundeinkommen im Kontext liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen zu beurteilen? Dieser Frage soll in der vorliegenden Hausarbeit nachgegangen werden.
Die politische Forderung nach einem BGE lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und tritt seitdem wellenartig immer wieder in Erscheinung. Angesichts der zunehmenden Produktivität fortgeschrittener Volkswirtschaften, der zunehmend ungleichen Einkommensverteilung, der mit der Automatisierung einhergehenden Abnahme klassischer Erwerbsarbeit und Zunahme „atypischer“ Beschäftigungsverhältnisse im Laufe des 20. Jahrhunderts wird das BGE zunehmend als sozialpolitische Alternative bemüht.
Neben einigen Pilotprojekten wie beispielsweise in Kanada und Finnland, wurde 2016 in der Schweiz das erste Referendum weltweit über die Einführung eines BGE abgehalten. Die Idee des BGE erlebt aber nicht nur im gesellschaftlichen und politischen Diskurs neuen Aufschwung, auch in der akademischen Debatte erlangt das Thema immer mehr Aufmerksamkeit. Seit 2006 widmet sich daher ein ganzes Journal, das „Basic Income Studies“, ausschließlich dem Thema Grundeinkommen. Die Idee jedem Menschen eine permanente Transferzahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Anknüpfung an Arbeitsbereitschaft zukommen zu lassen, wird dabei in vielerlei Hinsicht kritisiert. Neben ökonomischen Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit, der Auswirkung auf die öffentlichen Haushalte, sowie des Arbeitsmarktes werden vor allem aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht Einwände gegen ein BGE erhoben.
Hinter diesem Einwand stehen zwei zutiefst liberale Konzeptionen von Gerechtigkeit. Vordergründig steht die Forderung nach Reziprozität, der Idee, dass Gerechtigkeit bzw. Fairness auf gegenseitigem Austausch beruhen muss. Eng damit verbunden steht der Gedanke der Selbstbestimmtheit und Freiheit gegenüber staatlichen Eingriffen in die Gesellschaft. Innerhalb der politischen Philosophie sind es deswegen vor allem Vertreter des Liberalismus, die der Idee eines BGE entgegenstehen. Sowohl Robert Nozick, prominentester Vertreter des Markt-Libertarismus, als auch John Rawls, Vertreter des egalitären Liberalismus, lehnen das BGE aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Liberalismus - eine heterogene Strömung
- Das BGE als Instrument der „realen Freiheit für alle“
- Gerechtigkeitstheoretische Analyse des BGE
- Der Freiheitsbegriff im Kontext der Aneignungstheorie
- Freiheit und Umverteilung
- Die gerechte Umverteilung nach dem Maxi-Min Prinzip
- Das Neutralitätsprinzip: Die Crazy-Lazy Challange
- Ressourcenegalitarismus - Lösung des Neutralitätsprinzips
- Arbeitsplatzrenditen als umzuverteilende unverdiente Ressourcen
- Das Problem der Reziprozität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) aus der Perspektive liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des BGE zu beleuchten und dessen Kompatibilität mit verschiedenen liberalen Ansätzen zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Konzepte der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Reziprozität im Fokus stehen.
- Der Freiheitsbegriff und seine Bedeutung für das BGE
- Die verschiedenen Strömungen des Liberalismus und deren Positionen zum BGE
- Die Rolle von Umverteilung und Reziprozität in der Debatte um das BGE
- Die Kritik an der BGE-Idee aus der Perspektive des Markt-Libertarismus und des egalitären Liberalismus
- Das BGE als Instrument der „realen Freiheit für alle“ nach Phillipe Van Parijs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das BGE als aktuelles Thema der politischen und wissenschaftlichen Debatte vor. Es werden die historischen Wurzeln des BGE sowie die Gründe für dessen aktuelle Relevanz beleuchtet.
- Der Liberalismus - eine heterogene Strömung: Das Kapitel skizziert die Grundprinzipien des Liberalismus, die das Individuum und seine Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Es werden die verschiedenen Strömungen des Liberalismus und deren Schwerpunkte dargestellt.
- Das BGE als Instrument der „realen Freiheit für alle“: Dieses Kapitel stellt die Argumentation von Phillipe Van Parijs für ein BGE vor. Van Parijs verknüpft das BGE mit dem Ziel der „realen Freiheit für alle“, die auf die Maximierung individueller Handlungsmöglichkeiten abzielt.
- Gerechtigkeitstheoretische Analyse des BGE: Die Argumentation von Van Parijs wird anhand der Theorien von Robert Nozick und John Rawls kritisch analysiert. Dabei werden die verschiedenen Konzeptionen von Freiheit, Gerechtigkeit und Reziprozität in den Blick genommen.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Liberalismus, Gerechtigkeitstheorie, Freiheit, Reziprozität, Umverteilung, Markt-Libertarismus, Egalitärer Liberalismus, Phillipe Van Parijs, Robert Nozick, John Rawls.
Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)?
Eine staatliche Transferzahlung an jeden Bürger ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Zwang zur Arbeit.
Warum lehnen Liberale wie John Rawls das BGE ab?
Rawls lehnt es aufgrund des Reziprozitätsprinzips ab; er argumentiert, dass diejenigen, die arbeiten, nicht diejenigen finanzieren sollten, die sich bewusst für Freizeit entscheiden.
Was versteht Philippe Van Parijs unter „realer Freiheit“?
Reale Freiheit bedeutet nicht nur das Recht (formale Freiheit), sondern auch die Mittel (finanzielle Basis durch das BGE) zu haben, um seine Lebensziele zu verfolgen.
Wie steht der Markt-Libertarismus zum BGE?
Vertreter wie Robert Nozick lehnen es meist ab, da die dafür notwendige Umverteilung als unrechtmäßiger Eingriff in das Eigentumsrecht gesehen wird.
Was ist die „Crazy-Lazy Challenge“?
Ein Gedankenexperiment zum Neutralitätsprinzip: Sollte der Staat denjenigen, der lieber surft (Lazy), genauso unterstützen wie denjenigen, der hart arbeitet (Crazy)?
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Das bedingungslose Grundeinkommen im Kontext liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501032