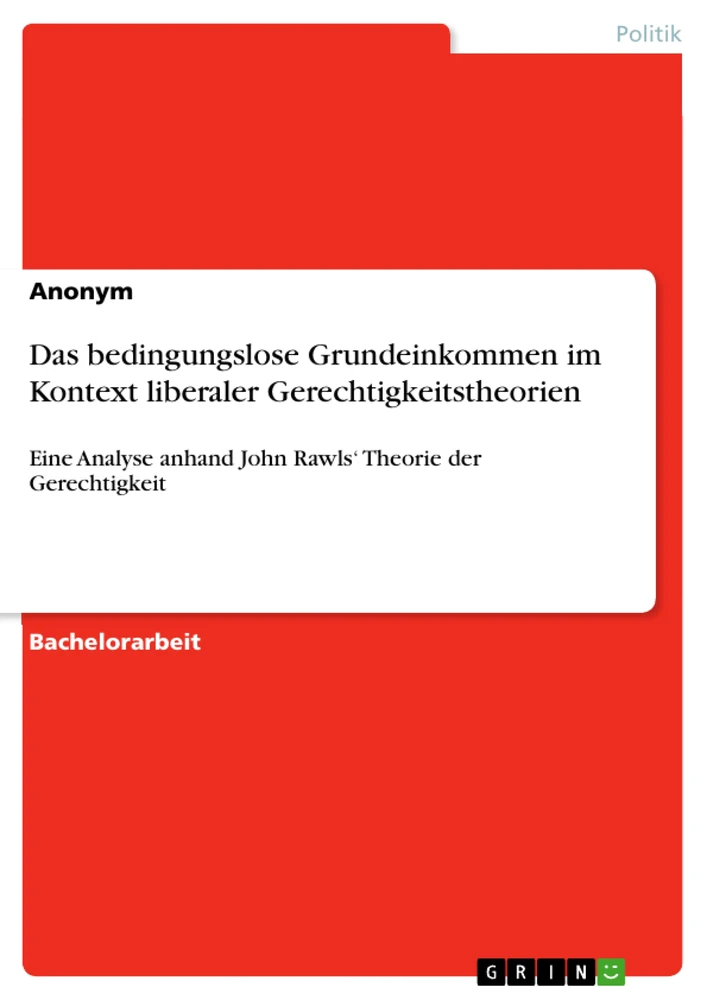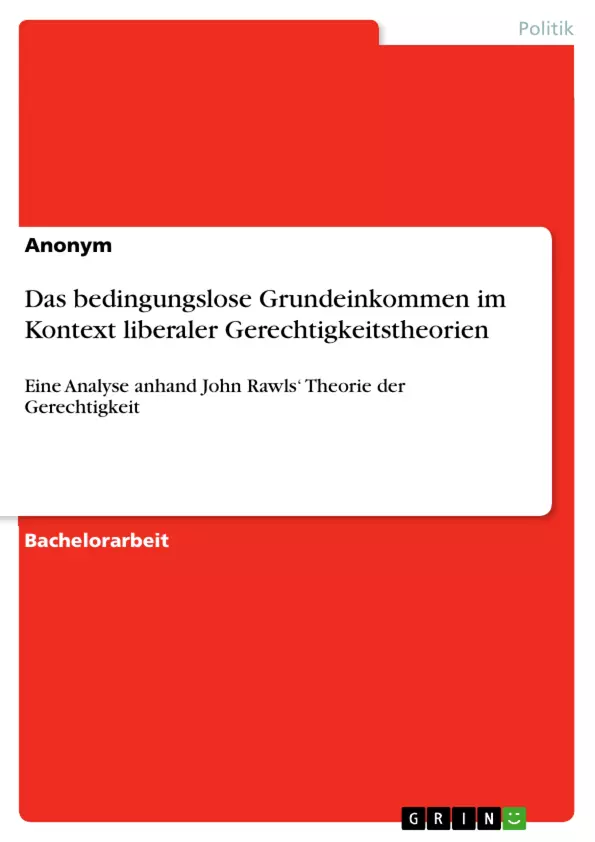Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Forschungsfrage, ob das bedingungslose Grundeinkommen mit John Rawls Theorie der Gerechtigkeit kompatibel ist. Angesichts der wachsenden Produktivität fortgeschrittener Volkswirtschaften, der zunehmend ungleichen Einkommensverteilung, der mit der Automatisierung einhergehenden Abnahme klassischer Erwerbsarbeit sowie der Zunahme "atypischer" Beschäftigungsverhältnisse im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts, wird das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) zunehmend als sozialpolitische Alternative bemüht. Neben einigen Pilotprojekten wie beispielsweise in Kanada und Finnland, wurde 2016 in der Schweiz das erste Referendum weltweit über die Einführung eines BGE abgehalten.
Die Idee des BGE erlebt dabei aber nicht nur im gesellschaftlichen und politischen Diskurs neuen Aufschwung, auch in der akademischen Debatte erlangt das Thema immer mehr Aufmerksamkeit. Seit 2006 widmet sich beispielsweise ein ganzes Journal, das "Basic Income Studies", ausschließlich dem Thema Grundeinkommen. Die Idee, jedem Menschen eine permanente periodische Transferzahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Anknüpfung an eine Arbeitsbereitschaft zukommen zu lassen, wird dabei aber auch in vielerlei Hinsicht kritisiert.
Neben ökonomischen Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit und der Auswirkung auf die öffentlichen Haushalte, sowie des Arbeitsmarktes werden vor allem aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht Einwände gegen ein BGE erhoben. Die Kernkritik an einem BGE richtet sich konkret - um es mit den Worten des norwegisch-US-amerikanischen Philosophen Jon Elster auszudrücken - gegen "[…] a widely accepted notion of justice: it is unfair for able-bodied people to live off the labor of others". Hinter diesem Einwand stehen zwei zutiefst liberale Konzeptionen von Gerechtigkeit. Vordergründig steht die Forderung nach Reziprozität, also dem Konzept, dass Gerechtigkeit auf einer Form der Gegenseitigkeit (gegenseitigen Inanspruchnahme) beruhen muss. Eng damit verbunden steht das Recht auf Eigentum und der Schutz vor staatlichen Eingriffen.
Innerhalb der politischen Philosophie sind es deswegen vor allem Vertreter des Liberalismus, die der Idee eines BGE entgegenstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffs- und Konzeptbestimmungen
- Verteilungsgerechtigkeit
- Der Liberalismus – Theorien der gerechten Verteilung
- Das BGE- Entwicklung eines liberalen Konzeptes
- Theoretische Grundlage: John Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness
- Analyse des BGE im Kontext der Gerechtigkeitstheorie
- Das Differenzprinzip
- Bezugspunkt des Differenzprinzips - Interpretationsmöglichkeiten
- Diskriminierung zwischen unterschiedlichen Konzeptionen des Guten
- Neutralität bei Rawls
- Reziprozität bei Rawls
- Arbeit und fairer Beitrag
- Arbeitsplatzmangel
- Sinnvolle Arbeit und der Aristotelische Grundsatz
- Selbstachtung -,,das wohl wichtigste Grundgut”
- Das BGE als Grundlage der Selbstachtung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kompatibilität des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) mit John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit. Die Arbeit analysiert das BGE im Kontext des Liberalismus und der gerechten Verteilung und untersucht, ob ein BGE mit Rawls' Differenzprinzip und der Rolle der Selbstachtung in seiner Theorie vereinbar ist.
- Das BGE im Kontext der liberalen Gerechtigkeitstheorie
- Die Rolle des Differenzprinzips bei der Bewertung des BGE
- Der Einfluss des BGE auf die Selbstachtung
- Kritik an der Idee eines BGE aus liberaler Perspektive
- Die Relevanz des BGE im Kontext der modernen Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) als ein aktuelles Thema in der sozialpolitischen Debatte vor und erläutert die wachsende Bedeutung des Themas in der wissenschaftlichen Forschung. Es werden die wichtigsten Argumente für und gegen ein BGE dargestellt, insbesondere aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive.
- Begriffs- und Konzeptbestimmungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter Verteilungsgerechtigkeit, Liberalismus und das bedingungslose Grundeinkommen. Es zeigt auf, wie diese Begriffe miteinander in Beziehung stehen und bildet die Grundlage für die spätere Analyse des BGE innerhalb der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls.
- Theoretische Grundlage: John Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness: Dieser Abschnitt stellt die theoretische Grundlage der Arbeit dar, nämlich die Theorie der Gerechtigkeit als Fairness von John Rawls. Er stellt die zentralen Elemente der Theorie vor und bezieht sich auf Rawls' Werke wie „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ und „Politischer Liberalismus“.
- Analyse des BGE im Kontext der Gerechtigkeitstheorie: Dieses Kapitel untersucht das BGE im Lichte von Rawls' Gerechtigkeitstheorie. Es befasst sich mit dem Differenzprinzip und der Rolle der Selbstachtung in Rawls' Theorie und untersucht, ob ein BGE mit diesen Prinzipien vereinbar ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Verteilungsgerechtigkeit, Liberalismus, bedingungsloses Grundeinkommen, John Rawls, Differenzprinzip, Selbstachtung, Reziprozität, Arbeit und fairer Beitrag, „atypische“ Beschäftigungsverhältnisse, Automatisierung, Wirtschaftsliberalismus.
Häufig gestellte Fragen
Ist das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) mit John Rawls kompatibel?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Es wird untersucht, ob das BGE mit Rawls' "Differenzprinzip" und dem Grundgut der "Selbstachtung" vereinbar ist.
Was besagt das Differenzprinzip von John Rawls?
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft den größtmöglichen Vorteil bringen.
Was ist die liberale Hauptkritik am BGE?
Kritiker wie Jon Elster argumentieren, es sei ungerecht, wenn arbeitsfähige Menschen von der Arbeit anderer leben, ohne selbst einen Beitrag (Reziprozität) zu leisten.
Welche Rolle spielt die Selbstachtung in der Gerechtigkeitstheorie?
Rawls bezeichnet Selbstachtung als das wichtigste Grundgut. Die Arbeit prüft, ob ein BGE die Selbstachtung stärkt, indem es materielle Existenzangst nimmt.
Warum ist das BGE heute ein so aktuelles Thema?
Durch Automatisierung, den Rückgang klassischer Erwerbsarbeit und die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse suchen Politik und Wissenschaft nach neuen sozialpolitischen Lösungen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Das bedingungslose Grundeinkommen im Kontext liberaler Gerechtigkeitstheorien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501033