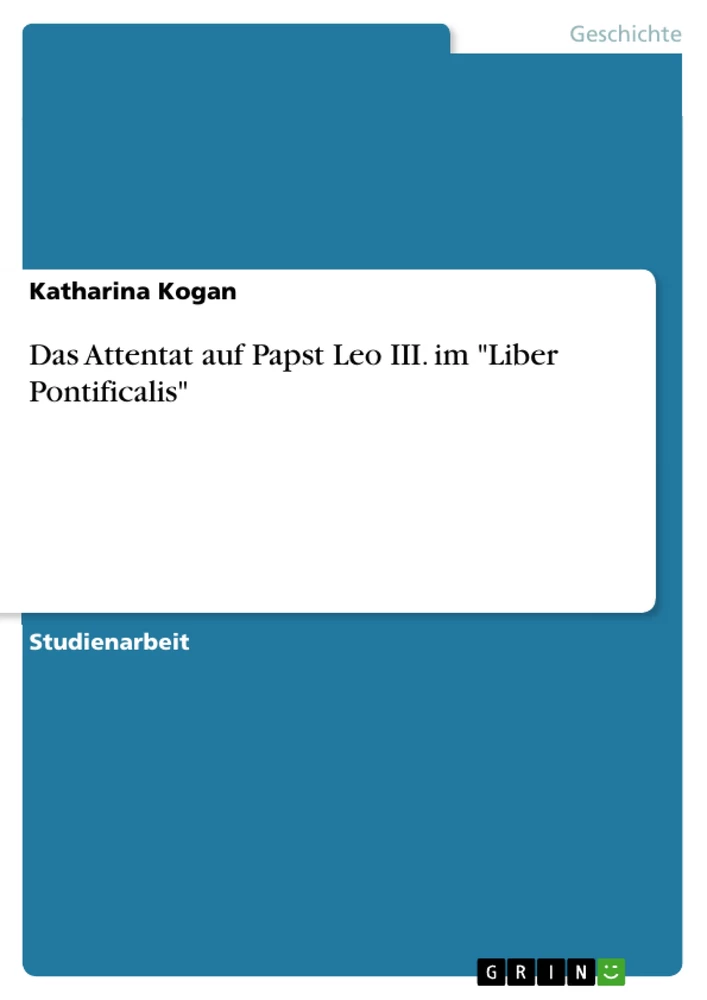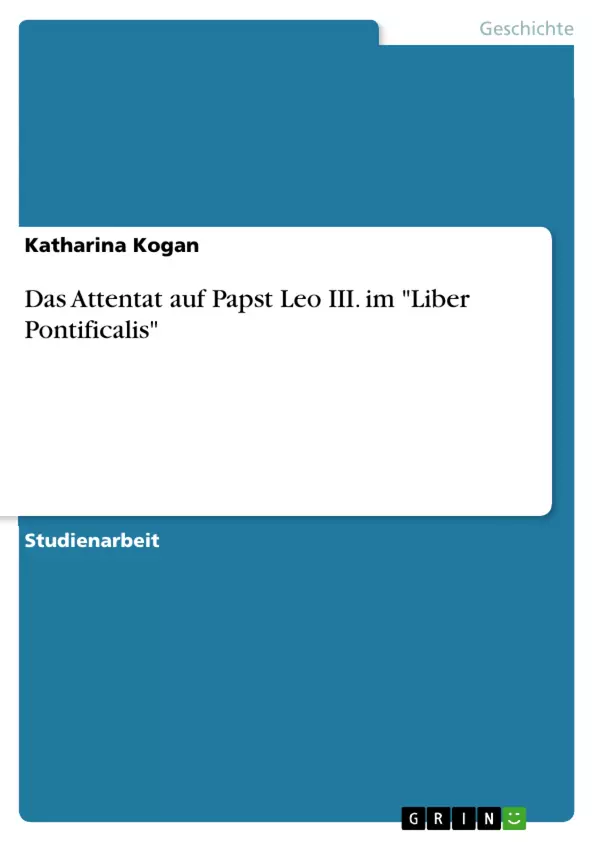Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Attentat auf Papst Leo III im April 799 während einer Bittprozession auf dem Weg vom Lateran nach Sankt Laurentius. Dabei geht es um die Frage, was Leos Gegner mit dem Anschlag erreichen wollten. Aus den Ergebnissen der Quellenanalyse wird versucht, eine Antwort darauf zu geben. Zuerst werden einige der vorhandenen Quellen vorgestellt. Die zentrale Quelle ist das Papstbuch "Liber Pontificalis". Im Hauptteil wird anhand der ausgewählten Quellen gezeigt, wie das Attentat auf Papst Leo III darin beschrieben wird. Dabei wird auch auf Unterschiede in den Darstellungen eingegangen. Auffällig ist, dass man den genauen Ablauf des Anschlags aufgrund widersprüchlichen Aussagen nur schwer rekonstruieren kann. Die Vermutung liegt nahe, dass Personen in Machtpositionen besser dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangspunkt
- Thema und Vorgehensweise
- Ad fontes: Das Attentat auf den Papst
- Wunder der Heilung Leos III. durch Gott
- Der Reinigungseid des Papstes in der Peterskirche
- Auswertung der Quellenaussagen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799 aus der Perspektive verschiedener Quellen zu analysieren und zu interpretieren. Dabei stehen die Darstellung des Anschlags im Liber Pontificalis und der Vergleich zu anderen Quellen im Vordergrund.
- Die Darstellung des Attentats in verschiedenen Quellen (Liber Pontificalis, Annalen, Briefe etc.)
- Die möglichen Motive der Attentäter und ihre Ziele
- Die Problematik der Quelleninterpretation und der historischen Rekonstruktion des Attentats
- Die Bedeutung des Attentats für die Beziehung zwischen Papsttum und Frankenreich
- Die Rolle von Wunder und Propaganda im Kontext des Attentats
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und erläutert die Forschungsfrage. Es werden auch einige wichtige Definitionen und methodische Überlegungen angesprochen.
- Ad fontes: Das Attentat auf den Papst: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Quellen zum Attentat auf Leo III., wobei der Fokus auf dem Liber Pontificalis liegt. Es werden weitere Quellen wie Annalen, Briefe etc. herangezogen und die verschiedenen Perspektiven auf das Attentat gegenübergestellt.
- Wunder der Heilung Leos III. durch Gott: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Quellen zum Wunder der Heilung Leos III. untersucht. Es wird analysiert, wie und warum dieses Wunder in den Quellen dargestellt wird und welche Bedeutungen diesem Wunder zugeschrieben werden können.
- Der Reinigungseid des Papstes in der Peterskirche: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Reinigungseid Leos III. kurz vor der Kaiserkrönung Karls des Großen. Es wird untersucht, welche Quellen sich mit diesem Ereignis befassen und welche Interpretationsmöglichkeiten sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Attentat, Papst Leo III., Liber Pontificalis, Quellenanalyse, Quellenkritik, Frankenreich, Karl der Große, Kaiserkrönung, Wunder, Propaganda und historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah beim Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799?
Der Papst wurde während einer Bittprozession in Rom angegriffen. Die Attentäter versuchten offenbar, ihn zu blenden und seine Zunge abzuschneiden.
Was ist der "Liber Pontificalis"?
Das "Papstbuch" ist die zentrale historische Quelle, die das Leben der Päpste beschreibt und eine spezifische Sichtweise auf das Attentat bietet.
Warum ist der Ablauf des Anschlags historisch schwer zu rekonstruieren?
Die vorhandenen Quellen wie Annalen und Briefe enthalten widersprüchliche Aussagen, die oft von den Machtpositionen der jeweiligen Verfasser geprägt sind.
Was war der Zweck des Reinigungseides von Leo III.?
Der Papst leistete den Eid in der Peterskirche, um sich von den Vorwürfen seiner Gegner reinzuwaschen und seine Autorität vor der Kaiserkrönung Karls des Großen wiederherzustellen.
Welche Rolle spielten "Wunder" in der Berichterstattung?
Quellen berichten von einer wunderbaren Heilung des Papstes durch Gott, was oft als sakrale Propaganda zur Legitimierung seiner Herrschaft gedeutet wird.
- Citation du texte
- Katharina Kogan (Auteur), 2019, Das Attentat auf Papst Leo III. im "Liber Pontificalis", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501198