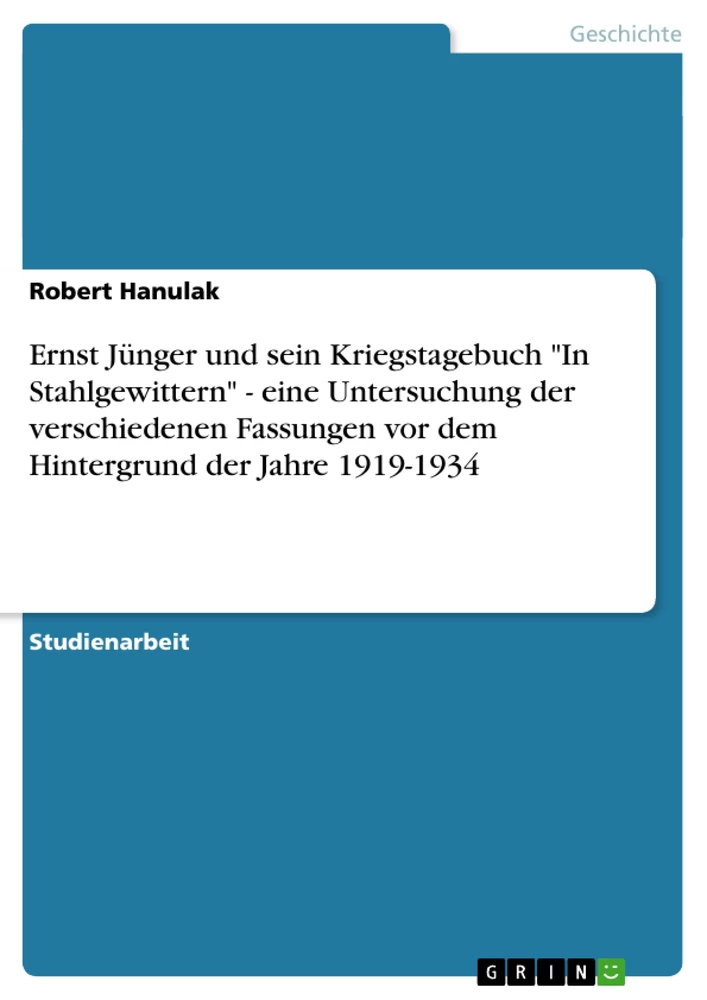Der zeitliche Rahmen dieser Analyse umfasst im wesentlichen die Jahre 1919 bis 1934, also den Zeitraum zwischen Entstehung der ersten Fassung und dem Erscheinen der vierten Fassung. Weitere Änderungen des Buches 1961 und 1978 finden hier keine weitere Beachtung, da sie in erster Linie stilistischer Natur sind und keinen unmittelbaren Bezug zur politischen Situation der Jahre haben. Hingegen wird man nicht umhin kommen einige Aspekte aus Jüngers Biographie bis 1919 zu skizzieren, da sein Verhältnis zu Elternhaus und Schule, und insbesondere natürlich das Kriegserlebnis selbst, entscheidenden Einfluss auf sein literarisches und politisches Wirken in der Weimarer Zeit hatte.
Schwierig erscheint eine brauchbare Begriffsfindung um Jünger genauer einer Ideenrichtung bzw. einer geistigen Gruppierung zuzuordnen. Der Überbegriff Nationalismus bedarf in Bezug auf Ernst Jüngers spezieller Ausprägung in den 20er Jahren einer stärkeren Differenzierung. Eine einheitliche Terminologie hat sich hier bislang nicht durchgesetzt. Der Begriff „Soldatischer Nationalismus“ erscheint am brauchbarsten um Jüngers frühe Kriegsliteratur zu charakterisieren. Er bezeichnet eine Form des Nationalismus, also des Bewusstseins, welches die Größe und Macht der eigenen Nation als höchsten Wert erachtet, dessen entscheidender Ausgangspunkt und bindendes Element das Kriegserlebnis darstellt, aus dem fast alle politischen und gesellschaftlichen Ideallösungen abgeleitet werden. Hauptgegner war die Weimarer Republik und Ziel die Errichtung einer totalitären Diktatur. In der Literatur werden auch die Begriffe „Neuer Nationalismus“ und „Revolutionärer Nationalismus“ nahezu austauschbar verwendet. Aus solchen Einordnung ergeben sich aber erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Definition und Abgrenzung relativ homogener Gruppierungen und Strömungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ernst Jünger bis 1918
- 2.1. Kindheit und Jugend
- 2.2. Im Krieg
- 3. „In Stahlgewittern“ I und II 1919 – 1922
- 3.1. Ernst Jünger um 1919
- 3.2. Die erste Fassung 1920
- 3.3. Die zweite Fassung 1922
- 3.4. Fazit
- 4. „In Stahlgewittern“ III 1923 - 1924
- 4.1. Das Jahr 1923
- 4.2. Die dritte Fassung 1924
- 4.3. Fazit
- 5. „In Stahlgewittern“ IV 1925 - 1934
- 5.1. Ernst Jüngers Entwicklung bis 1933
- 5.2. Die vierte Fassung 1934
- 5.3. Fazit
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Fassungen von Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ zwischen 1919 und 1934. Ziel ist es, die Bedeutung des Buches innerhalb von Jüngers Werk zu beleuchten und seine Haltung zum Nationalsozialismus im Kontext der Textänderungen zu analysieren. Die Analyse soll Jüngers geistige und politische Verantwortung für den Niedergang der Weimarer Republik näher untersuchen.
- Entwicklung von Ernst Jüngers Weltanschauung bis 1918
- Analyse der Textänderungen in den verschiedenen Fassungen von „In Stahlgewittern“
- Einordnung der Textänderungen in den biographischen und zeitgeschichtlichen Kontext
- Jüngers Verhältnis zum Nationalsozialismus
- Bedeutung des „Soldatischen Nationalismus“ für Jüngers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Ernst Jünger als einen umstrittenen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts vor und begründet die Notwendigkeit der Untersuchung der verschiedenen Fassungen von „In Stahlgewittern“. Sie betont die Bedeutung der Textänderungen im Kontext von Jüngers Biographie und der politischen Situation der Weimarer Republik und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die einzelnen Fassungen historisch lokalisiert und die Textänderungen vor dem biographischen und politischen Hintergrund untersucht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Fassungen bis 1934 und grenzt stilistische Änderungen späterer Fassungen aus.
2. Ernst Jünger bis 1918: Dieses Kapitel skizziert die frühen Jahre Ernst Jüngers, seine Kindheit und Jugend, sowie seinen militärischen Werdegang vor dem Ersten Weltkrieg. Es legt die Grundlage für das Verständnis seiner späteren literarischen und politischen Entwicklung. Die Darstellung seines Verhältnisses zum Elternhaus und seiner Erfahrungen im Krieg wird als entscheidender Einflussfaktor auf sein Schaffen während der Weimarer Republik hervorgehoben.
3. „In Stahlgewittern“ I und II 1919 – 1922: Dieses Kapitel analysiert die ersten beiden Fassungen von „In Stahlgewittern“, entstanden 1920 und 1922. Es beleuchtet die Situation um 1919 und die Veränderungen zwischen den beiden Fassungen, wobei der Fokus auf die Einflüsse des persönlichen und politischen Kontextes liegt. Der Vergleich der Fassungen soll Hinweise auf Jüngers sich entwickelnde politische Positionen liefern, ohne dabei zu tief in die Details der Textaenderungen selbst einzugehen.
4. „In Stahlgewittern“ III 1923 - 1924: Hier wird die dritte Fassung von „In Stahlgewittern“ (1924) untersucht. Das Kapitel beleuchtet das Jahr 1923 mit seinen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen und deren Einfluss auf die vorgenommenen Textänderungen. Die Analyse konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen den politischen Ereignissen und den Veränderungen in Jüngers Text, und wie diese den Wandel seiner Ansichten reflektieren.
5. „In Stahlgewittern“ IV 1925 - 1934: In diesem Kapitel wird die vierte Fassung von „In Stahlgewittern“ (1934) im Kontext von Jüngers Entwicklung bis 1933 analysiert. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Veränderungen in der letzten Fassung vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Nationalsozialismus und beleuchtet wie sich Jüngers persönliche und politische Entwicklung in den Textänderungen manifestiert. Das Kapitel verdeutlicht die komplexen Zusammenhänge zwischen Jüngers Werdegang und dem politischen Klima seiner Zeit.
Schlüsselwörter
Ernst Jünger, In Stahlgewittern, Kriegstagebuch, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Soldatischer Nationalismus, Textanalyse, Werkgenese, politische Entwicklung, Biographie.
Häufig gestellte Fragen zu "In Stahlgewittern": Ernst Jüngers Werkgenese
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Fassungen von Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" zwischen 1919 und 1934. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Textänderungen im Kontext von Jüngers Biografie und der politischen Entwicklung der Weimarer Republik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von "In Stahlgewittern" innerhalb von Jüngers Gesamtwerk und analysiert seine Haltung zum Nationalsozialismus anhand der Textänderungen. Sie untersucht zudem Jüngers geistige und politische Verantwortung für den Niedergang der Weimarer Republik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Jüngers Weltanschauung bis 1918, die Analyse der Textänderungen in den verschiedenen Fassungen von "In Stahlgewittern", die Einordnung dieser Änderungen in den biographischen und zeitgeschichtlichen Kontext, Jüngers Verhältnis zum Nationalsozialismus und die Bedeutung des "Soldatischen Nationalismus" für sein Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die einzelnen Fassungen von "In Stahlgewittern" (1920, 1922, 1924, 1934) untersuchen. Jedes Kapitel betrachtet die jeweilige Fassung vor dem Hintergrund des biographischen und politischen Kontextes. Zusätzlich gibt es eine Einleitung und eine Schlussbetrachtung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen historisch-textanalytischen Ansatz. Die einzelnen Fassungen werden historisch lokalisiert und die Textänderungen vor dem biographischen und politischen Hintergrund untersucht. Der Fokus liegt auf den Fassungen bis 1934; stilistische Änderungen späterer Fassungen werden ausgeblendet.
Was wird in Kapitel 2 ("Ernst Jünger bis 1918") behandelt?
Dieses Kapitel skizziert Jüngers frühe Jahre, seine Kindheit, Jugend und seinen militärischen Werdegang vor dem Ersten Weltkrieg. Es legt die Grundlage für das Verständnis seiner späteren literarischen und politischen Entwicklung.
Was wird in den Kapiteln 3-5 ("In Stahlgewittern" I-IV) behandelt?
Diese Kapitel analysieren die vier Fassungen von "In Stahlgewittern". Sie beleuchten die jeweiligen Entstehungszeitpunkte, die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen und deren Einfluss auf die Textänderungen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen politischen Ereignissen und den Veränderungen in Jüngers Text.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine umfassende Interpretation von Jüngers Entwicklung und seiner Positionierung im Kontext der Weimarer Republik und des aufkommenden Nationalsozialismus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Ernst Jünger, In Stahlgewittern, Kriegstagebuch, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Soldatischer Nationalismus, Textanalyse, Werkgenese, politische Entwicklung, Biographie.
- Citar trabajo
- Robert Hanulak (Autor), 2003, Ernst Jünger und sein Kriegstagebuch "In Stahlgewittern" - eine Untersuchung der verschiedenen Fassungen vor dem Hintergrund der Jahre 1919-1934, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50135