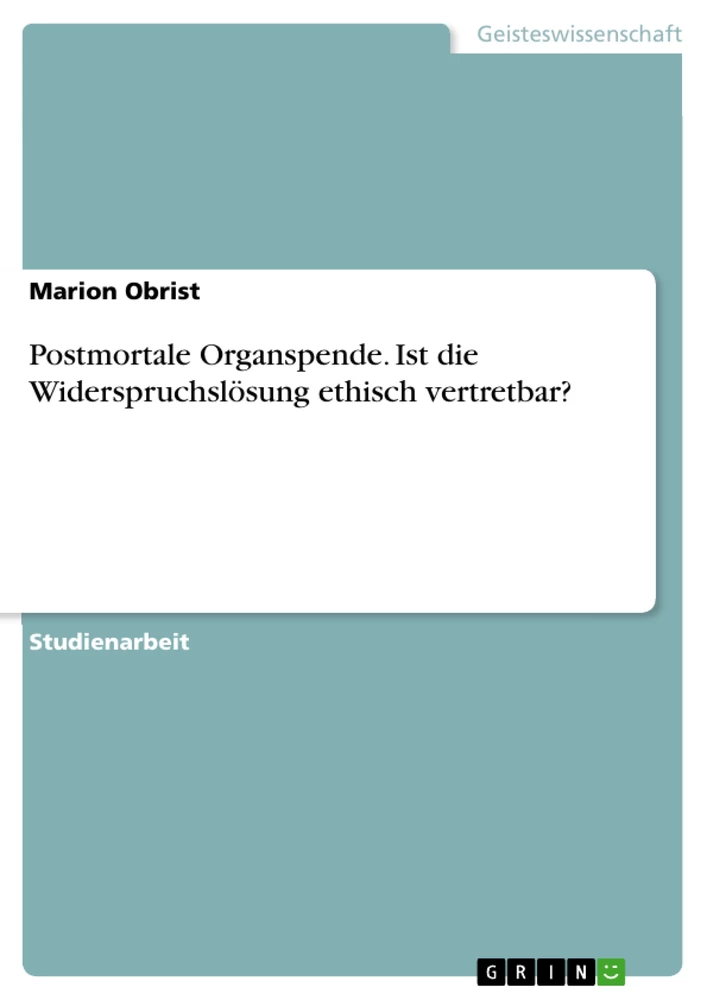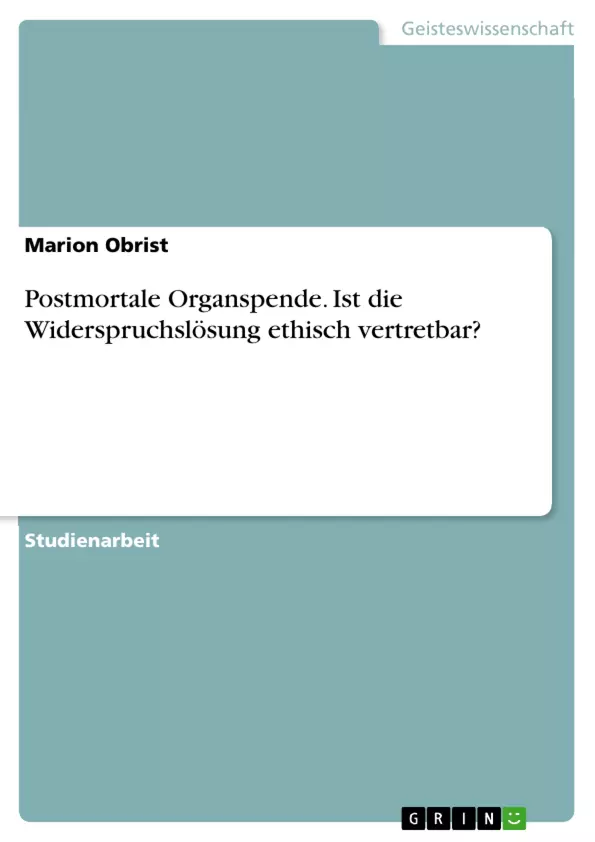Die Basis dieser Arbeit bildet eine Literaturrecherche. Um die Frage zu beantworten, ob die Widerspruchslösung bei der Organspende ethisch vertretbar ist, werden diese und die derzeit geltende Zustimmungslösung zunächst beschrieben und danach die ethischen Grundprinzipien und Theorien, die für die Untersuchung herangezogen werden, erläutert. In der darauffolgenden Diskussion wird dann die Widerspruchslösung anhand dieser Konzepte bewertet. In dieser Arbeit wird nur die Widerspruchslösung untersucht, weitere (beispielsweise organisatorische) Möglichkeiten zur Erhöhung der Anzahl der verfügbaren Organe werden nicht beleuchtet.
Der gravierende Mangel an Spenderorganen führt unter anderem dazu, dass jedes Jahr fast 1.000 Personen, die sich auf der Warteliste befinden, sterben. Um die Zahl der Organtransplantationen zu erhöhen wurde im Februar 2019 vom Deutschen Bundestag eine Änderung des Transplantationsgesetzes (TPG), das die Organspende in Deutschland seit 1997 regelt, beschlossen. Diese Änderungen sollen vor allem organisatorische und finanzielle Missstände beheben. So sollen Hindernisse in den Kliniken beseitigt werden: Transplantationsexperten in Krankenhäusern sollen mehr Zeit bekommen und der Prozess der Organentnahme soll besser vergütet werden.
Es gibt allerdings auch Anhaltspunkte dafür, dass die Gründe für die niedrigen Spendenzahlen nicht nur in organisatorischen Defiziten des Gesundheitssystems liegen, sondern auch in der gesetzlichen Regelung, die für eine postmortale Organspende eine ausdrückliche Zustimmungserklärung des Spenders bzw. seiner Angehörigen vorsieht. Ein Indiz dafür kann sein, dass nur 36 Prozent der Deutschen über einen Organspendeausweis verfügen, obwohl 84 Prozent dem Thema aufgeschlossen gegenüberstehen würden.
Im Vorschlag zur Änderung des TPG hatte Gesundheitsminister Jens Spahn auch eine doppelte Widerspruchsregelung – weder der Spender noch seine Angehörigen lehnen die Organspende ab – vorgesehen, welche allerdings nicht übernommen wurde. Diese Arbeit soll beleuchten, ob diese Alternative zur derzeitigen Regelung aus ethischer Sicht vertretbar wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik und Abgrenzungen
- Grundlagen
- Formen der Zustimmungs- und Widerspruchsregelung
- Situation in Deutschland
- Gesetzliche Regelungen
- Gründe für den Organmangel
- Theorien der Ethik
- Utilitarismus
- Kategorischer Imperativ
- Betroffene Menschenrechte
- Diskussion
- Utilitarismus
- Kategorischer Imperativ
- Fazit und Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der ethischen Vertretbarkeit der Widerspruchslösung im Kontext der postmortalen Organspende. Sie untersucht, ob die Einführung einer Widerspruchslösung, bei der eine Organspende automatisch zulässig ist, wenn keine explizite Ablehnung vorliegt, ethisch vertretbar wäre. Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und analysiert die ethischen Aspekte der Widerspruchslösung im Vergleich zur derzeit geltenden Zustimmungsregelung.
- Ethische Bewertung der Widerspruchslösung im Vergleich zur Zustimmungsregelung
- Analyse der Situation in Deutschland hinsichtlich des Organmangels und der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Anwendung ethischer Theorien (Utilitarismus, Kategorischer Imperativ) auf die Organspendethematik
- Betrachtung relevanter Menschenrechte im Kontext der Organspende
- Bewertung des Potenzials der Widerspruchslösung zur Erhöhung der Spenderraten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt das Problem des Organmangels in Deutschland dar und erläutert die aktuelle Gesetzgebung zur Organspende. Die Arbeit soll die ethische Vertretbarkeit der Widerspruchslösung im Vergleich zur Zustimmungsregelung beleuchten.
- Methodik und Abgrenzungen: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf einer Literaturrecherche basiert. Es werden die untersuchten Theorien und Konzepte sowie die Abgrenzung des Themenfeldes erläutert.
- Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Zustimmungs- und Widerspruchsregelung und beschreibt die aktuelle Situation in Deutschland. Es werden außerdem ethische Theorien (Utilitarismus, Kategorischer Imperativ) und die betroffenen Menschenrechte vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit herangezogen werden.
- Diskussion: In diesem Kapitel wird die Widerspruchslösung anhand der zuvor vorgestellten ethischen Theorien bewertet. Die Vor- und Nachteile der Widerspruchslösung im Vergleich zur Zustimmungsregelung werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Postmortale Organspende, Widerspruchslösung, Zustimmungsregelung, Utilitarismus, Kategorischer Imperativ, Menschenrechte, Organmangel, Ethik, Transplantationsgesetz, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Zustimmungs- und Widerspruchslösung?
Bei der Zustimmungslösung muss man explizit ja sagen (z.B. Organspendeausweis). Bei der Widerspruchslösung gilt jeder als Spender, außer man hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen.
Ist die Widerspruchslösung ethisch vertretbar?
Die Arbeit diskutiert dies anhand des Utilitarismus (Nutzen für die Gemeinschaft) und des Kategorischen Imperativs (Selbstbestimmung und Menschenwürde).
Warum gibt es in Deutschland einen Mangel an Spenderorganen?
Gründe sind organisatorische Defizite in Kliniken sowie die Tatsache, dass viele Menschen zwar grundsätzlich bereit sind zu spenden, aber keinen Ausweis besitzen.
Was besagt der Utilitarismus zur Organspende?
Aus utilitaristischer Sicht wäre die Widerspruchslösung geboten, da sie die Anzahl der verfügbaren Organe erhöht und somit das Leid vieler Wartender verringert.
Welche Menschenrechte sind bei der Organspende betroffen?
Betroffen sind vor allem das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper, auch über den Tod hinaus.
- Quote paper
- Marion Obrist (Author), 2019, Postmortale Organspende. Ist die Widerspruchslösung ethisch vertretbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501552