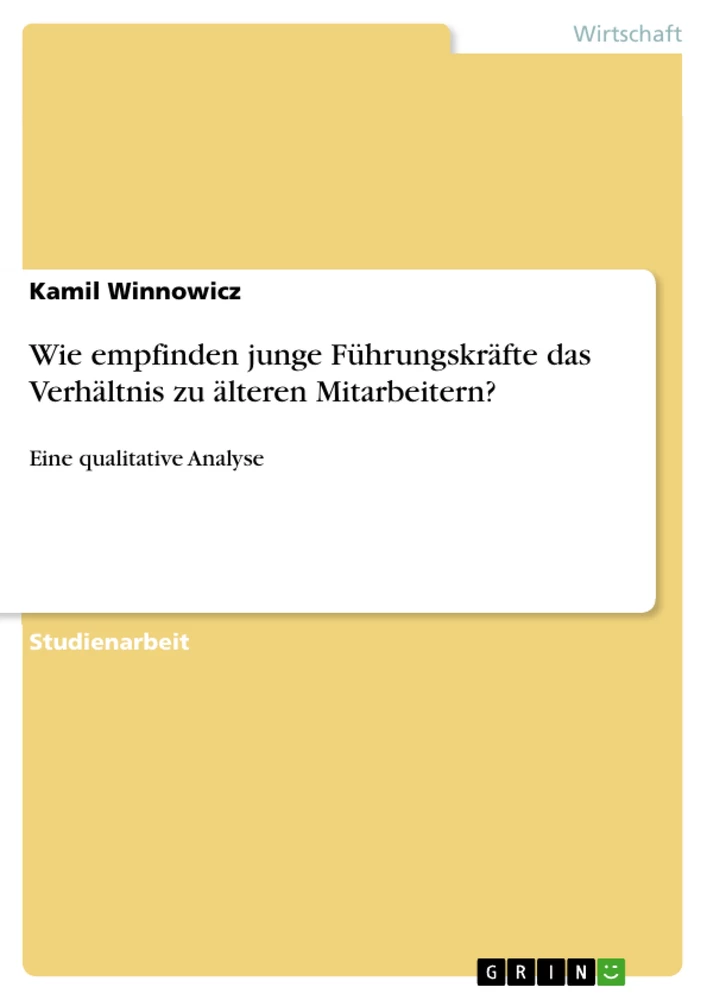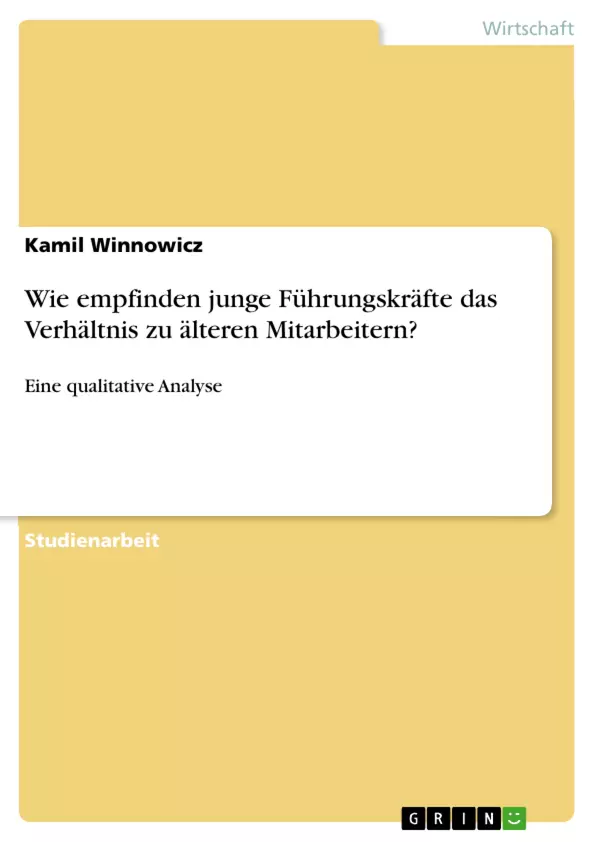Der demografische Wandel Deutschlands ist seit der Jahrtausendwende ein vielfach diskutiertes Phänomen, da sich zum einen die nachwachsenden Alterskohorten aufgrund der Geburtenrückgänge dezimieren und zum anderen die Lebenserwartung zunimmt. Laut dem statistischem Bundesamt ist davon auszugehen, dass im Jahr 2045 33% mehr Personen im Rentenalter sein werden, als noch im Jahr 2016. Somit wird zukünftig eine deutliche Verschiebung in Hinblick auf die Beschäftigungsentwicklung zwischen älteren und jüngeren Erwerbstätigen zu erkennen sein.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhältnis junger Führungskräfte ihren älteren Mitarbeitern gegenüber qualitativ zu analysieren. Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist eine qualitative Analyse in Form von Experteninterviews, welche die Thematik mithilfe von Fachexperten valide darstellen soll.
Die Digitalisierung und der demografische Wandel sind beides Megatrends, welche einen signifikanten Einfluss auf die Komplexität und Agilität in Unternehmen haben. Resultierend daraus gewinnen Managementphilosophien sowie arbeitsorganisatorische Konzepte, die auf eine stärkere Partizipation und mehr Flexibilität der Beschäftigten setzen und damit mehr Humankapital erfordern, an Bedeutung. Daher stehen Führungskräfte vor der Herausforderung zukünftig vermehrt Mitarbeiter zu führen, die deutlich älter sind als sie selbst. Darüber hinaus ist der Erhalt und Ausbau von Leistungspotenzialen älterer Mitarbeiter, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, ein weiterer kritischer Aspekt, der Führungskräfte zunehmend fordern wird. Hinsichtlich einer solchen Konstellation, gilt es qualitativ zu erforschen, wie junge Führungskräfte das Verhältnis zu ihren älteren Mitarbeitern empfinden. Weiterhin ist kritisch zu hinterfragen, welche Erkenntnisse bereits bestehende Forschungsergebnisse bieten und ob diese weitere Interpretationen bzgl. der Beziehungsqualität zulassen. Die Ergebnisse werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Führung
- Stand der Forschung
- Empirische Untersuchung
- Methodik und Interviewleitfaden
- Vorstellung der Interviewpartner
- Auswertung der Befragung
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht qualitativ das Verhältnis zwischen jungen Führungskräften und ihren älteren Mitarbeitern. Ziel ist es, mithilfe von Experteninterviews Einblicke in die Wahrnehmungen und Erfahrungen junger Führungskräfte in diesem Kontext zu gewinnen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend mit dem aktuellen Stand der Forschung verglichen und kritisch diskutiert.
- Die Wahrnehmung junger Führungskräfte gegenüber älteren Mitarbeitern
- Die Herausforderungen des demografischen Wandels für Führungskräfte
- Die Bedeutung von intergenerativer Zusammenarbeit in Unternehmen
- Der Einfluss von Digitalisierung auf das Verhältnis zwischen jungen und älteren Mitarbeitern
- Die Rolle der Führungskräfte im Umgang mit der Altersvielfalt im Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz der Fragestellung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Digitalisierung. Sie benennt die Forschungslücke, die diese Arbeit schließen soll, und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Begriffen Führung und dem Stand der Forschung zum Thema. Er liefert eine fundierte Basis für die spätere qualitative Analyse.
- Empirische Untersuchung: In diesem Kapitel werden die Methodik der Experteninterviews sowie der Interviewleitfaden vorgestellt. Außerdem werden die Interviewpartner vorgestellt und die Auswertung der Befragung erläutert.
- Diskussion: In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der qualitativen Analyse mit dem aktuellen Stand der Forschung diskutiert und verglichen. Dabei werden die Erkenntnisse der Experteninterviews kritisch beleuchtet und in den wissenschaftlichen Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen junge Führungskräfte, ältere Mitarbeiter, demografischer Wandel, Digitalisierung, intergenerative Zusammenarbeit, qualitative Forschung, Experteninterviews, Führung, Altersvielfalt, Leistungspotenziale.
Häufig gestellte Fragen
Warum müssen junge Führungskräfte immer öfter ältere Mitarbeiter führen?
Grund ist der demografische Wandel in Deutschland, durch den die Zahl der Rentner steigt und die der jungen Erwerbstätigen sinkt.
Wie beeinflusst die Digitalisierung dieses Verhältnis?
Digitalisierung erfordert Agilität und neue Kompetenzen, was Führungskräfte vor die Aufgabe stellt, Leistungspotenziale älterer Mitarbeiter gezielt zu fördern.
Was ist das Ziel der Experteninterviews in dieser Arbeit?
Die qualitative Analyse soll klären, wie junge Führungskräfte die Beziehungsqualität zu deutlich älteren Mitarbeitern subjektiv empfinden.
Welche Managementphilosophien gewinnen an Bedeutung?
Konzepte, die auf Partizipation, Flexibilität und dem Erhalt von Humankapital basieren, werden in der Altersvielfalt immer wichtiger.
Was sind die zentralen Herausforderungen für junge Chefs?
Dazu zählen Akzeptanzprobleme, die Überwindung von Generationenkonflikten und die Motivation erfahrener Mitarbeiter.
- Quote paper
- Kamil Winnowicz (Author), 2019, Wie empfinden junge Führungskräfte das Verhältnis zu älteren Mitarbeitern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501584