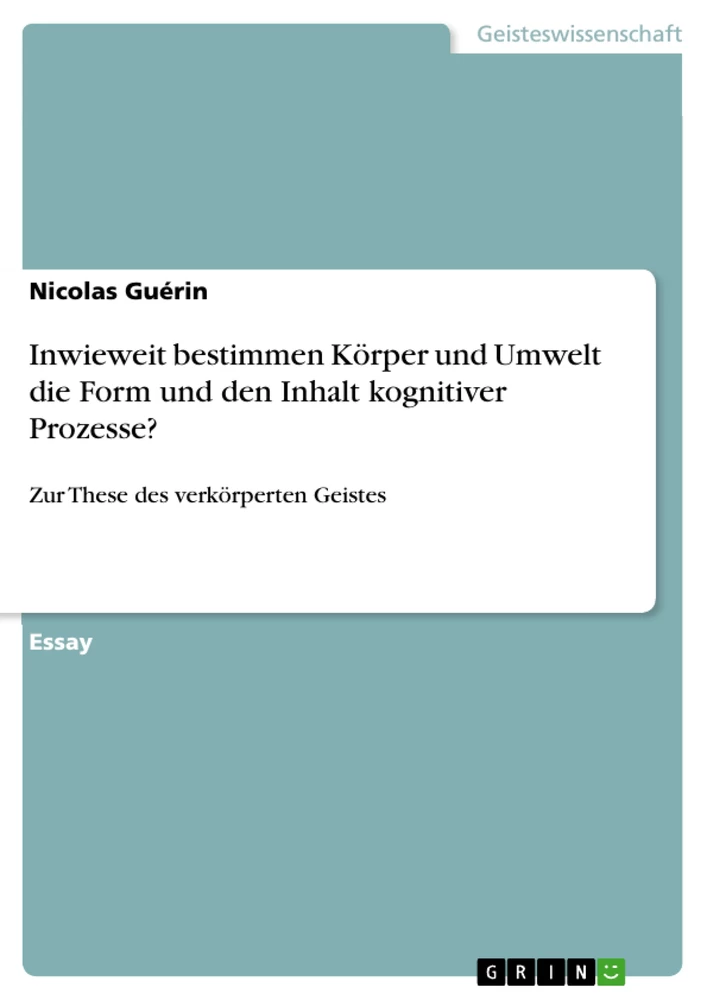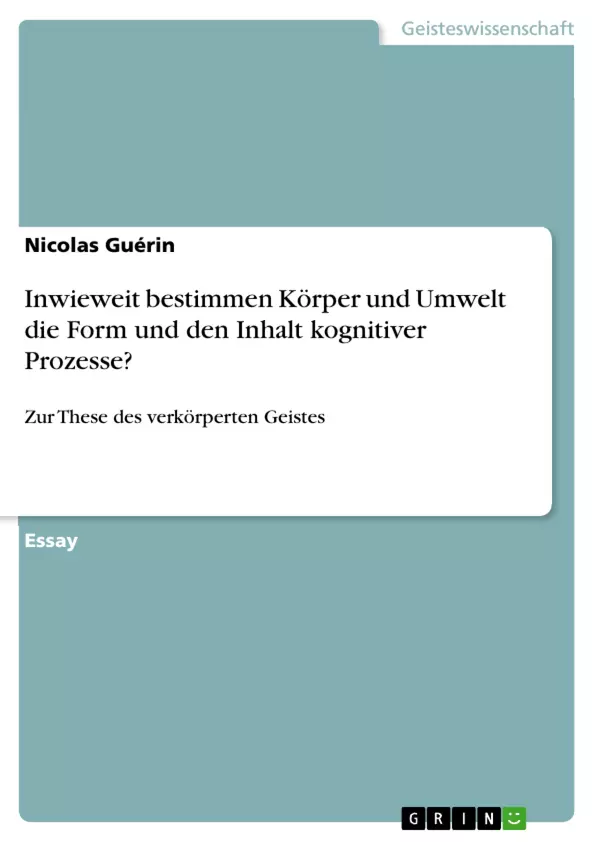Wir können beobachten: Ein Mensch sieht einen Unfall und greift im Folgenden zum Telefon, wählt eine Rufnummer und kontaktiert einen Notarzt. Doch was geschieht zwischen diesen beiden Ereignissen? Das klassische „Sandwich-Modell“ der Kognition beschreibt diesen Prozess folgendermaßen: Auf einen perzeptuellen Input (jemand sieht einen Unfall) folgt die computationale Manipulation interner, mentaler Repräsentationen (Kognition), woraufhin ein motorischer Output folgt (das Rufen des Notarztes).
Nach klassischer Auffassung sind die kognitiven Prozesse im Gehirn lokalisiert und werden als Aktivitäten des neuronalen Systems im Gehirn verstanden. Die Ergebnisse neuerer Forschung zeigen jedoch: kognitive Systeme sind nicht auf die neuronale Maschinerie im Gehirn beschränkt, sondern sind wesentlich von nicht-neuronalen Prozessen und Umwelteinflüssen abhängig. Demzufolge sind sie auch nicht einfach auf einer abstrakten, informationsverarbeitenden Ebene charakterisierbar, sondern werden von der konkret gegebenen Körperlichkeit und Situiertheit mitbestimmt. Wo wir also die Grenzen eines kognitiven Systems ziehen können, zwischen dem, was sich im Geist und dem, was sich außerhalb des Geistes abspielt, ist nicht so klar, wie angenommen. Auch die Frage, ob der Inhalt kognitiver Prozesse nur von internen Zuständen des kognitiven Systems, oder aber auch von externen Faktoren abhängt, ist unklar.
Im Folgenden werden wir einige Beispiele für Evidenzen betrachten, die dafür sprechen, dass kognitive Systeme nicht nur auf das Gehirn und seine neuronalen Prozesse beschränkt sind, sondern sich auch in den Körper erstrecken und sogar situiert verstanden werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Inwieweit bestimmen Körper und Umwelt die Form und den Inhalt kognitiver Prozesse?
- Verkörperte Kognition
- Kognitive Systeme und die Umwelt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist es, die These zu untersuchen, dass kognitive Prozesse nicht ausschließlich im Gehirn lokalisiert sind, sondern wesentlich von Körper und Umwelt beeinflusst werden. Der Text präsentiert empirische und philosophische Evidenzen, die diese These unterstützen.
- Verkörperte Natur kognitiver Prozesse
- Der Einfluss der Körperlichkeit auf Kategorisierung und Konzeptbildung
- Die Rolle der Umwelt in kognitiven Systemen
- Vergleich klassischer und neuerer kognitionswissenschaftlicher Ansätze
- Beispiele aus der künstlichen Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
Inwieweit bestimmen Körper und Umwelt die Form und den Inhalt kognitiver Prozesse?: Der Text beginnt mit der Fragestellung, inwieweit Körper und Umwelt kognitive Prozesse beeinflussen. Er kritisiert das klassische „Sandwich-Modell“ der Kognition, welches kognitive Prozesse als rein interne, neuronale Aktivitäten versteht. Stattdessen wird argumentiert, dass kognitive Systeme nicht auf das Gehirn beschränkt sind, sondern wesentlich von Körperlichkeit und Umwelt beeinflusst werden. Die Grenzen zwischen internen und externen Faktoren bei kognitiven Prozessen werden als unscharf dargestellt.
Verkörperte Kognition: Dieses Kapitel beleuchtet die verkörperte Natur der Kognition. Es wird argumentiert, dass Kognition nicht unabhängig von körperlichen Handlungen (Wahrnehmung, Bewegung) ist. Beispiele wie die Kategorisierung (am Beispiel von Mensch und Hund, die einen Gegenstand unterschiedlich interpretieren) und die Wahrnehmung von Farbe verdeutlichen, wie stark die Körperlichkeit die Konzepte und Kategorien beeinflusst, die wir entwickeln. Die Speicherung einer PIN-Nummer als Bewegungsmuster anstatt als arithmetische Folge wird als weiteres Beispiel für verkörperte Kognition angeführt.
Kognitive Systeme und die Umwelt: Dieses Kapitel erweitert die Argumentation auf den Einfluss der Umwelt auf kognitive Systeme. Es wird der Ansatz von Rodney A. Brooks und seinem Team beim Bau autonomer Systeme vorgestellt, die ohne zentrale Verarbeitungseinheit und interne Repräsentationen der Welt funktionieren. Der Erfolg dieses Ansatzes im Gegensatz zu anderen, gescheiterten Projekten wird als Evidenz dafür gewertet, dass kognitive Systeme sich auch in die Umwelt erstrecken können und die Situiertheit ein wichtiger Bestandteil kognitiver Prozesse ist.
Schlüsselwörter
Verkörperte Kognition, Körperlichkeit, Umwelt, Kognitive Prozesse, Kategorisierung, Konzeptbildung, Neuronale Prozesse, Künstliche Intelligenz, Autonome Systeme, Interne Repräsentationen, Situiertheit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Körper, Umwelt und Kognitive Prozesse
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text untersucht die These, dass kognitive Prozesse nicht nur im Gehirn stattfinden, sondern wesentlich von Körper und Umwelt beeinflusst werden. Er präsentiert empirische und philosophische Evidenzen für die verkörperte und situierte Natur der Kognition.
Welche konkreten Aspekte der verkörperten Kognition werden behandelt?
Der Text beleuchtet den Einfluss der Körperlichkeit auf Kategorisierung und Konzeptbildung. Beispiele wie die unterschiedliche Interpretation eines Gegenstandes durch Mensch und Hund oder die Wahrnehmung von Farbe veranschaulichen diesen Einfluss. Auch die Speicherung einer PIN-Nummer als Bewegungsmuster anstatt als Zahlenfolge wird als Beispiel für verkörperte Kognition angeführt.
Wie wird der Einfluss der Umwelt auf kognitive Prozesse dargestellt?
Der Text beschreibt den Ansatz von Rodney A. Brooks und seinem Team beim Bau autonomer Systeme, die ohne zentrale Verarbeitungseinheit und interne Repräsentationen der Welt funktionieren. Der Erfolg dieses Ansatzes wird als Evidenz dafür gewertet, dass kognitive Systeme sich in die Umwelt erstrecken und die Situiertheit ein wichtiger Bestandteil kognitiver Prozesse ist.
Welche Kritik wird an traditionellen kognitionswissenschaftlichen Modellen geübt?
Der Text kritisiert das klassische „Sandwich-Modell“ der Kognition, welches kognitive Prozesse als rein interne, neuronale Aktivitäten versteht. Es argumentiert, dass dieses Modell die entscheidende Rolle von Körper und Umwelt bei kognitiven Prozessen vernachlässigt.
Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz im Text?
Beispiele aus der Künstlichen Intelligenz, insbesondere der Ansatz von Brooks zu autonomen Systemen, werden verwendet, um die These der verkörperten und situierten Kognition zu unterstützen und zu illustrieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für den Text?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Verkörperte Kognition, Körperlichkeit, Umwelt, Kognitive Prozesse, Kategorisierung, Konzeptbildung, Neuronale Prozesse, Künstliche Intelligenz, Autonome Systeme, Interne Repräsentationen, Situiertheit.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text besteht aus den Kapiteln: "Inwieweit bestimmen Körper und Umwelt die Form und den Inhalt kognitiver Prozesse?", "Verkörperte Kognition" und "Kognitive Systeme und die Umwelt".
- Quote paper
- Nicolas Guérin (Author), 2019, Inwieweit bestimmen Körper und Umwelt die Form und den Inhalt kognitiver Prozesse?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501787