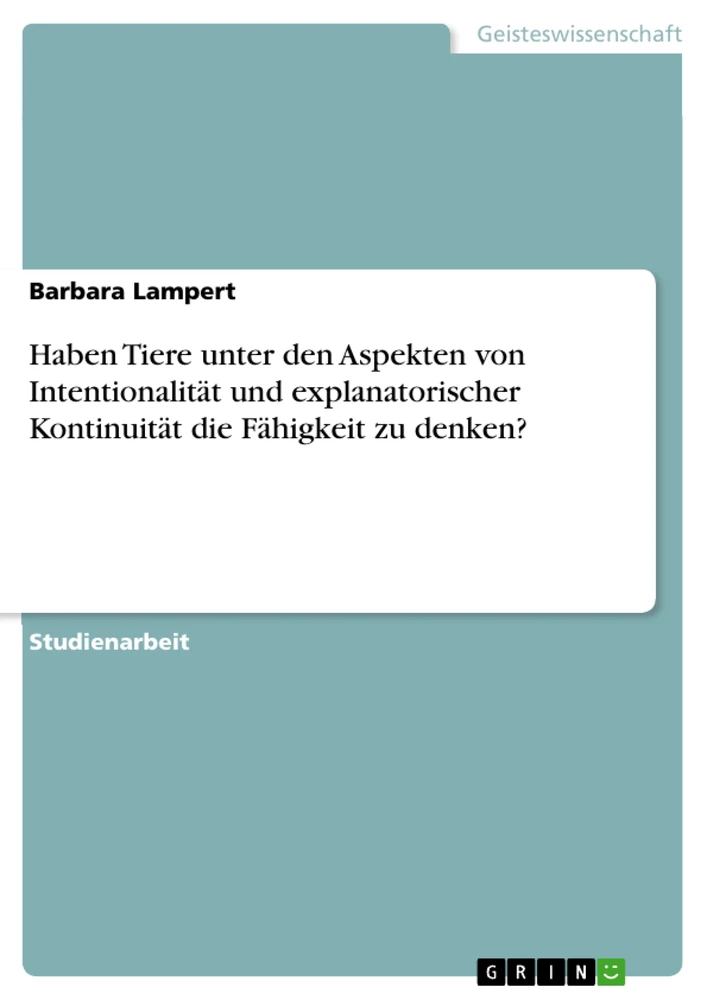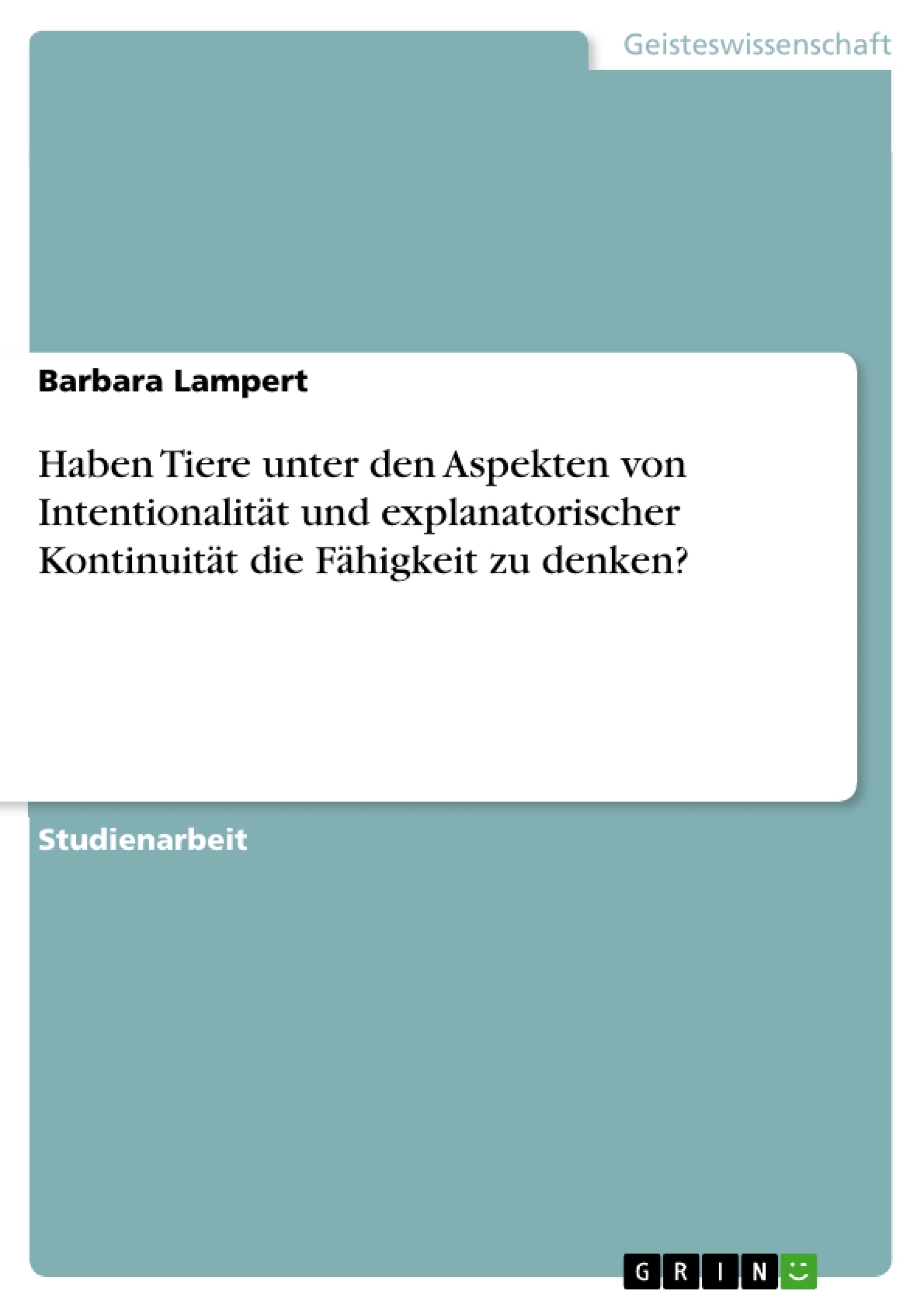Nehmen wir an, ein Hund verfolgt eine Katze, die geradewegs auf eine Buche zuläuft. Im letzten Moment springt die Katze jedoch auf einen Ahornbaum und rettet sich. Der Hund, der dies nicht gesehen hat, läuft zur Buche, bleibt unter ihr stehen und bellt.
Warum tut er das? Anscheinend denkt der Hund, die Katze befände sich auf der Buche, unter welcher er auf sie wartet. Kann und darf man dem Hund an dieser Stelle so etwas wie Gedanken zuschreiben? Und wie sieht es mit Krähen aus, die Nüsse immer wieder auf einer befahrbaren, asphaltierten Straße richtig platzieren, bis ein Auto über die robuste Nuss fährt und sie aufknacken lässt. Was denken diese Krähen dabei, wenn sie das tun? Oder denken sie überhaupt etwas? Dass der Mensch ein denkendes Wesen ist, zeigt sich ganz deutlich darin, dass er über eine Sprache verfügt, womit er seine Gedanken anderen Individuen mitteilen kann. So formulierte der Sprachwissenschaftler Wilhelm von Humboldt: Sprache sei „das bildende Organ der Gedanken“. Sprache war für ihn die Grundbedingung eines jeden Gedankens, ohne eine Sprache, wäre denken unmöglich. Denn wir sprechen nicht nur in einer Sprache, wir denken auch in einer Sprache.
Tiere hingegen sind ganz offensichtlich nicht in der Lage, selbstständig mit Worten zu sprechen und sich auf diese Weise mit ihren Artgenossen zu verständigen. Aber darf man einfach so die Annahme stellen, dass Tiere nicht denken können, nur weil sie kein Kommunikationssystem haben, das sich unserem ähnelt?
Andererseits, kann man Tieren Gedanken zuschreiben, weil sich ihr Verhalten in gewissen Situationen dem der Menschen ähnelt und wir zweifellos, bezogen auf das obere Beispiel, einfach sagen: Der Hund denkt, dass X. Ist das nicht vielleicht lediglich eine Form von Anthropomorphismus und hat nichts mit dem Denken an sich zu tun, wie wir es unter philosophischen Gesichtspunkten definieren. Um all diesen Fragen näher zu kommen, bedarf es zunächst einmal einer Erklärung über den Begriff des Denkens selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine philosophische Definition von Denken
- Intentionalität
- Definition des Begriffs Intentionalität
- Intentionalität bei Tieren
- Krähen verwenden Metatools
- Metakognition bei Rhesusaffen und Delfinen
- Erfassen Tiere andere als intentionale Wesen?
- Schimpansen können wissende von unwissenden Personen unterscheiden
- Täuschung von Artgenossen
- Auswertung über die These, ob Tiere andere als intentionale Wesen verstehen
- Teleosemantik
- Funktionen von Repräsentationen
- Intentionalität als eine biologische Eigenschaft
- Explanatorische Kontinuität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der philosophischen Frage, ob und inwiefern man Tieren Gedanken zuschreiben kann. Sie untersucht die philosophische Definition von Denken und analysiert den Begriff der Intentionalität im Kontext des tierischen Verhaltens. Dabei werden verschiedene Studien und Beispiele aus der Tierwelt herangezogen, um zu beleuchten, ob Tiere über mentale Zustände verfügen, die denen des Menschen ähneln.
- Philosophische Definition von Denken
- Der Begriff der Intentionalität
- Intentionalität bei Tieren
- Tierliches Verhalten als Ausdruck von Gedanken
- Die Grenzen der Zuschreibung von Intentionalität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Frage, ob Tieren Gedanken zugeschrieben werden können. Sie verdeutlicht anhand von Beispielen wie dem Verhalten von Hunden und Krähen, wie komplex die Frage nach dem Denken bei Tieren ist.
- Eine philosophische Definition von Denken: Dieses Kapitel erläutert den Begriff "Denken" aus philosophischer Perspektive und differenziert zwischen dem alltagspsychologischen und dem philosophischen Verständnis. Es wird betont, dass "Denken" als geistiges Phänomen verstanden werden sollte, das sich mit Vorstellungen, Begriffen und anderen mentalen Inhalten befasst.
- Intentionalität: Dieses Kapitel widmet sich dem zentralen Begriff der Intentionalität. Es definiert Intentionalität als die Fähigkeit eines mentalen Zustands, einen bestimmten Inhalt zu haben oder auf ein Ziel gerichtet zu sein. Die unterschiedlichen Aspekte von Intentionalität werden beleuchtet, einschließlich der Möglichkeit, mentale Inhalte in verschiedenen Modalitäten zu repräsentieren.
- Intentionalität bei Tieren: Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob Tiere über Intentionalität verfügen. Es stellt heraus, dass ein Wesen, dem man Intentionalität zuschreiben möchte, in der Lage sein muss, seine eigenen Zustände von denen der Umwelt zu unterscheiden und Repräsentationen der Außenwelt zu bilden.
- Erfassen Tiere andere als intentionale Wesen?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob Tiere in der Lage sind, die mentalen Zustände anderer Lebewesen als solche zu erkennen. Anhand von Beispielen wie dem Verhalten von Schimpansen wird untersucht, ob Tiere den Unterschied zwischen wissenden und unwissenden Personen erkennen können.
- Teleosemantik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Teleosemantik, einer Theorie, die Intentionalität als eine biologische Eigenschaft betrachtet. Sie untersucht die Funktionen von Repräsentationen und die Rolle von Intentionalität im evolutionären Kontext.
Schlüsselwörter
Denken, Intentionalität, Tierverhalten, Mentale Repräsentationen, Tierkognition, Anthropomorphismus, Teleosemantik, Evolution, Bewusstsein, Philosophie, Ethik.
Häufig gestellte Fragen
Können Tiere denken, obwohl sie keine Sprache haben?
Die Arbeit untersucht, ob Denken zwingend an Sprache gebunden ist oder ob Tiere durch intentionales Verhalten (z.B. Werkzeuggebrauch) eine Form von Gedanken zeigen.
Was bedeutet „Intentionalität“ im Zusammenhang mit Tieren?
Intentionalität ist die Fähigkeit eines mentalen Zustands, auf ein Ziel gerichtet zu sein. Bei Tieren zeigt sich dies etwa, wenn Krähen Metatools verwenden, um an Nahrung zu gelangen.
Können Tiere die Absichten anderer Lebewesen verstehen?
Studien an Schimpansen deuten darauf hin, dass sie zwischen wissenden und unwissenden Personen unterscheiden können, was auf ein Verständnis intentionaler Zustände anderer hindeutet.
Was ist Anthropomorphismus?
Es beschreibt die fehlerhafte Zuschreibung menschlicher Eigenschaften und Denkweisen auf Tiere. Die Arbeit warnt davor, tierisches Verhalten vorschnell mit menschlichen Begriffen zu erklären.
Was besagt die Teleosemantik?
Diese Theorie betrachtet Intentionalität als biologische Eigenschaft, die sich evolutionär entwickelt hat, um bestimmte Überlebensfunktionen durch mentale Repräsentationen zu erfüllen.
- Arbeit zitieren
- B.Ed. Barbara Lampert (Autor:in), 2012, Haben Tiere unter den Aspekten von Intentionalität und explanatorischer Kontinuität die Fähigkeit zu denken?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501993