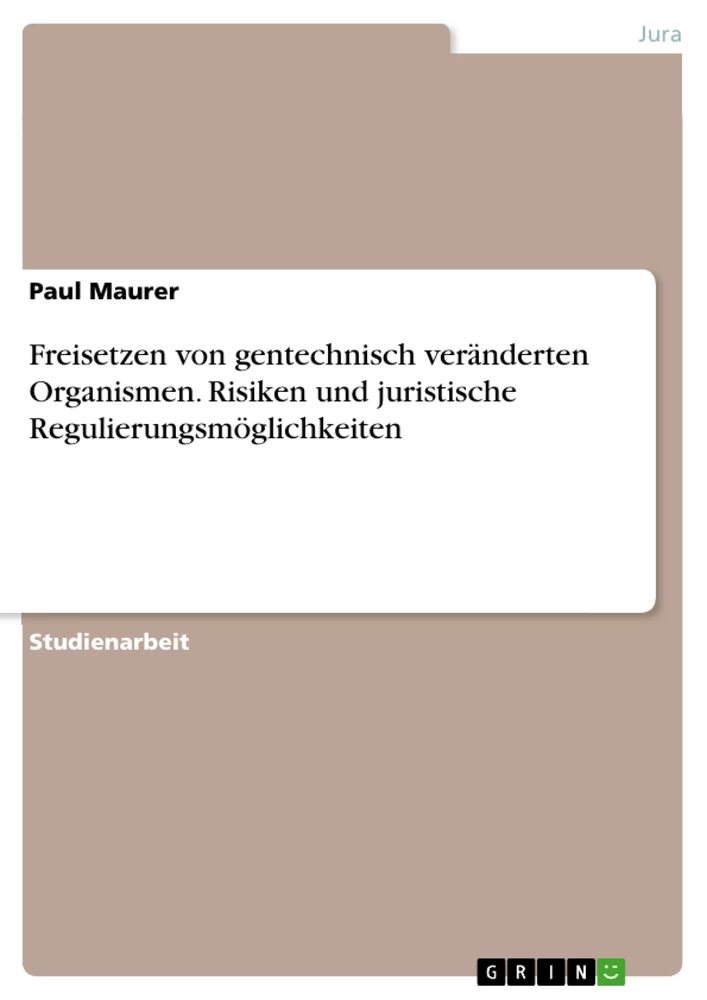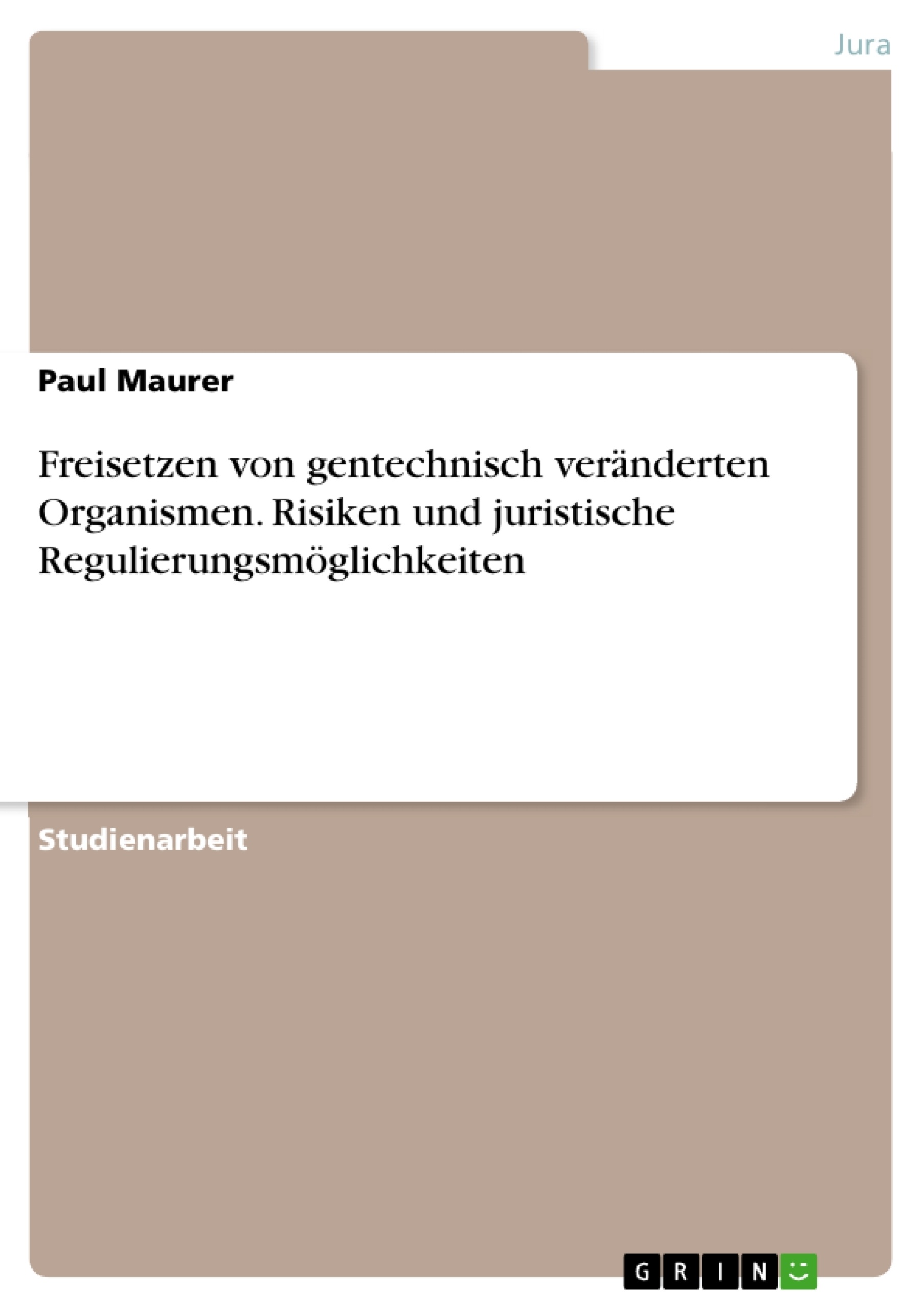Diese Arbeit setzt sich mit der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) aus juristischer Perspektive auseinander. Risiken und rechtlichen Möglichkeiten zur Regulierung sollen vorgestellt werden. Keine Beachtung finden in dieser Arbeit die Haftungsregeln im Falle eines Schadens durch GVO. Auf eine kurze Klärung der verwendeten Begriffe folgt eine Übersicht über die Anwendungsbereiche von GVO und mögliche Risiken, wobei spekulative, bisher nicht belegbare Risiken, keine Erwähnung finden. Im Anschluss wird Überblick über die herrschende Rechtslage in Deutschland gegeben, gefolgt von Ausführungen zur Regulierung durch Vorsorge.
In keiner Epoche der Menschheit wurde so viel geforscht wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, aber gleichzeitig war die Skepsis der Bevölkerung gegenüber dem Fortschritt niemals so groß. Seit Mitte der 70er Jahre ist mit der Gentechnik im Bereich der Biotechnologie ein Forschungsbereich entstanden, der wie kaum ein anderer für intensive und gefühlsgeladene Debatten sorgt. Dieser Diskussionsbedarf ist wohl zum einen der Komplexität des Themas geschuldet, zum anderen aber auch der Tatsache, dass für viele die Gentechnik einen Eingriff in den "Intimbereich der Schöpfung" darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gentechnisch veränderte Organismen
- Anwendungsbereiche von GVO
- Risiken durch GVO
- Gesundheitliche Risiken
- Ökologische Risiken
- Wirtschaftliche Risiken
- Rechtslage
- Regulierung der Risiken durch Vorsorge
- Risikobewertung
- Anhörungsverfahren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Freisetzen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und analysiert die damit verbundenen Risiken sowie die bestehenden rechtlichen Regulierungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Risiken von GVO für Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft und der Analyse der deutschen Rechtslage im Hinblick auf die Vorsorge und Regulierung dieser Risiken.
- Definition und Abgrenzung von GVO im Rahmen des Gentechnikgesetzes (GenTG)
- Anwendungsbereiche von GVO in der Agrarindustrie und anderen Bereichen
- Bewertung der potenziellen Risiken von GVO für Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft
- Analyse der Rechtslage in Deutschland zur Regulierung von GVO, insbesondere der Vorsorgeprinzipien
- Evaluierung der Möglichkeiten zur Risikoregulierung durch Vorsorge und Anhörungsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und erläutert den aktuellen Diskussionsbedarf im Bereich der Gentechnik. Es werden die verschiedenen Bereiche des Gentechnikrechts definiert und der Schwerpunkt der Arbeit auf die Freisetzung von GVO gelegt. Die Kapitel zwei und drei liefern eine Definition der verwendeten Begriffe und einen Überblick über die Anwendungsbereiche sowie die potentiellen Risiken von GVO, wobei spekulative Risiken ausgenommen werden. Kapitel drei behandelt die Rechtslage in Deutschland. Kapitel vier analysiert die Möglichkeiten zur Risikoregulierung durch Vorsorge, insbesondere die Risikobewertung und die Anhörungsverfahren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Gentechnik, Gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Risikoregulierung, Vorsorge, Rechtslage, Anhörungsverfahren, Risikobewertung, GenTG, Freisetzung, Umweltverträglichkeitsprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Risiken gehen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) aus?
Diskutiert werden gesundheitliche Risiken (z. B. Allergien), ökologische Risiken (z. B. Auskreuzung in die Natur) und wirtschaftliche Risiken für die konventionelle Landwirtschaft.
Was regelt das Gentechnikgesetz (GenTG) in Deutschland?
Das GenTG regelt die Errichtung und den Betrieb gentechnischer Anlagen sowie die Freisetzung von GVO, um Mensch und Umwelt zu schützen.
Was bedeutet das Vorsorgeprinzip im Gentechnikrecht?
Es besagt, dass bereits bei Verdacht auf mögliche Gefahren Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, auch wenn wissenschaftliche Beweise noch nicht vollständig vorliegen.
Wie läuft ein Anhörungsverfahren für GVO ab?
Vor einer Genehmigung zur Freisetzung müssen die Öffentlichkeit und Experten angehört werden, um Einwände und Sicherheitsaspekte zu prüfen.
Warum ist die Skepsis gegenüber GVO so groß?
Viele Menschen empfinden die Gentechnik als Eingriff in die Schöpfung und fürchten unvorhersehbare Langzeitfolgen für das Ökosystem.
- Quote paper
- Paul Maurer (Author), 2016, Freisetzen von gentechnisch veränderten Organismen. Risiken und juristische Regulierungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502248