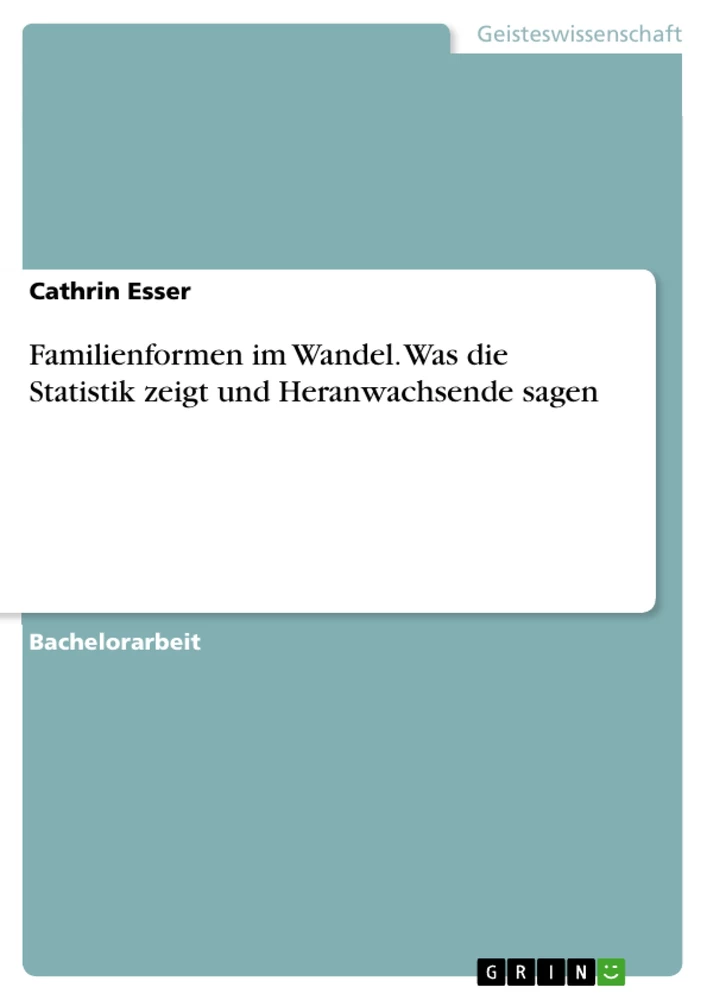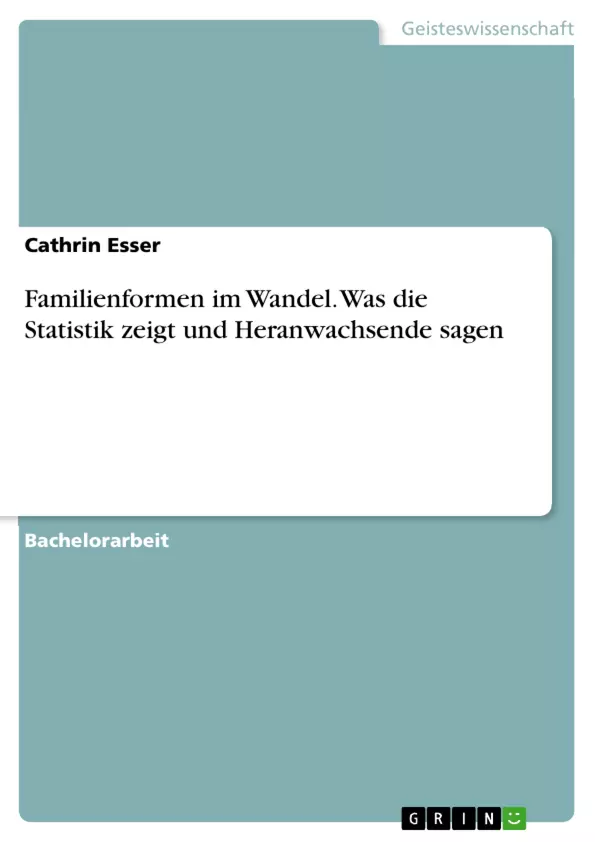Es ist statistisch belegt, dass in Deutschland die Zahl der Ehescheidungen erheblich abgenommen hat, hingegen die Scheidungsraten zunehmen und Frauen in ihrem Leben durchschnittlich weniger Kinder gebären. Doch sind diese Fakten Begründung genug, um von einem Wandel der Familienformen zu sprechen? Um diesen Sachverhalt zu klären, ist es notwendig, heutige Familienformen im Verhältnis zur Vergangenheit darzustellen und abhängige Variablen, die zum Familienbildungsprozess beitragen, zu analysieren. Das vorherrschende Familienmodell der 50er Jahre war die Normalfamilie, hier lebten verheiratete, getrenntgeschlechtliche Eltern mit mindestens einem Kind in einer Haushaltsgemeinschaft, mit einer klar definierten Rollenverteilung.
Was sagt die Statistik heute? Ergänzend dazu werden einige Heranwachsende befragt und ihr Bild von Familie, Ehe und Familie hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Familienbegriff
- Unterschiedliche Familienformen, ihre Definition und Entwicklung
- Kinderlose Lebensweise
- Alleinlebende und Alleinstehende
- Nichteheliche Partnerschaft/Lebensgemeinschaft
- Ehepartnerschaft
- Zwei-Eltern Familie
- Kernfamilie
- Mehrgenerationenfamilie
- Pflege-/ Adoptivfamilie
- Regenbogenfamilie
- Stieffamilie
- Ein-Eltern Familie / Alleinerziehende
- Befragung Heranwachsender und relevante statistische Werte
- Ergebnisse der Befragung
- Ländliche Hauptschule
- Städtische Hauptschule
- Städtische Realschule
- Statistische Werte in Deutschland
- Geburtenentwicklung
- Anzahl der Eheschließungen
- Ehescheidungen
- Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen der aktuellen Statistik und Befragungsergebnissen bei Achtklässlern und Achtklässlerinnen
- Ergebnisse der Befragung
- Erklärungsansätze ausgewählter Ergebnisse der Statistik und Befragung Heranwachsender
- Deinstitutionalisierung
- Individualisierung und Entstandardisierung von Lebensläufen
- Wertewandel und Emotionalisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Wandel von Familienformen in Deutschland im Kontext von demografischen Veränderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie untersucht, wie sich die statistischen Daten zur Familienbildung mit den Erwartungen und Perspektiven von Heranwachsenden übereinstimmen.
- Analyse der Veränderungen von Familienformen in Deutschland
- Bedeutung der Ehe und Kinder in der heutigen Gesellschaft
- Vergleich von statistischen Daten und Befragungsergebnissen von Heranwachsenden
- Einflussfaktoren auf die Familienbildung
- Bedeutung von Individualisierung und Wertewandel im Kontext von Familienformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Familienformen im Wandel" ein und stellt die Relevanz der Forschungsfrage heraus. Kapitel zwei definiert den Familienbegriff und erläutert seine Bedeutung im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. In Kapitel drei werden verschiedene Familienformen detailliert vorgestellt und in ihren historischen Kontext eingebettet. Die Ergebnisse einer Befragung von Heranwachsenden werden in Kapitel vier präsentiert, die verschiedene Aspekte der Familienbildung beleuchtet. Kapitel fünf diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für die Veränderungen von Familienformen, die sich aus den statistischen Daten und den Befragungsergebnissen ergeben.
Schlüsselwörter
Familienformen, Familienbildung, Wandel, Demografie, Statistik, Befragung, Heranwachsende, Ehe, Kinder, Individualisierung, Wertewandel, Deinstitutionalisierung, Lebensgemeinschaften, Mehrgenerationenfamilie, Ein-Eltern-Familie.
- Citar trabajo
- Cathrin Esser (Autor), 2017, Familienformen im Wandel. Was die Statistik zeigt und Heranwachsende sagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502250