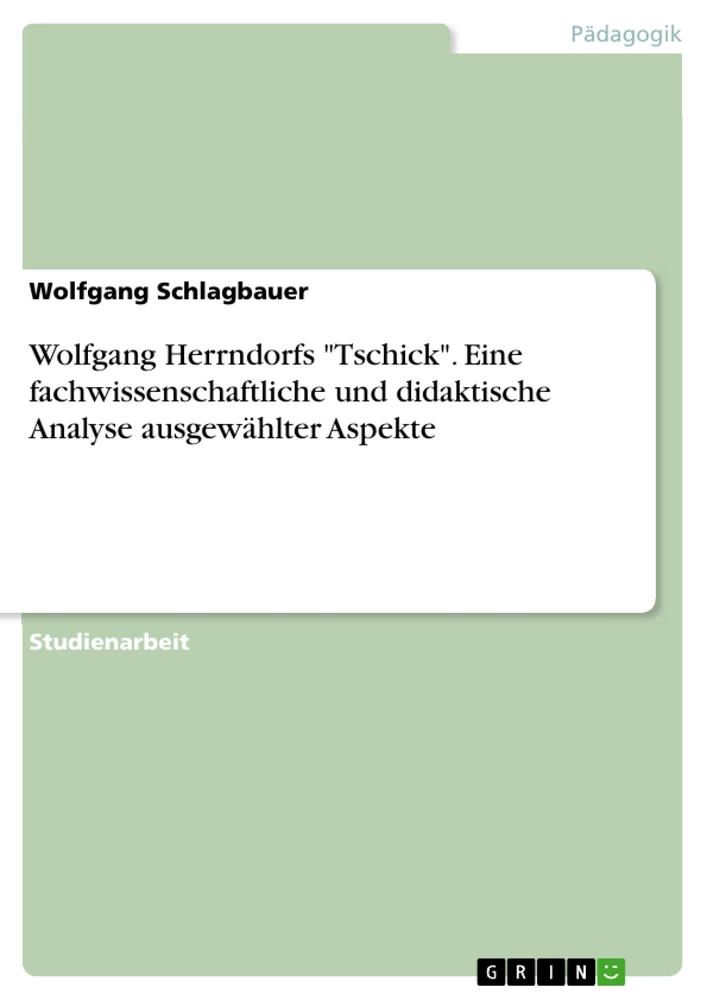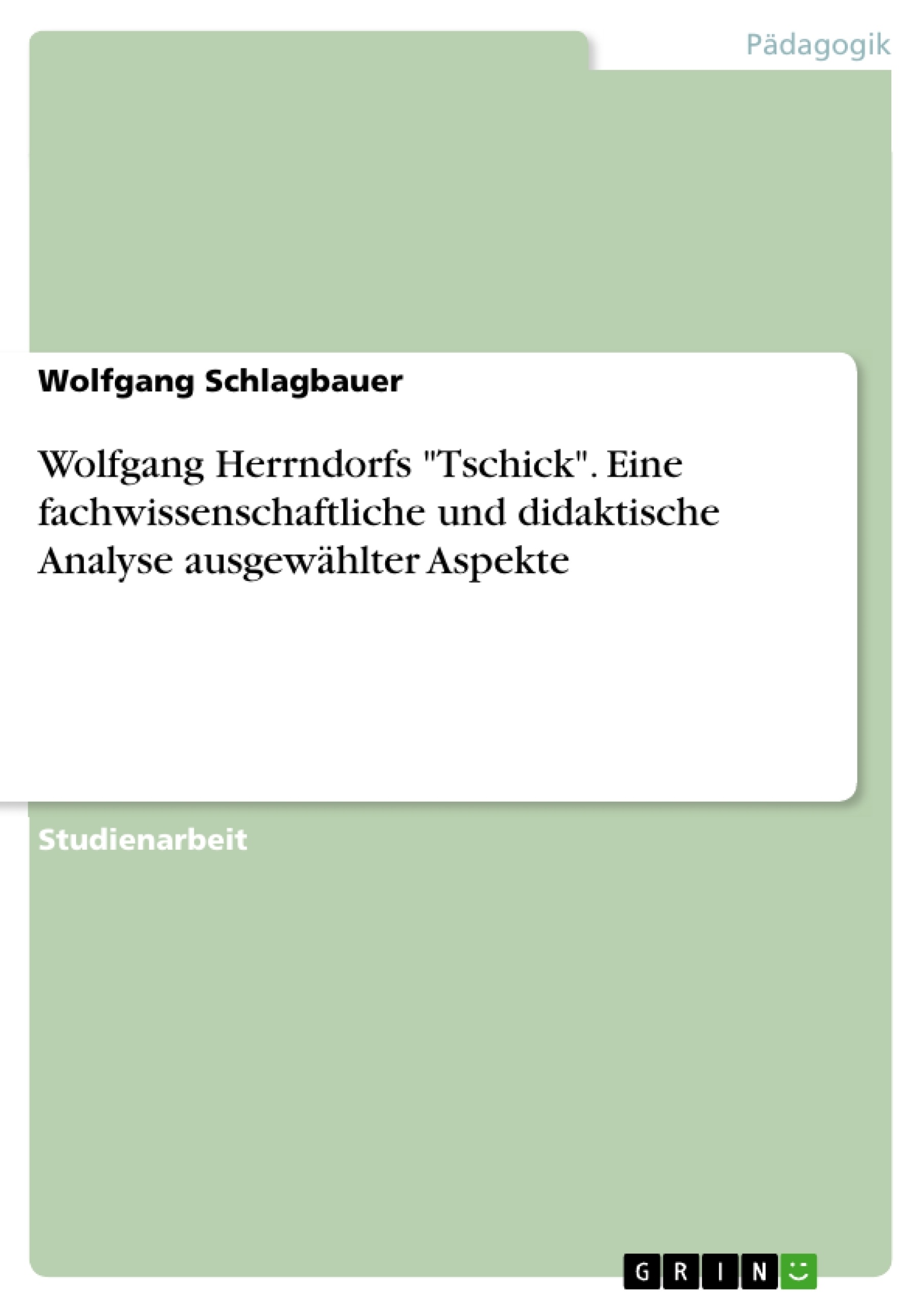Das Thema dieser Arbeit ist Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick". Während sich der erste Abschnitt der literaturwissenschaftlichen Analyse ausgewählter Aspekte des Romans widmet, werden in einem zweiten Teil diese Aspekte didaktisch aufbereitet. Die Arbeit greift zunächst die wichtigsten Aspekte des Romans heraus, die Sprache, Erzählperspektive und Erzählkonstruktion, die Freundschaft, die Reise und Maiks Emanzipation von seiner Familie. Die Arbeit bezieht sich dabei sowohl auf verschiedene Rezensionen als auch auf Dr. Marja Rauchs Monographie "Jugendliteratur der Gegenwart. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge".
Wolfgang Herrndorf hat mit "Tschick" einen modernen Klassiker geschaffen, einen Roman, der einschlug wie eine Bombe. Ursprünglich für ein erwachsenes Publikum vorgesehen, wurde er kurze Zeit später auch von jugendlichen Lesern für sich entdeckt. Allein die Tatsache, dass Tschick sowohl für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde, als auch den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat, verdeutlicht seinen Status als Grenzgänger zwischen Erwachsenen- und Jugendliteratur. Und auch die Einordnung in ein Genre fällt nicht leicht. Einerseits handelt es sich bei Tschick um einen Adoleszenzroman, begeben sich doch die beiden Protagonisten Maik Klingenberg und Andrej Tschichatschow auf eine Reise voller Abenteuer, sie begeben sich gewissermaßen auf die Suche nach ihrer eigenen Identität.
Die Adoleszenz bezeichnet die Zeit zwischen dem 11./12. und dem 25. Lebensjahr, dementsprechend das Erwachsenwerden im Zentrum des Romans steht. Häufige Motive sind dabei die Suche nach der eigenen Identität, die geschlechtliche Entwicklung und die Emanzipation vom Elternhaus, die mit einer Zunahme der Unabhängigkeit einhergeht. Dabei muss er jedoch vom Erziehungs-, Bildungs-, Entwicklungs- und Schulroman, in erster Linie für den erwachsenen Leser verfasst, abgegrenzt werden. Parallelen bestehen indes zum problemorientierten Jugendroman, beschränken sich doch beide auf die Zeitspanne des Erwachsenwerdens. Im Gegensatz zum Adoleszenzroman liegt beim problemorientierten Jugendroman jedoch der Fokus auf gesellschaftlichen Problematiken, die Helden besitzen keinen großartig ausgearbeiteten Charakter, während er bei ersterem auf den Problemen der Reifezeit selbst liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturwissenschaftliche Untersuchung
- Sprachstil, Erzählperspektive und Erzählkonstruktion
- Maik, Tschick und die Entwicklung einer Freundschaft
- Die Reise
- Emanzipation von der Familie
- Didaktische Begründung der Textauswahl
- Didaktische Konzeption
- Sprache, Erzählperspektive und Erzählkonstruktion
- Die Freundschaft
- Die Reise
- Emanzipation von der Familie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ aus literaturwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive. Ziel ist es, wichtige Aspekte des Romans herauszuarbeiten und deren didaktische Relevanz für den Unterricht aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Kapitel des Romans.
- Sprachstil und Erzähltechnik in "Tschick"
- Entwicklung der Freundschaft zwischen Maik und Tschick
- Die Bedeutung der Reise als Metapher für die Selbstfindung
- Thematik der Emanzipation von der Familie
- Der Roman als Adoleszenzroman und seine genreübergreifenden Elemente
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf vor und hebt dessen Popularität und seine genreübergreifenden Aspekte hervor. Es wird auf die Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse und den Gewinn des Deutschen Jugendliteraturpreises eingegangen, was den Status des Romans als Grenzgänger zwischen Erwachsenen- und Jugendliteratur unterstreicht. Die Einleitung diskutiert die Einordnung des Romans in verschiedene Genres wie Adoleszenzroman, Abenteuerroman und problemorientierten Roman und beschreibt die zentralen Themen des Erwachsenwerdens, der Identitätsfindung und der Emanzipation von der Familie. Die Arbeit selbst wird in zwei Teile gegliedert: einen literaturwissenschaftlichen und einen didaktischen.
Literaturwissenschaftliche Untersuchung: Sprachstil, Erzählperspektive und Erzählkonstruktion: Dieser Abschnitt analysiert den Sprachstil, die Erzählperspektive und die Erzählkonstruktion des Romans. Herrndorfs Entscheidung, weitgehend auf generationsspezifische Ausdrücke zu verzichten, wird diskutiert, ebenso wie die gezielte Verwendung von Jugendsprache und Fremdwörtern, um die altersgemäße Atmosphäre zu erzeugen. Die Analyse beleuchtet die Syntax, die Verwendung kurzer Sätze und Hauptsätze mit „weil“, um einen authentischen Eindruck zu vermitteln. Die Rolle skurriler Vergleiche und die „political incorrectness“ werden ebenfalls untersucht, ebenso wie die Bedeutung der Dialoge zwischen Maik und Tschick für die Situationskomik und den Sprachwitz des Romans. Der Abschnitt beleuchtet, wie Herrndorf mit Humor und Ironie auch ernste Themen wie den Alkoholismus von Maiks Mutter behandelt. Die Ich-Perspektive des Erzählers Maik Klingenberg und seine Rolle als Antiheld werden ebenfalls analysiert.
Literaturwissenschaftliche Untersuchung: Maik, Tschick und die Entwicklung einer Freundschaft: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Charaktere Maik und Tschick und die Entwicklung ihrer Freundschaft. Maik wird als Außenseiter und Antiheld dargestellt, der seine Talente zunächst nicht erkennt. Tschick wird als russischer Spätaussiedler beschrieben, der sich durch sein Erscheinungsbild und Verhalten von seinen Mitschülern abhebt. Der Abschnitt analysiert den Kontrast zwischen den beiden Charakteren und die allmähliche Entwicklung ihrer Freundschaft im Laufe der gemeinsamen Reise. Es wird betont, wie die Reise als Metapher für die Suche nach der eigenen Identität dient und wie sich die Charaktere im Verlauf der Geschichte weiterentwickeln und reifen.
Schlüsselwörter
Tschick, Wolfgang Herrndorf, Adoleszenzroman, Abenteuerroman, Identitätsfindung, Freundschaft, Emanzipation, Familie, Sprachstil, Erzählperspektive, Jugendsprache, Humor, Ironie, Antiheld.
Häufig gestellte Fragen zu "Tschick" - Literaturwissenschaftliche und Didaktische Analyse
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse von Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick". Sie umfasst eine literaturwissenschaftliche Untersuchung des Sprachstils, der Erzählperspektive, der Charakterentwicklung (Maik und Tschick) und der zentralen Themen wie Freundschaft, Emanzipation und Selbstfindung. Zusätzlich beinhaltet sie eine didaktische Betrachtung des Romans und seiner Eignung für den Unterricht, einschließlich didaktischer Konzeptionen und methodischer Ansätze.
Welche Themen werden im Roman "Tschick" behandelt?
Der Roman behandelt zentrale Themen der Adoleszenz wie Identitätsfindung, Freundschaft, Emanzipation von der Familie, die Suche nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Die Reise, die Maik und Tschick gemeinsam unternehmen, dient als Metapher für diesen Prozess der Selbstfindung.
Wie ist der Roman "Tschick" literaturwissenschaftlich aufgebaut?
Die literaturwissenschaftliche Analyse konzentriert sich auf den Sprachstil (Verwendung von Jugendsprache, kurze Sätze, skurrile Vergleiche), die Erzählperspektive (Ich-Perspektive Maiks) und die Erzählkonstruktion. Der Fokus liegt auf der Charakterisierung von Maik und Tschick, der Entwicklung ihrer Freundschaft und der Bedeutung der Reise als symbolische Handlung.
Welche didaktischen Aspekte werden behandelt?
Der didaktische Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Eignung des Romans für den Unterricht. Er umfasst eine didaktische Konzeption, die Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung und die methodische Umsetzung der literaturwissenschaftlichen Erkenntnisse im Unterricht. Es werden didaktische Ansätze zur Behandlung von Sprache, Erzählperspektive, Freundschaft, Reise und Emanzipation präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Roman und die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Tschick, Wolfgang Herrndorf, Adoleszenzroman, Abenteuerroman, Identitätsfindung, Freundschaft, Emanzipation, Familie, Sprachstil, Erzählperspektive, Jugendsprache, Humor, Ironie, Antiheld.
Welche Kapitel werden in der Zusammenfassung behandelt?
Die Zusammenfassung umfasst die Einleitung, die literaturwissenschaftliche Untersuchung (Sprachstil, Erzählperspektive, Maik und Tschick, die Reise), und ein Fazit. Die literaturwissenschaftliche Untersuchung fokussiert sich auf die Analyse des Sprachstils, der Erzählperspektive und der Charakterentwicklung der Hauptfiguren im Kontext der Themen des Romans.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, wichtige Aspekte von Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick" herauszuarbeiten und deren didaktische Relevanz für den Unterricht aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Kapitel des Romans, um literarische und didaktische Aspekte detailliert zu untersuchen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser*innen, die sich für den Roman "Tschick" und dessen literarische und didaktische Aspekte interessieren. Sie ist besonders relevant für Lehrende und Studierende der Germanistik und Didaktik.
- Arbeit zitieren
- Wolfgang Schlagbauer (Autor:in), 2014, Wolfgang Herrndorfs "Tschick". Eine fachwissenschaftliche und didaktische Analyse ausgewählter Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502272