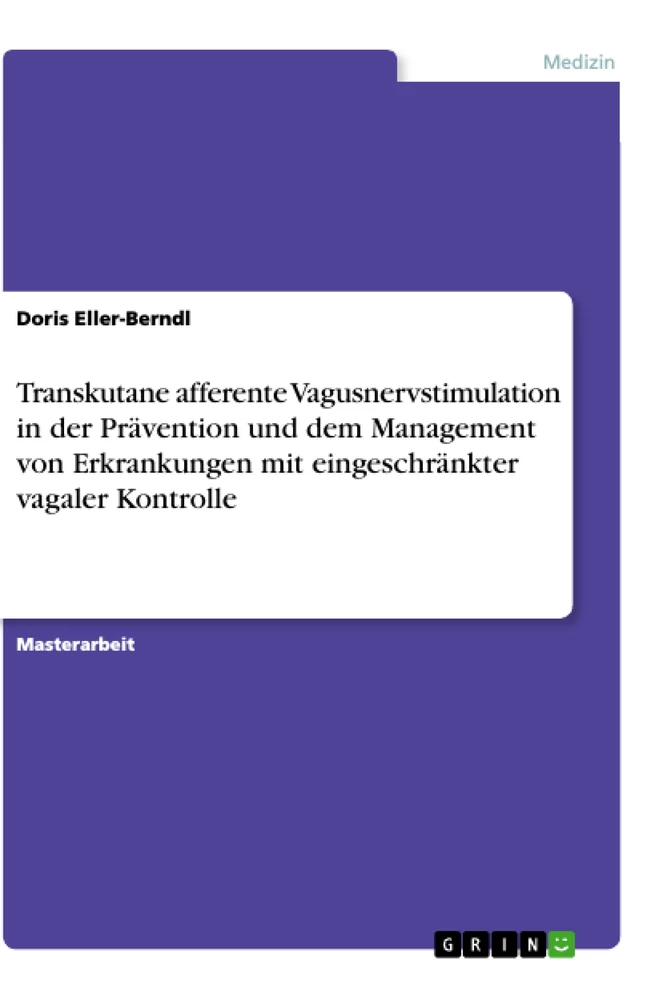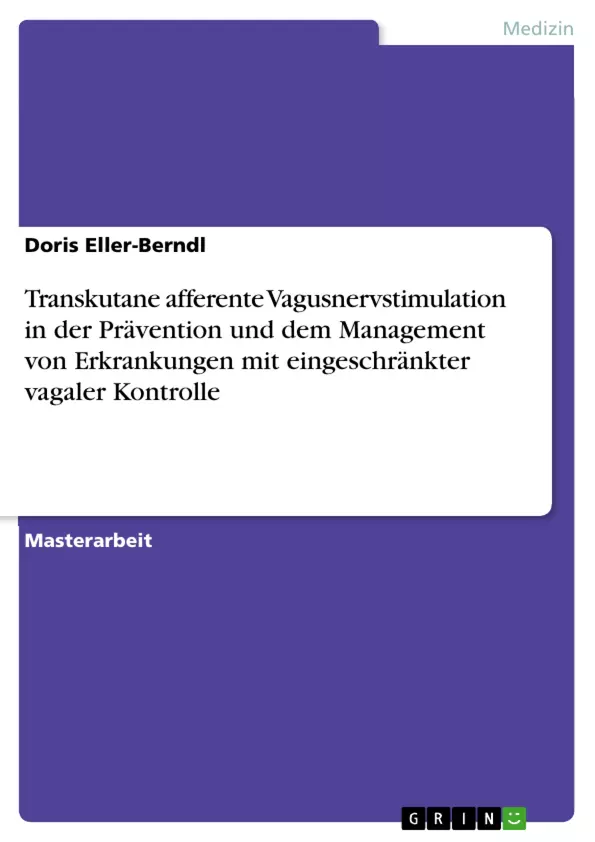Diese Arbeit beschäftigt sich mit den physiologischen Hintergründen, dem Vergleich verschiedener Stimulationsformen und dem Stand der Forschung zum Thema Vagusnervstimulation. Nach dem theoretischen Teil werden vier ausführliche Fallbeispiele von PatientInnen dargestellt, die mit transcutaner aurikulärer Vagusnervstimulation behandelt wurden. Die transkutane afferente Vagusnervstimulation, die sich bis jetzt als sichere Therapieform erwiesen hat, ist in der Sekundär- und Tertiärprävention möglicherweise eine Überbrückungstherapie bei aktuell erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko und/oder Inflammation mit erhöhten TNF-alpha-Spiegeln, wenn die Standardtherapie nicht möglich ist oder kein Ansprechen erfolgt.
Der Vagusnerv spielt eine zentrale Rolle in der bidirektionalen Kommunikation der Peripherie des Körpers mit dem Gehirn. Eine eingeschränkte vagale Kontrolle, wie sie im Ruhezustand der Herzratenvariabilität messbar wird, ist mit vermehrter Entzündungstendenz und erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko verbunden. In erster Linie bedeutet dies eine verschlechterte emotionale Kontrolle und Gedächtnisleistung. Invasive Formen der Vagusnervstimulation (iVNS) werden daher bereits seit Jahren bei Epilepsie und Depression eingesetzt. Für die Präventivmedizin sind demgegenüber vor allem nichtinvasive transkutane Stimulationen (nVNS) interessant, da diese rein afferent wirken, wodurch signifikante Nebenwirkungen ausbleiben. Bei dieser Einsatzform zeigten sich überdies ebenso wie bei der invasiven Stimulation antientzündliche und die Plastizität des Gehirns günstig beeinflussende Wirkungen. Da eine eingeschränkte vagale Kontrolle und ein erhöhtes Entzündungsniveau Merkmale vieler chronischer Erkrankungen darstellen, ist die transkutane Vagusnervstimulation theoretisch eine interessante Therapieoption.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Funktionelle Anatomie des Nervus vagus
- 2.2 Das autonome Nervensystem
- 2.2.1 Der Vagusnerv
- 2.2.2 Die Vagusfunktion auf molekularer Ebene
- 2.2.3 Umweltsignale und Vagusfunktion
- 2.2.3.1 Licht-digitale Signale des Tag-Nacht-Rhythmus
- 2.2.3.2 Nahrung - analoge Signale der Umwelt
- 2.2.3.3 Natürliche Stimulation von Vagusafferenzen
- 2.2.4 Entzündungshemmung durch vagale Kontrolle
- 2.2.4.1 Entzündungsätiologie
- 2.2.4.2 Systemische Entzündungen
- 2.2.4.3 Regulation der Entzündungsreaktion
- 2.3 Herzratenvariabilität (HRV)
- 2.3.1 Vagusfunktion und Herz-Gehirn-Achse
- 2.3.2 Die dynamische Ordnung der Herzratenvariabilität
- 2.3.2.1 Zeitbereich (Time Domain)
- 2.3.2.2 Frequenzbereich (Frequency Domain)
- 2.3.3 Autonome Regulation und Selbst-Regulation
- 2.3.4 Herzratenvariabilität und Vagusnervstimulation
- 3. Vagusnervstimulation
- 3.1 Historisches
- 3.2 Methoden und Geräte
- 3.2.1 Invasive Vagusnervstimulation (iVNS)
- 3.2.1.1 Linkszervikale iVNS
- 3.2.1.2 Rechtszervikale iVNS
- 3.2.1.3 Besonderheiten der Stimulation am zervikalen Vagusnerv
- 3.2.1.4 Stimulationsparameter
- 3.2.1.5 Nebenwirkungen
- 3.2.1.6 Kontraindikationen
- 3.2.2 Nichtinvasive Vagusnervstimulation
- 3.2.1 Invasive Vagusnervstimulation (iVNS)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die transkutane afferente Vagusnervstimulation (tVNS) als präventive und therapeutische Maßnahme bei Erkrankungen mit eingeschränkter vagaler Kontrolle. Ziel ist es, die physiologischen Grundlagen der tVNS zu beleuchten, verschiedene Stimulationsformen zu vergleichen und den aktuellen Forschungsstand darzustellen. Die Arbeit beinhaltet außerdem die Darstellung von Fallbeispielen.
- Physiologische Grundlagen der Vagusnervfunktion
- Vergleich invasive vs. nicht-invasive Vagusnervstimulation
- Transkutane Vagusnervstimulation in der Prävention
- Zusammenhang zwischen vagaler Kontrolle, Entzündung und chronischen Erkrankungen
- Auswertung von Fallbeispielen der tVNS-Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der transkutanen afferenten Vagusnervstimulation (tVNS) ein und beschreibt die Bedeutung des Vagusnervs in der bidirektionalen Kommunikation zwischen Peripherie und Gehirn. Es wird der Zusammenhang zwischen eingeschränkter vagaler Kontrolle, Entzündung und kardiovaskulärem Risiko hervorgehoben, sowie das Potential der tVNS als nicht-invasive Therapieoption erläutert. Die Arbeit wird in diesem Abschnitt strukturiert und die Forschungsfrage formuliert.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die funktionelle Anatomie des Vagusnervs, das autonome Nervensystem und die molekularen Mechanismen der Vagusfunktion. Es beleuchtet den Einfluss von Umweltsignalen (Licht, Nahrung) auf die Vagusaktivität und die Rolle der vagalen Kontrolle in der Entzündungsregulation. Die Herzratenvariabilität (HRV) als Messparameter der vagalen Kontrolle und deren Bedeutung für die Herz-Gehirn-Achse werden ausführlich diskutiert.
3. Vagusnervstimulation: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Vagusnervstimulation und beschreibt verschiedene Stimulationsmethoden, insbesondere invasive (iVNS) und nicht-invasive (nVNS) Verfahren. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile, Stimulationsparameter, Nebenwirkungen und Kontraindikationen detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Techniken und ihrer jeweiligen Eignung für präventive und therapeutische Anwendungen.
Schlüsselwörter
Transkutane afferente Vagusnervstimulation (tVNS), Vagusnerv, Herzratenvariabilität (HRV), Entzündung, autonomes Nervensystem, Präventivmedizin, nicht-invasive Stimulation, antientzündliche Wirkung, Fallbeispiele, Herz-Kreislauf-Risiko, TNF-alpha.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Transkutane afferente Vagusnervstimulation (tVNS)"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der transkutanen afferenten Vagusnervstimulation (tVNS) als präventive und therapeutische Maßnahme bei Erkrankungen mit eingeschränkter vagaler Kontrolle. Sie untersucht die physiologischen Grundlagen der tVNS, vergleicht verschiedene Stimulationsformen und stellt den aktuellen Forschungsstand dar. Fallbeispiele ergänzen die Ausführungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die physiologischen Grundlagen der Vagusnervfunktion, den Vergleich invasiver und nicht-invasiver Vagusnervstimulation, die Anwendung der tVNS in der Prävention, den Zusammenhang zwischen vagaler Kontrolle, Entzündung und chronischen Erkrankungen sowie die Auswertung von Fallbeispielen zur tVNS-Anwendung.
Was sind die Zielsetzungen der Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, die physiologischen Grundlagen der tVNS zu beleuchten, verschiedene Stimulationsformen (invasive vs. nicht-invasive) zu vergleichen und den aktuellen Forschungsstand darzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Fallbeispielen, um die praktische Anwendung der tVNS zu veranschaulichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Vagusnervstimulation. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Das Kapitel "Grundlagen" behandelt die funktionelle Anatomie des Vagusnervs, das autonome Nervensystem, die molekularen Mechanismen der Vagusfunktion, den Einfluss von Umweltsignalen und die Herzratenvariabilität (HRV). Das Kapitel "Vagusnervstimulation" gibt einen historischen Überblick und beschreibt verschiedene Stimulationsmethoden (invasive und nicht-invasive), inklusive Vor- und Nachteile, Stimulationsparameter, Nebenwirkungen und Kontraindikationen.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kapitel "Grundlagen"?
Das Kapitel "Grundlagen" beleuchtet die funktionelle Anatomie des Vagusnervs, die Rolle des autonomen Nervensystems, die molekularen Mechanismen der Vagusfunktion und den Einfluss von Umweltsignalen (Licht, Nahrung) auf die Vagusaktivität. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der vagalen Kontrolle in der Entzündungsregulation und der Herzratenvariabilität (HRV) als Messparameter der vagalen Kontrolle und deren Bedeutung für die Herz-Gehirn-Achse.
Was wird im Kapitel "Vagusnervstimulation" beschrieben?
Das Kapitel "Vagusnervstimulation" bietet einen historischen Überblick über die Vagusnervstimulation und beschreibt verschiedene Stimulationsmethoden, insbesondere invasive (iVNS) und nicht-invasive (nVNS) Verfahren. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile, Stimulationsparameter, Nebenwirkungen und Kontraindikationen detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Techniken und ihrer Eignung für präventive und therapeutische Anwendungen.
Welche Arten der Vagusnervstimulation werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen invasiver Vagusnervstimulation (iVNS) mit den Unterkategorien linkszervikale und rechtszervikale Stimulation sowie nicht-invasiver Vagusnervstimulation (nVNS). Die jeweiligen Besonderheiten, Stimulationsparameter, Nebenwirkungen und Kontraindikationen werden detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Transkutane afferente Vagusnervstimulation (tVNS), Vagusnerv, Herzratenvariabilität (HRV), Entzündung, autonomes Nervensystem, Präventivmedizin, nicht-invasive Stimulation, antientzündliche Wirkung, Fallbeispiele, Herz-Kreislauf-Risiko, TNF-alpha.
- Quote paper
- Doris Eller-Berndl (Author), 2017, Transkutane afferente Vagusnervstimulation in der Prävention und dem Management von Erkrankungen mit eingeschränkter vagaler Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502302