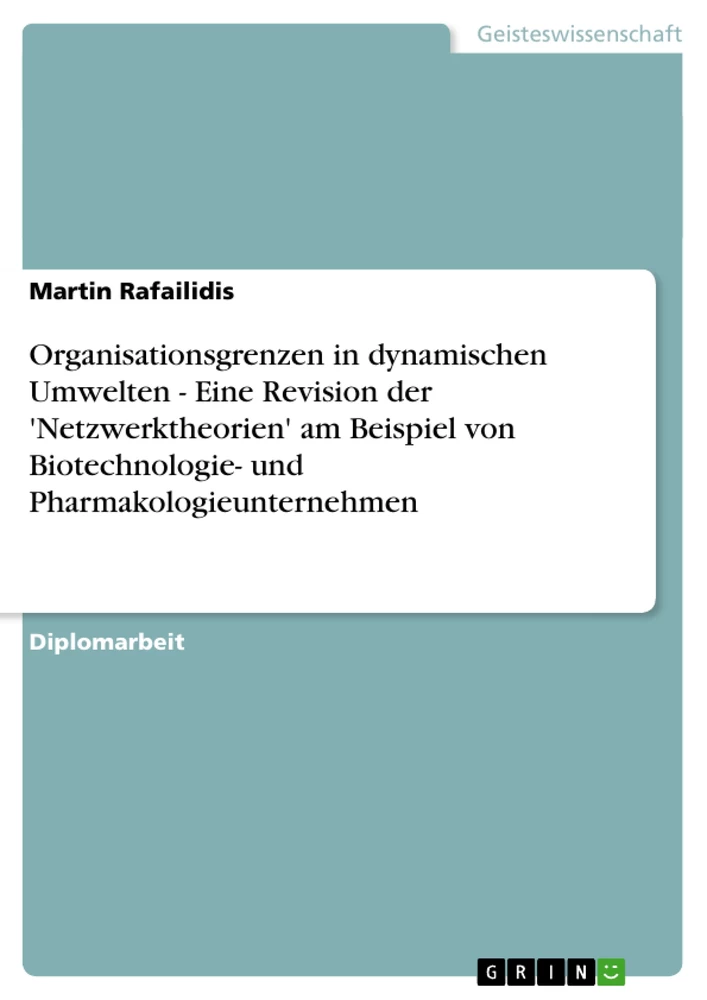„Die Euphorie ist wieder da“. So der Titel eines Artikels im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ im Juni 2003 in Bezug auf die Aktienkurse der Biotechnologiebranche (vgl. Martens 2003). Nach einigem Auf und Ab scheint sich die bei den Börsianern bereits abgeschriebene Branche nach einer Konsolidierungsphase in den Jahren 2000/2001 nun doch zu etablieren. Bernd Seizinger, der Vorsitzende des börsennotierten Münchner Biotechnologieunternehmen s GPC sagt über die Branche: „Wir sind am Ende der Durststrecke angelangt“ (Martens 2003: 74). Mit Nachrichten über neue Krebsmedikamente dienen die Unternehmen als Zugpferde für technologische Werte. Doch auch in der Wissenschaft erweisen sich Biotechnologieunternehmen als Zugpferde für eine bestimmte Forschungsrichtung. Sie erscheinen als etwas Neuartiges, Modernes. Im Vergleich zu den alten, traditionsreichen Pharmakologieunternehmen wirkt alles an ihnen innovativer, flexibler und unkonventioneller. Und das bezieht sich gerade auch auf die Nähe zum wissenschaftlichen Arbeiten und auf die Fähigkeit der Unternehmen in „Kollaborationen“ und „Netzwerken“ neue Medikamente zu entwickeln und partnerschaftlich zu vertreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Stand der Forschung in der „Netzwerkdebatte“
- Dimensionen der „,Netzwerkforschung“
- Die dominanten Theorien
- Die Weiterentwicklung der Netzwerktheorien ...
- Theoretische Implikationen der „Netzwerktheorien“
- Kontingenztheoretische Ansätze
- Institutionenökonomische Ansätze....
- Grundannahmen der Instiutionenökonomie...
- Die Rolle von Institutionen……...
- Der Transaktionskostenansatz.
- Die neoinstitutionalistische Kritik an der Institutionenökonomie und der Kontingenztheorie.
- Das Problem der „,sozialen Einbettung“
- Netzwerkformen weder als Markt noch als Hierarchie
- Der Einbezug der gesellschaftlichen Umwelt im neuen Institutionalismus...
- Die systemtheoretische Unterscheidung von System und Umwelt
- Das unzureichende Verständnis von Organisation als Hierarchie im Neoinstitutionalismus.
- Weder Netzwerk noch Hierarchie: Organisationsgrenzen als Erwartungsgrenzen.
- Organisation verstanden als selbstreferentielles System........
- Organisation als System
- Gesellschaft als Umwelt.
- Zentrale Fragestellung und Untersuchungsdimensionen
- Fragestellung und Forschungshypothesen
- Fallanalysen im Biotechnologie - und Pharmakologiebereich.
- Entscheidungsprämissen als Untersuchungsdimensionen.
- Entscheidungsprogramme..
- Personaleinsatz.
- Kommunikationswege.
- Substituierbarkeit und Ausgleich..
- Operationalisierung der theoretischen Begriffe.
- Methodisches Vorgehen.
- Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument.
- Auswahl der Interviewpartner, Feldzugang, Sample und Durchführung der Interviews...
- Datenaufbereitung und Auswertung der Interviews.
- Drei Fälle von Grenzziehung im Biotechnologie- und Pharmakologiebereich...
- Fall 1: Business Development in einem mittleren Biotechnologieunternehmen
- Zu Interviewpartner und Unternehmen...
- Interaktionsebene: Grenzstelle Business Development C1
- Organisationsebene: Konditionalprogrammierung im Umgang mit Organisationen……………………....
- Gesellschaftsebene: Offene Zweckprogrammierung der Wissenschaftler in Firma C
- Fazit Firma C..
- Fall 2: Vice President eines größeren Biotechnologieunternehmens
- Zu Interviewpartnern und Unternehmen..
- Interaktionsebene: Grenzstelle Vice President E2.
- Organisationsebene: Zusammenarbeit mit anderen Organisationen......
- Gesellschaftsebene: Entscheidungsprämissen bezüglich der Wissenschaftler in der Organisation
- Fazit Firma E
- Fall 3: Personalchef eines großen Pharmakologieunternehmens / Pharmakologiekonzerns......
- Zu Interviewpartner und Unternehmen..
- Interaktionsebene: Grenzstelle Personalchef (Firma B)
- Organisationsebene: Innovation durch Merger&Acquisitions.....
- Gesellschaftsebene: Entscheidungsprämissen zwischen Konzern und Geschäftsstelle.......
- Fazit für Firma B / Konzern B.
- Zusammenfassende Diskussion der Fallanalysen........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Martin Rafailidis beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Organisationsgrenzen in dynamischen Umwelten, am Beispiel von Biotechnologie- und Pharmakologieunternehmen, darstellen und verändern. Die Arbeit analysiert die „Netzwerktheorien“ und untersucht, inwieweit sie in der Lage sind, die beobachteten Phänomene zu erklären.
- Analyse der „Netzwerktheorien“ und deren Relevanz für das Verständnis von Organisationsgrenzen
- Untersuchung des Einflusses der Umwelt auf die Organisationsstruktur in dynamischen Sektoren
- Bedeutung von Kollaborationen und Netzwerken für die Innovationskraft von Biotechnologie- und Pharmakologieunternehmen
- Analyse von Entscheidungsprämissen, die die Grenzziehung in Unternehmen beeinflussen
- Beurteilung der „Netzwerktheorien“ im Kontext des neuen Institutionalismus und der Systemtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz von Netzwerken und Organisationsgrenzen im Kontext der Biotechnologie- und Pharmakologiebranche dar. Sie beschreibt die aktuelle Dynamik in der Branche und die wachsende Bedeutung von Kollaborationen und Netzwerken für die Innovation.
- Zum Stand der Forschung in der „Netzwerkdebatte“: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Dimensionen der „Netzwerkforschung“ und stellt die dominanten Theorien vor. Es beleuchtet die Entwicklung der Netzwerktheorien und deren unterschiedliche Ansätze zur Erklärung von Organisationsgrenzen.
- Theoretische Implikationen der „Netzwerktheorien“: Dieses Kapitel analysiert die theoretischen Implikationen der „Netzwerktheorien“ und diskutiert ihre Bedeutung für das Verständnis von Organisationsgrenzen. Es beleuchtet kontingenztheoretische und institutionenökonomische Ansätze und beleuchtet die Kritik des neuen Institutionalismus an diesen Theorien.
- Die systemtheoretische Unterscheidung von System und Umwelt: Dieses Kapitel befasst sich mit der systemtheoretischen Unterscheidung von System und Umwelt und analysiert die Grenzen der „Netzwerktheorien“ im Kontext des neuen Institutionalismus. Es stellt die Bedeutung von Erwartungsgrenzen und der Selbstreferenzialität von Organisationen heraus.
- Zentrale Fragestellung und Untersuchungsdimensionen: Dieses Kapitel definiert die zentrale Fragestellung der Arbeit und die wichtigsten Forschungsdimensionen. Es beschreibt die Fallanalysen im Biotechnologie- und Pharmakologiebereich und untersucht Entscheidungsprämissen, die die Grenzziehung beeinflussen.
- Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel erläutert die Methoden, die in der Arbeit angewendet werden. Es beschreibt das Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument und erläutert die Auswahl der Interviewpartner, den Feldzugang, das Sample und die Durchführung der Interviews.
- Drei Fälle von Grenzziehung im Biotechnologie- und Pharmakologiebereich: Dieses Kapitel analysiert drei Fallstudien von Grenzziehung in Biotechnologie- und Pharmakologieunternehmen. Es untersucht die Interaktionsebene, die Organisationsebene und die Gesellschaftsebene, um die Faktoren zu identifizieren, die die Organisationsgrenzen beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Organisationsgrenzen, Netzwerktheorien, Biotechnologie, Pharmakologie, Innovation, Kollaboration, Entscheidungsprämissen, Umwelt, Kontingenztheorie, Institutionenökonomie, Neuer Institutionalismus, Systemtheorie und Grenzziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was untersuchen Netzwerktheorien in der Wirtschaft?
Sie untersuchen Kooperationen zwischen Unternehmen, die weder rein marktbasiert noch rein hierarchisch strukturiert sind.
Warum sind Netzwerke für die Biotechnologiebranche so wichtig?
Aufgrund der hohen Dynamik und des Forschungsbedarfs sind Unternehmen auf Kollaborationen angewiesen, um Innovationen effizient zu entwickeln.
Was ist der Unterschied zwischen Organisation und Netzwerk?
Die Arbeit diskutiert, ob Netzwerke eine eigenständige Form sind oder ob Organisationsgrenzen als Erwartungsgrenzen selbstreferentieller Systeme fungieren.
Welche Rolle spielen Transaktionskosten in dieser Analyse?
Der Transaktionskostenansatz hilft zu erklären, warum Unternehmen bestimmte Aktivitäten auslagern oder in Netzwerken organisieren.
Was versteht man unter "sozialer Einbettung" im Neoinstitutionalismus?
Dass wirtschaftliches Handeln immer in soziale Beziehungen und gesellschaftliche Erwartungen eingebettet ist, die über reine Effizienz hinausgehen.
- Citation du texte
- Martin Rafailidis (Auteur), 2005, Organisationsgrenzen in dynamischen Umwelten - Eine Revision der 'Netzwerktheorien' am Beispiel von Biotechnologie- und Pharmakologieunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50247