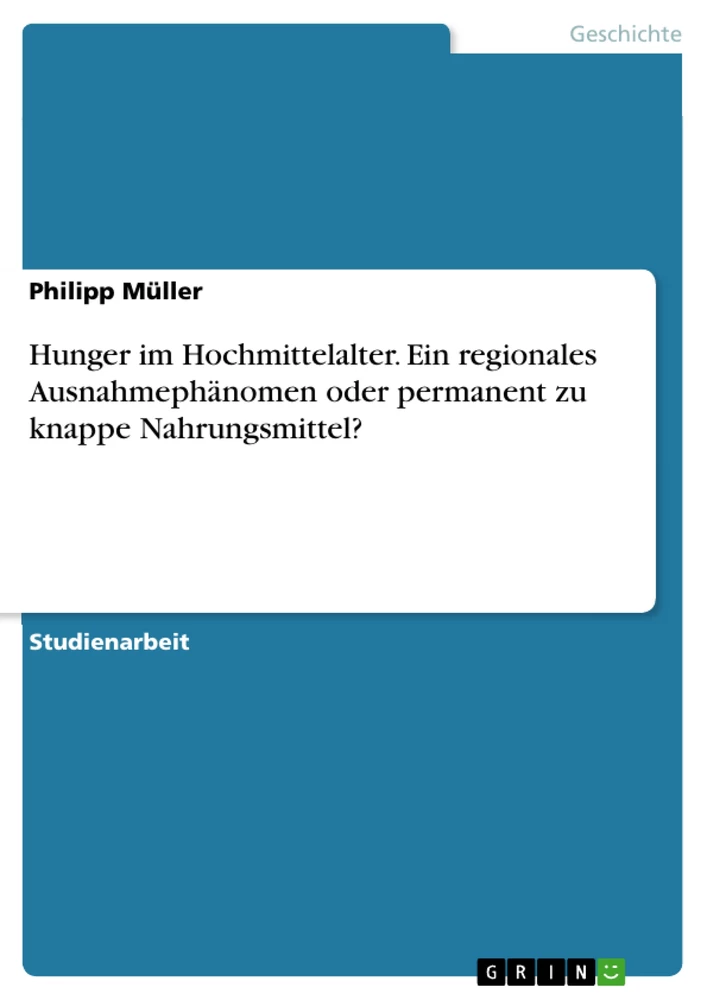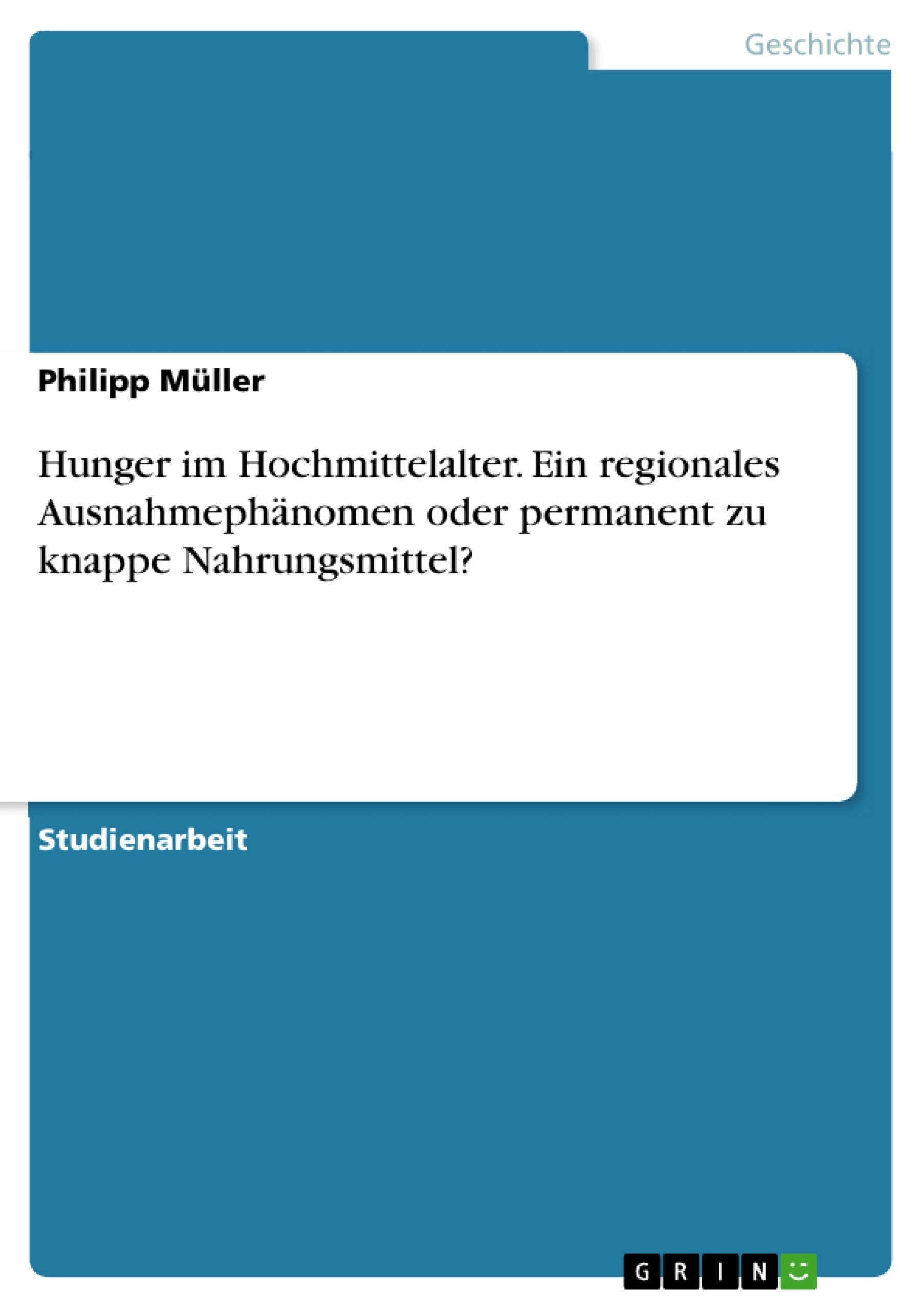Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein Mensch, der kaum Nahrung sieht, andere Dinge im Sinn hat, als der Nachwelt zu hinterlassen, wie es zu dieser Situation kam und in welchem Zustand man sich befindet. Das macht es für heutige Historiker entsprechend schwer, gesicherte Informationen über Anzahl und Ausmaß von Hungersnöten sowie über die allgemeine Ernährungslage vergangener Zeiten zu erhalten. Daraus ließe sich ein tieferes Verständnis für politische, wirtschaftliche aber auch kulturelle Entwicklungen erlangen. Ernst Schubert hat 2006 genau dies versucht und dargelegt, inwiefern der Zugang zu Nahrungsmitteln und deren Breite den Lauf der Geschichte des Mittelalters beeinflusst hat. So nachvollziehbar seine Argumente und Belege dabei für das Früh- und Spätmittelalter sind, so diskussionswürdig sind sie für das Hochmittelalter. Die Jahre 1000-1300 sind im Vergleich zu den anderen Jahrhunderten des Mittelalters geprägt von einer relativen Armut schriftlicher Quellen, gerade in Bezug auf das allgemeine Thema Ernährung.
Anne Schulz konstatiert das genaue Gegenteil. Sie versucht dem Mangel schriftlicher Quellen verstärkt durch archäologische Belege und Bildquellen entgegenzukommen, um daraus Erkenntnisse für die Versorgung im Mittelalter zu erlangen. Vor allem aber für das Hochmittelalter zeichnet sie dabei ein gänzlich anderes Bild und spricht von einer ausreichend guten Ernährung mit lediglich temporär und regional auftretenden Hungerkrisen, da nur so die vielen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen des Hochmittelalters erklärbar wären. Demgegenüber steht Schubert mit der Meinung, dass im ganzen Mittelalter eine permanent zu kurze Nahrungsdecke vorherrschte und gerade das 12. Jahrhundert das Jahrhundert der Hungerkrisen schlechthin war. Wie es zu diesen doch sehr konträren Forschungsmeinungen kommen kann, soll in dieser Arbeit genauer untersucht werden. Dafür werden die verschiedenen Argumente für beide Positionen, auch die von anderen Historikern, gegenübergestellt und anhand einer Quelle erläutert. Diese ist von Rodulfus Glaber, einem Chronisten aus dem 11. Jahrhundert, der eine Hungerkrise im heutigen Frankreich beschreibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische Probleme
- Quellenanalyse
- These 1: Im Hochmittelalter herrschte eine permanent zu kurze Nahrungsdecke
- These 2: es gab regional & zeitlich begrenzte Wellen von Hunger
- Synthese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die gegensätzlichen Forschungsmeinungen zur Ernährungssituation im Hochmittelalter. Sie untersucht, ob im 12. Jahrhundert eine permanent zu kurze Nahrungsdecke vorherrschte oder ob es regional und zeitlich begrenzte Hungerphasen gab. Die Arbeit will dabei die verschiedenen Argumente beider Positionen gegenüberstellen und anhand einer Quelle aus dem 11. Jahrhundert erläutern, welche Herausforderungen schriftliche Quellen für die Rekonstruktion der Ernährungslage im Mittelalter bereiten.
- Die Debatte um die Ernährungslage im Hochmittelalter
- Die Rolle schriftlicher Quellen in der historischen Forschung
- Methodische Herausforderungen bei der Rekonstruktion von Hungersnöten
- Die Bedeutung archäologischer und bildlicher Quellen für die Ernährungsgeschichte
- Das Verhältnis von Hungersnot und wirtschaftlicher, politischer und kultureller Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Problematik der geschichtlichen Rekonstruktion von Hungersnöten und stellt die gegensätzlichen Forschungsmeinungen von Schulz und Schubert dar. Sie führt in die Thematik ein und präsentiert die zentralen Fragestellungen.
- Das Kapitel „Methodische Probleme“ analysiert die Schwierigkeit, den Begriff "Hunger" im historischen Kontext zu definieren und setzt sich mit der Interpretation mittelalterlicher Quellen auseinander. Es beleuchtet, wie die Begriffe "Hunger", "Mangel", "Hungerkrise" und "Hungersnot" im Mittelalter verwendet wurden und welche Einschränkungen bei ihrer Anwendung auf mittelalterliche Quellen bestehen.
- Das Kapitel "Quellenanalyse" untersucht eine Quelle von Rodulfus Glaber, einem Chronisten aus dem 11. Jahrhundert, die eine Hungerkrise im heutigen Frankreich beschreibt. Es analysiert die Quelle, zeigt die Schwierigkeiten bei der Interpretation auf und diskutiert die Aussagekraft der Quelle im Hinblick auf Häufigkeit und Umfang von Ernährungskrisen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Hunger, Ernährung, Nahrungsdecke, Hungerkrisen, Quellenkritik, Quellenanalyse, mittelalterliche Geschichte, Hochmittelalter, Rodulfus Glaber, historische Forschung, Methodische Probleme und historische Quelleninterpretation. Die Analyse der Quellen, insbesondere der Chronik von Rodulfus Glaber, erlaubt Rückschlüsse auf die Ernährungslage im Hochmittelalter und bietet wichtige Erkenntnisse für die Rekonstruktion der historischen Ereignisse.
- Citation du texte
- Philipp Müller (Auteur), 2018, Hunger im Hochmittelalter. Ein regionales Ausnahmephänomen oder permanent zu knappe Nahrungsmittel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502624