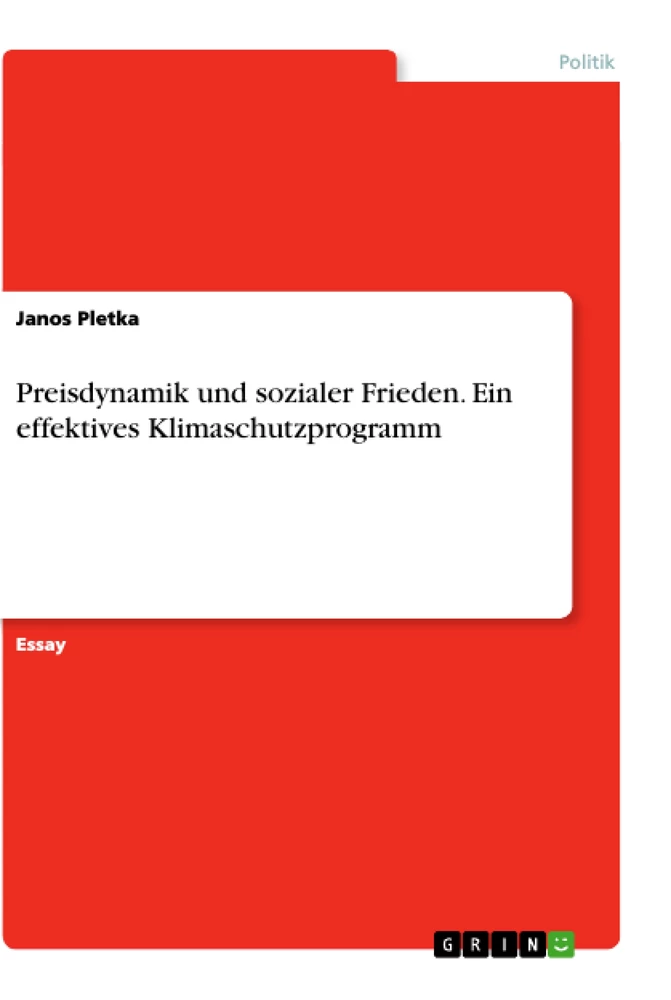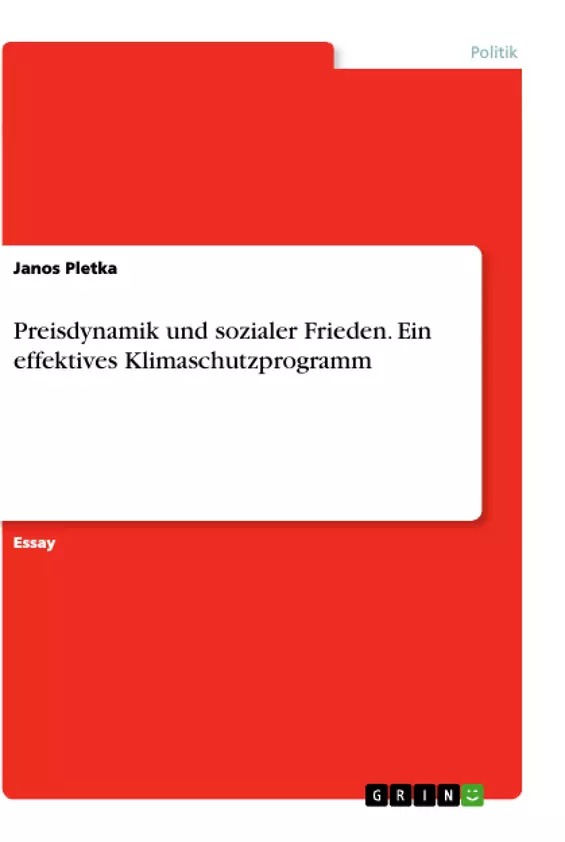Letzte Woche traf sich das Klimakabinett der Bundesregierung zur Vorstellung des Klimaschutzprogramms ab 2021, um die international vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen (bis 2030 starke Reduktion der CO2-Emissionen um weitere 40%). Fakt ist: Eigentlich haben wir keine Zeit, um jetzt Vereinbarungen für das Jahr 2040 zu treffen, die Dinge müssten sich sofort verändern.
Es steht ein Investionsprogramm von 40-50 Milliarden Euro zur Verfügung in den nächsten zwei Legislaturperioden. Viele Staaten und 93 Konzerne verpflichten sich bis 2050 zur Null-Emissionen-Bilanz. "Man habe den Weckruf der Jugend gehört", so Merkel beim UN-Klimagipfel.
Der vorliegende Essay versucht keine neue Ideen hinsichtlich einer radikaleren Klimapolitik zu erwirken, aber er soll die Irrationalität der Bestrebungen hin zu mehr Klimaschutz in der "marktkonformen Demokratie" aufzeigen. Mit den energiepolitischen Antagonismen schneidet sich die Bundesregierung ins eigene Fleisch. Marktöffnung und Markteinbruch zeigen die Unstetigkeiten am Energiemarkt. Milliarden pumpt der Staat in den Klimaschutz, dämpft in der Folge die Märkte, was neuen sozialen Sprengstoff schaffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Wie will man Klimaschutzziele erreichen, wenn man viele Dinge nicht sofort stoppt und bis 2030 oder 2040 weiterlaufen lässt?
- Marktrealität und Marktradikalität
- Wer gewinnt den Kampf um die richtige Klimapolitik?
- Ambivalenter bürgerlicher Staat
- Antagonismen der Energiepolitik
- Globale Dissonanzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die Herausforderungen und Widersprüche der deutschen Klimapolitik im Kontext einer „marktkonformen Demokratie“. Der Autor kritisiert die mangelnde Radikalität der aktuellen Maßnahmen und argumentiert, dass die bestehenden Strukturen und Interessenkonflikte eine effektive Klimapolitik behindern.
- Kritik an der „marktkonformen Demokratie“ im Bezug auf Klimaschutz
- Analyse der energiepolitischen Antagonismen in Deutschland
- Die Rolle des Staates in der Förderung von erneuerbaren Energien und der Abhängigkeit von der Automobilindustrie
- Globale Dissonanzen und die Rolle von China im Kampf gegen den Klimawandel
- Die Frage nach der sozialen und wirtschaftlichen Umverteilung im Kontext der Energiewende
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer kritischen Betrachtung der bestehenden Klimaschutzpolitik und der Notwendigkeit für einen radikaleren Kurs. Die Bundesregierung wird für ihre Kompromissbereitschaft und die Fokussierung auf kurzfristige Interessen kritisiert.
- Im zweiten Kapitel analysiert der Autor die Marktsituation in der Solarbranche und kritisiert die kurzfristigen Förderpolitik der Regierung. Der Konflikt zwischen Marktmechanismen und Klimaschutz wird deutlich aufgezeigt.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage nach der richtigen Klimapolitik und dem politischen Kalkül verschiedener Parteien. Die grüne Forderung nach einer radikalen Energiewende wird im Vergleich zu den konservativeren Ansätzen der Union und SPD beleuchtet.
- Der vierte Kapitel beleuchtet den ambivalenten Zustand des bürgerlichen Staates in Bezug auf die Energiewende. Die Abhängigkeit von der Atomkraft und die Herausforderungen bei der Gestaltung eines effizienten und nachhaltigen Energiemixes werden diskutiert.
- Der Essay endet mit einer Analyse der energiepolitischen Antagonismen und der globalen Dissonanzen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Rolle von China und die Schwierigkeiten der internationalen Zusammenarbeit werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Der Essay behandelt zentrale Themen wie die „marktkonforme Demokratie“, energiepolitische Antagonismen, die Energiewende, den Klimawandel, die Rolle des Staates, die Automobilindustrie, die Globalisierung, soziale Ungleichheit und die Frage nach der internationalen Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptkritik am Klimaschutzprogramm der Bundesregierung?
Der Essay kritisiert die mangelnde Radikalität und die "Irrationalität" der Maßnahmen, die oft kurzfristigen Marktinteressen folgen, anstatt notwendige sofortige Veränderungen herbeizuführen.
Was bedeutet "marktkonforme Demokratie" im Klimakontext?
Es beschreibt ein System, in dem politische Entscheidungen zum Klimaschutz so gestaltet werden, dass sie die bestehenden Marktmechanismen nicht stören, was laut Autor oft zu ineffektiven Kompromissen führt.
Welche Rolle spielen energiepolitische Antagonismen?
Damit sind Widersprüche gemeint, wie etwa die staatliche Förderung von Klimaschutz bei gleichzeitiger Abhängigkeit von der Automobilindustrie und fossilen Strukturen.
Warum wird die Förderpolitik der Solarbranche kritisiert?
Der Autor nutzt die Solarbranche als Beispiel für eine unstete Politik, bei der Markteinbrüche durch kurzfristige Förderänderungen neuen "sozialen Sprengstoff" erzeugen.
Was ist mit "globalen Dissonanzen" gemeint?
Dies bezieht sich auf die Schwierigkeit, nationale Klimaziele in einer globalisierten Welt umzusetzen, in der Akteure wie China eine dominante, aber oft gegensätzliche Rolle spielen.
Kann Klimaschutz in der aktuellen Marktform gelingen?
Der Essay stellt dies infrage und argumentiert, dass der Staat durch das Festhalten an marktkonformen Lösungen oft "das Falsche richtig macht" und echte Nachhaltigkeit behindert.
- Citation du texte
- Janos Pletka (Auteur), 2019, Preisdynamik und sozialer Frieden. Ein effektives Klimaschutzprogramm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502819