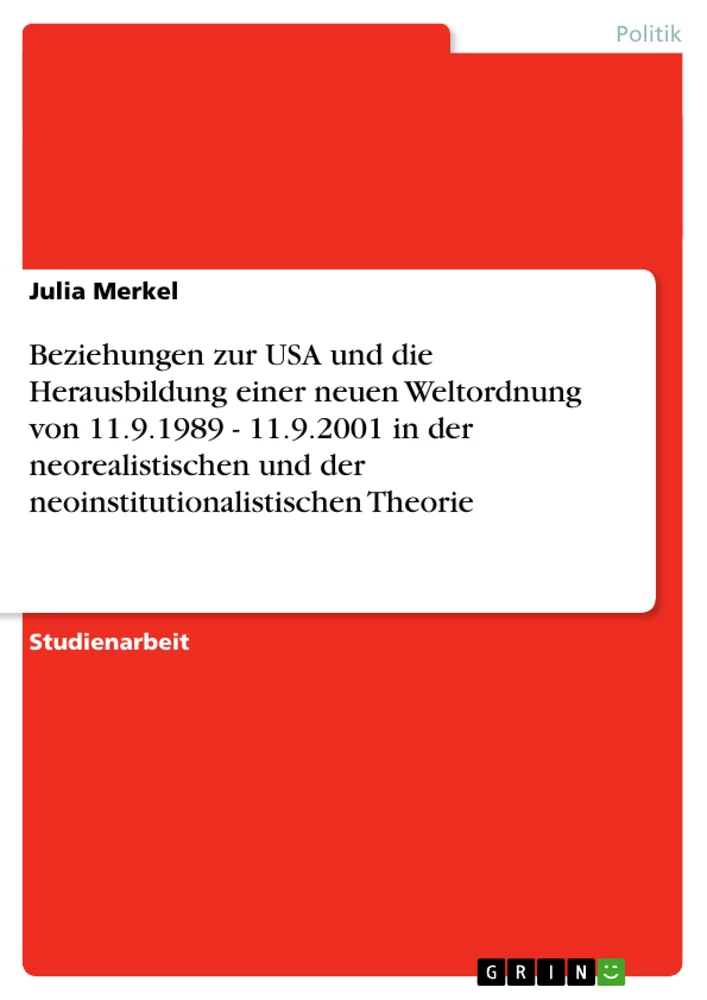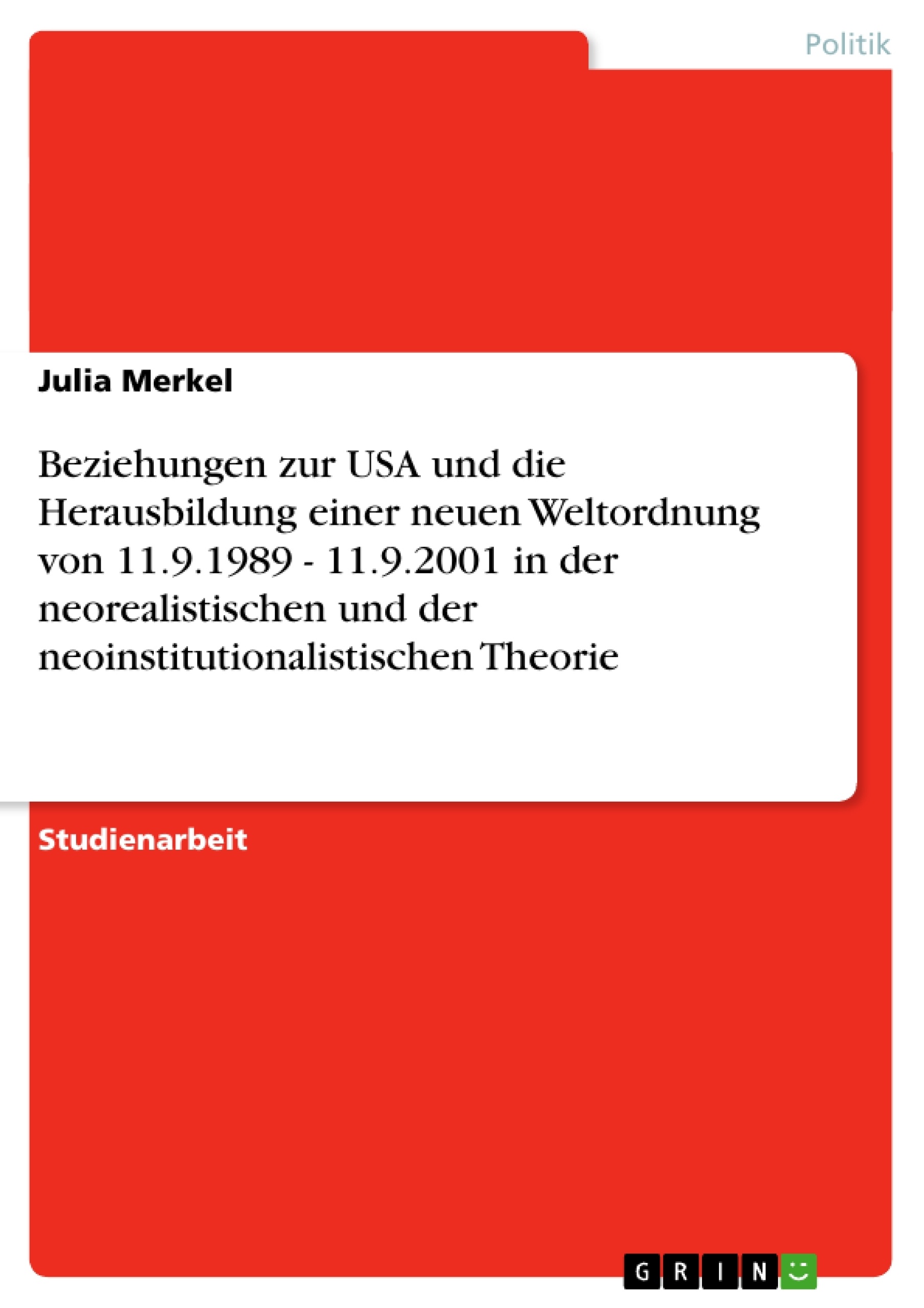Nah dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall des Sowjetimperiums hat sich auch die bipolare Blockkonfrontation, die spätestens nach dem Beginn des Kalten Kriegs die Weltordnung strukturiert hatte, aufgelöst. Die internationalen Beziehungen schienen in dieser Situation ohne ein erkennbares Weltordnungsprinzip. Übrig geblieben waren die USA als einzige Supermacht in einer potentiell multipolaren Welt. Neben den USA hatten sich andere regionale Macht- und Gravitationszentren herausgebildet, die aber wie Europa ihre Macht weniger auf militärische Stärke, als auf wirtschaftlichen Einfluss (Europäische Union) oder die schiere Bevölkerungsgröße plus Nuklearwaffen (China) stützen. Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion suchte und sucht nach dem Verlust seines Status als Supermacht nach einer neuen Rolle in der Staatenwelt. Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war noch nicht klar, welches neues strukturierende Ordnungsprinzip sich innerhalb der Staatenwelt herausbildet oder welche „Macht“ (USA vs. UNO) in welchem Maße den Fortgang der internationalen Politik formen würde. Rund zehn Jahre später werden durch den Terroranschlag am 11.9.2001 der Stolz, das Selbstbewusstsein und vor allem das Sicherheitsgefühl der einzig verbliebenen Supermacht USA dramatisch erschüttert.
Symbolisch wie faktisch begrenzen der 11.9. (1989), der Fall der Berliner Mauer und das damit eingeläutete Ende des Ost-West-Konfliktes, und der 9.11. (2001), der Anschlag auf das World Trade Center, und die Zeit unmittelbar danach die Untersuchungsperiode. Analysiert werden soll, welche Struktur der internationalen Beziehungen sich in den 12, bzw. 14 Jahren (Einschluss des Afghanistan- und Irak- Krieges) herausgebildet hat, beziehungsweise sich herauszubilden beginnt. Dabei soll im besonderen Maße das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA, aber vor allem auch der entscheidende Akteur der internationalen Beziehungen, die USA auf der Suche nach der „Grand Strategy“ berücksichtigt werden. Es soll damit die Frage beantwortet werden, ob sich eher uni- oder multilaterale Strukturen im transatlantischen Beziehungsgeflecht und der Weltordnung herausgebildet und etabliert haben.
Inhaltsverzeichnis
- I, Einleitung
- 1. Theoretische Herangehensweise
- 1.1. Der Neorealismus
- 1.2. Der Neoinstitutionalismus
- 2. Methode und Hypothesen
- 3. Fallstudien: drei Schlüsselbereiche
- 3.1. Die WTO
- 3.2. Die Balkankriege
- 3.3. Der 11. September, Afghanistan und der zweite Irakkrieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der internationalen Beziehungen zwischen dem Fall der Berliner Mauer (1989) und den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Im Fokus steht die Rolle der USA als einzige Supermacht und die Herausbildung einer neuen Weltordnung. Analysiert wird, inwieweit sich uni- oder multilaterale Strukturen etabliert haben und wie das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA gestaltet war.
- Die Rolle der USA als Hegemonialmacht nach dem Ende des Kalten Krieges
- Die Entwicklung der internationalen Beziehungen im Lichte des Neorealismus und Neoinstitutionalismus
- Analyse von Schlüsselereignissen wie dem Zusammenbruch der Sowjetunion, den Balkankriegen und dem 11. September
- Das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA
- Die Frage nach der Etablierung uni- oder multilateraler Strukturen in der Weltordnung
Zusammenfassung der Kapitel
I, Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, beginnend mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges. Sie stellt die Frage nach der neuen Weltordnung und der Rolle der USA als einzige Supermacht. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der internationalen Beziehungen in den darauffolgenden Jahren und dem Einfluss des 11. Septembers 2001. Die Arbeit nutzt den Neorealismus und Neoinstitutionalismus als theoretische Rahmenbedingungen, um die Ereignisse zu analysieren und die Frage nach uni- oder multilateralen Strukturen zu beantworten. Die Untersuchung konzentriert sich auf das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA, sowie auf die "Grand Strategy" der USA.
1. Theoretische Herangehensweise: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es den Neorealismus, insbesondere die Version von Kenneth Waltz, und den Neoinstitutionalismus nach Joseph Nye und Robert Keohane vorstellt. Es werden die Kernannahmen beider Theorien kurz dargestellt und ihre Relevanz für die Analyse der Fallstudien im Kapitel 3 hervorgehoben. Die Auswahl dieser beiden Theorien dient als wissenschaftlicher Rahmen zur Interpretation der historischen Ereignisse und wird selbst dem Test der Ereignisse unterzogen.
1.1. Der Neorealismus: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die neorealistische Theorie nach Kenneth Waltz und deren Anwendung auf die Außenpolitik der USA nach dem Ende des Kalten Krieges. Es wird untersucht, ob die USA dem rationalen Kalkül des Machterwerbs folgten und wie sie die internationalen Beziehungen beeinflussten. Die zentrale Frage ist, ob die USA unilateral im Sinne nationaler Interessen handelten oder sich an Normen des Internationalen Rechts und der UNO orientierten. Der Neorealismus dient als Interpretationsrahmen und wird gleichzeitig durch die Ereignisse der untersuchten Periode evaluiert.
1.2. Der Neoinstitutionalismus: Dieser Abschnitt präsentiert den neoinstitutionalistischen Ansatz als Gegenstück zum Neorealismus. Er skizziert die Kernelemente dieser Theorie, wie sie von Joseph Nye und Robert Keohane entwickelt wurden, und betont ihre Bedeutung für das Verständnis der internationalen Beziehungen im untersuchten Zeitraum. Im Gegensatz zum Neorealismus werden hier die Rolle von Institutionen und internationalen Abkommen im Umgang mit globalen Herausforderungen beleuchtet. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven beider Theorien im Kontext der Fallstudien antizipiert.
2. Methode und Hypothesen: (Annahme: dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Hypothesen der Arbeit. Eine detaillierte Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text. Hier müsste im Rahmen einer vollständigen Bearbeitung eine Zusammenfassung basierend auf den im Originaltext gegebenen Informationen ergänzt werden.)
3. Fallstudien: drei Schlüsselbereiche: Dieses Kapitel stellt drei Fallstudien vor, um die theoretischen Ansätze des Neorealismus und Neoinstitutionalismus zu testen und die Entwicklung der internationalen Beziehungen zu analysieren. Die drei Fallstudien fokussieren auf wichtige Ereignisse und Regionen und beleuchten die Rolle der USA in diesen Kontexten.
3.1. Die WTO: (Annahme: dieser Abschnitt analysiert die Rolle der WTO und den Einfluss der USA auf deren Entwicklung. Eine detaillierte Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text. Hier müsste im Rahmen einer vollständigen Bearbeitung eine Zusammenfassung basierend auf den im Originaltext gegebenen Informationen ergänzt werden.)
3.2. Die Balkankriege: (Annahme: dieser Abschnitt analysiert die Rolle der USA und anderer Akteure während der Balkankriege. Eine detaillierte Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text. Hier müsste im Rahmen einer vollständigen Bearbeitung eine Zusammenfassung basierend auf den im Originaltext gegebenen Informationen ergänzt werden.)
3.3. Der 11. September, Afghanistan und der zweite Irakkrieg: (Annahme: dieser Abschnitt analysiert die Reaktion der USA auf den 11. September 2001 und die darauffolgenden Kriege in Afghanistan und im Irak. Eine detaillierte Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text. Hier müsste im Rahmen einer vollständigen Bearbeitung eine Zusammenfassung basierend auf den im Originaltext gegebenen Informationen ergänzt werden.)
Schlüsselwörter
USA, Weltordnung, Neorealismus, Neoinstitutionalismus, Transatlantische Beziehungen, Multilateralismus, Unilateralismus, Balkankriege, 11. September, Afghanistan, Irak, Hegemonie, Supermacht, Internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Internationale Beziehungen nach dem Kalten Krieg
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der internationalen Beziehungen zwischen dem Fall der Berliner Mauer (1989) und den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Im Fokus steht die Rolle der USA als einzige Supermacht und die Herausbildung einer neuen Weltordnung. Analysiert wird, inwieweit sich uni- oder multilaterale Strukturen etabliert haben und wie das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA gestaltet war.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt den Neorealismus (insbesondere die Version von Kenneth Waltz) und den Neoinstitutionalismus (nach Joseph Nye und Robert Keohane) als theoretische Rahmenbedingungen. Beide Theorien werden vorgestellt und ihre Relevanz für die Analyse der Fallstudien hervorgehoben. Die Arbeit unterzieht die Theorien selbst einem Test anhand der analysierten Ereignisse.
Welche Fallstudien werden untersucht?
Die Arbeit beinhaltet drei Fallstudien: die WTO, die Balkankriege und den 11. September mit den darauffolgenden Kriegen in Afghanistan und im Irak. Diese Fallstudien dienen dazu, die theoretischen Ansätze zu testen und die Entwicklung der internationalen Beziehungen zu analysieren.
Welche Rolle spielen die USA in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der USA als Hegemonialmacht nach dem Ende des Kalten Krieges. Es wird analysiert, ob die USA dem rationalen Kalkül des Machterwerbs folgten und wie sie die internationalen Beziehungen beeinflussten, insbesondere im Kontext der drei Fallstudien.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Fragen sind: die Etablierung uni- oder multilateraler Strukturen in der Weltordnung, das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA, die "Grand Strategy" der USA und die Frage, ob die USA unilateral im Sinne nationaler Interessen handelten oder sich an Normen des Internationalen Rechts und der UNO orientierten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur theoretischen Herangehensweise (Neorealismus und Neoinstitutionalismus), ein Kapitel zu Methode und Hypothesen, ein Kapitel mit drei Fallstudien (WTO, Balkankriege, 11. September/Afghanistan/Irak) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: USA, Weltordnung, Neorealismus, Neoinstitutionalismus, Transatlantische Beziehungen, Multilateralismus, Unilateralismus, Balkankriege, 11. September, Afghanistan, Irak, Hegemonie, Supermacht, Internationale Beziehungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage beschreibt. Es folgt ein Kapitel, das die theoretischen Grundlagen erläutert. Danach wird die Methodik und die Hypothesen vorgestellt. Der Hauptteil besteht aus drei Fallstudien, die die theoretischen Ansätze überprüfen. Abschließend folgt ein Fazit.
- Citar trabajo
- Julia Merkel (Autor), 2004, Beziehungen zur USA und die Herausbildung einer neuen Weltordnung von 11.9.1989 - 11.9.2001 in der neorealistischen und der neoinstitutionalistischen Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50283