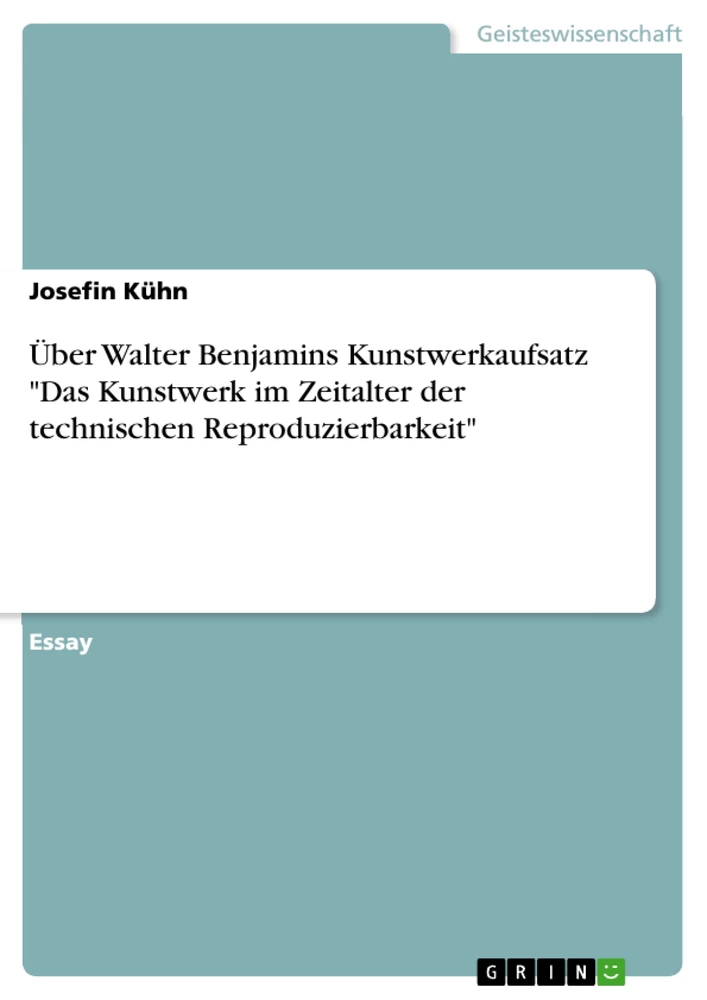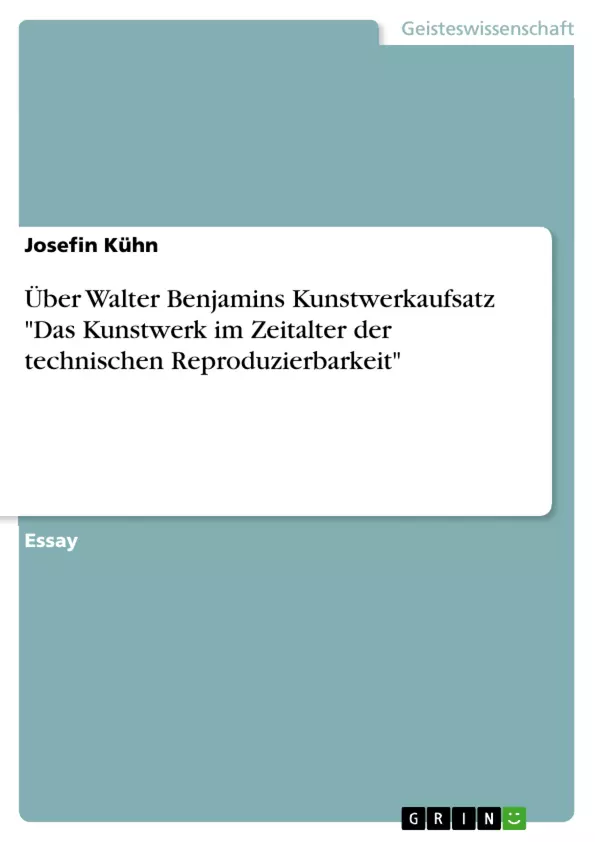Ein Essay über Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz im Seminar: Urteilskraft in Ästhetik und Sozialphilosophie!
Urteilskraft in Ästhetik und Philosophie meint die Verbindung zwischen der Ästhetik und dem Sozialen. Eine Diskussion über die „Ästhetisierung des Sozialen“ entsteht. Wie wirken und beeinflussen die Verbreitung visueller Medien das soziale Leben? Im Folgenden möchte ich dazu den Kunstwerkaufsatz: Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin näher beleuchten und deren Sicht auf den Gewinn und die Kritik an dieser „Ästhetisierung“ beleuchten. Walter Benjamin wurde 1892 in Berlin geboren. Er absolvierte zunächst sein Abitur, danach beendete er sein Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte und promovierte erfolgreich in Bern. Danach arbeitete Benjamin als selbstständiger Schriftsteller und Publizist. Als 1933 die Machtübernahme der Nationalsozialistin erfolgte, kam er aufgrund seiner Angehörigkeit des assimilierten Judentums, in das Pariser Exil, wo er seinen Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit“ verfasste. 1939 kehrte er aus der Haft zurück und wählte ein Jahr später in der Nähe von Port Bou den Freitod. Anhand Walter Benjamins Biografie wird schnell deutlich, dass er in der Zeit der Entstehung des Faschismus lebte. Eine gesamteuropäische faschistische Bewegung war im Gange. Durch diesen Geschichtsumschwung und der unverzüglichen Technikerneuerungen verlor das eigenständige Kunstwerk seine Stellung als Reflexionsmedium und Sinnbildform der Bürger, sodass mit dem Faschismus das Ende der bürgerlichen Kunst einhergeht. Sein Aufsatz ist daher eine Reaktion auf den gesellschaftlichen Kunstwandel. In diesem beschreibt er den Vorgang der Moderne, welche den Kunst- und Kulturbegriff vollkommen unterminiert. Die Gründe dafür liegen in der massenhaften Reproduktion kultureller Werke, denn die 1930er Jahre waren geprägt von neuen technologischen Durchbrüchen. Zunächst schreibt Benjamin über die Geschichte der Reproduktion, zeigt Unterschiede zwischen traditionellen Kunstwerken und Werke der Moderne auf und thematisiert den Einfluss von Fotografie und Film im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Es erfolgt die Einführung von Reproduktionstechniken und ihre Möglichkeiten, Probleme, Auswirkungen und Konsequenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Über Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz: „Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit”
- Urteilskraft in Ästhetik und Philosophie
- Die „Ästhetisierung des Sozialen”
- Walter Benjamin: Leben und Werk
- Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
- Die Geschichte der Reproduktion
- Die Aura des Kunstwerkes
- Der Verlust der Aura
- Die Folgen des Verlustes der Aura
- Die Rolle der Fotografie und des Films
- Die „Ästhetisierung der Politik”
- Die Bedeutung der Kunst im 20. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit" im Kontext der „Ästhetisierung des Sozialen“. Er beleuchtet die Auswirkungen der massenhaften Verbreitung visueller Medien auf das soziale Leben und untersucht die Kritik Benjamins an der technologischen Reproduktion von Kunstwerken im Kontext des aufkommenden Faschismus.
- Die Bedeutung des Kunstwerkes im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
- Der Verlust der Aura und des kultischen Wertes von Kunstwerken
- Die Rolle der Fotografie und des Films in der massenhaften Reproduktion
- Die „Ästhetisierung der Politik“ und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Bedeutung der Kunst im Kontext der politischen und technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext von Benjamins Aufsatz und die Bedeutung der „Ästhetisierung des Sozialen“ für die Kunst und Gesellschaft beleuchtet. Anschließend wird auf die Biografie von Walter Benjamin eingegangen und seine Lebensumstände im Kontext des aufkommenden Faschismus dargestellt. In den folgenden Kapiteln wird die Geschichte der Reproduktion von Kunstwerken vom Altertum bis zur Fotografie und zum Film beleuchtet. Der Essay beschreibt den Verlust der Aura und die Folgen der massenhaften Reproduktion für den Wert und die Bedeutung von Kunstwerken.
Der Einfluss der Fotografie und des Films auf die Wahrnehmung und Rezeption von Kunst wird analysiert. Es wird gezeigt, wie diese neuen Medien zu einer Veränderung des Verhältnisses zwischen Kunstwerk und Betrachter führen. Der Essay untersucht, wie die technische Reproduzierbarkeit zu einer „Ästhetisierung der Politik“ führt und wie diese sich auf die Gesellschaft auswirkt.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Kunstwerk, technische Reproduzierbarkeit, Aura, „Ästhetisierung des Sozialen“, Faschismus, Fotografie, Film, Massenmedien, Politisierung der Kunst, Wahrnehmung, Rezeption, Ausstellungswert, kultischer Wert, gesellschaftliche Veränderungen, 20. Jahrhundert.
- Citation du texte
- Josefin Kühn (Auteur), 2019, Über Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503251