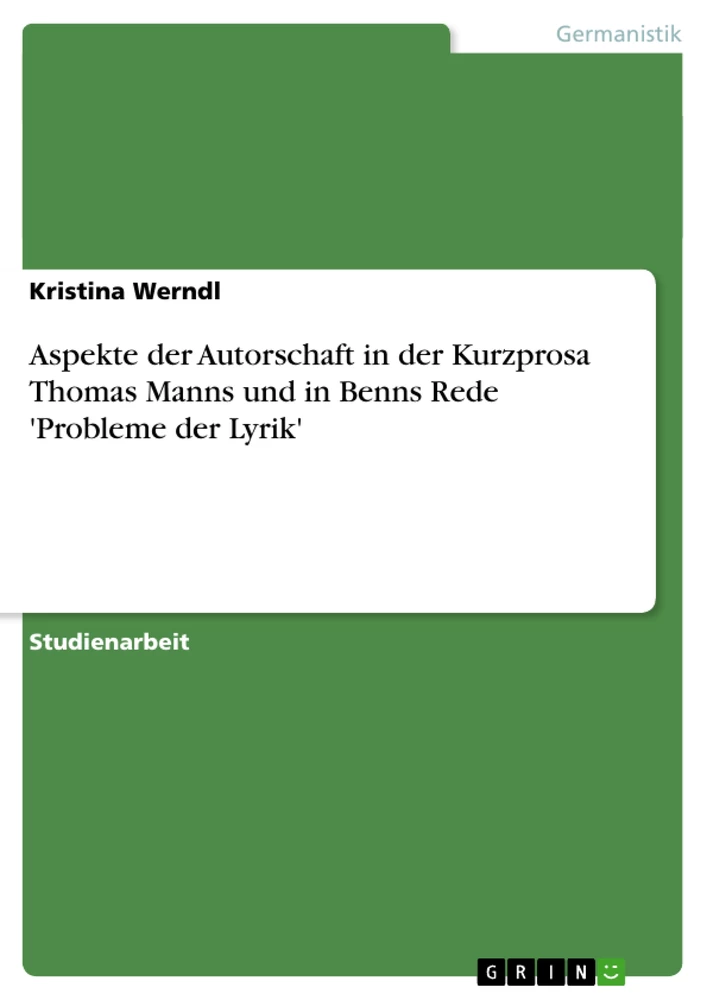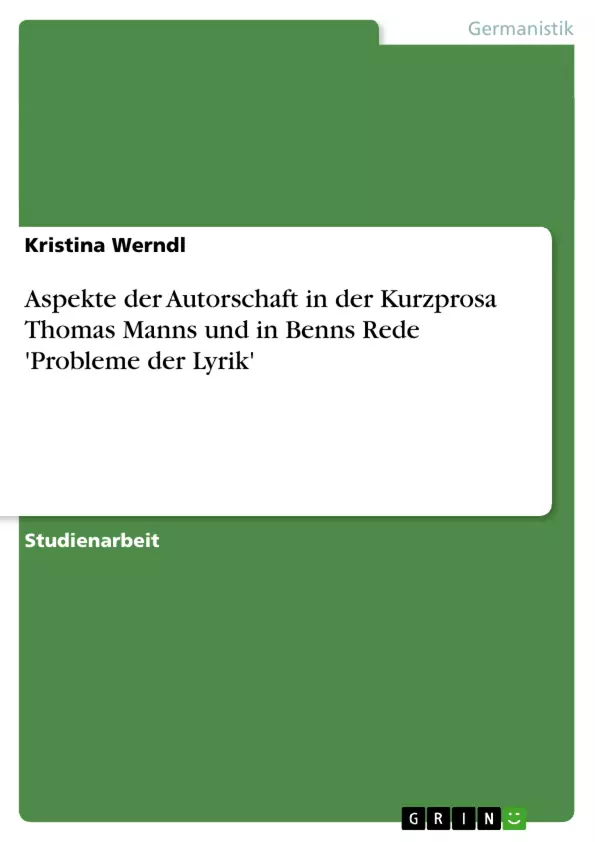Im Zentrum dieser Auseinandersetzung mit Thomas Manns Novellen und Benns "Marburger Rede" stehen die Frage nach dem Leiden an der Autorschaft und dessen psycho-physische Bestimmung. Die Künstler-Bürger-Problematik ist für Thomas Mann bekanntermaßen zentral, ihr widmen sich u.a. die Kapiteln "Künstler und Gesellschaft", "Zucht und Zügellosigkeit", "Der Dichter als verdächtiges Subjekt". Außerdem: Gottfried Benns Status als Gefühls-Verweigerer, sein Konzept eine neuen Dichtung, der poiesis-Begriff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum dichterischen Selbstverständnis Thomas Manns
- Benns Status als Gefühls-Verweigerer
- Die neue Dichtung
- Exkurs: Missionare der Kälte
- Michel Houellebecq: Elementarteilchen
- Der poiesis-Begriff
- Ein Kunstprodukt: Wälsungenblut
- Zum Wesen des Künstlertums
- Künstlertum bei Thomas Mann
- Künstler und Gesellschaft
- Zucht und Zügellosigkeit
- Der Dichter als verdächtiges Subjekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Thematik der Autorschaft in der Kurzprosa Thomas Manns und in Gottfried Benns Rede „Probleme der Lyrik“. Sie beleuchtet die Frage nach dem Leiden an der Autorschaft und dessen psycho-physische Auswirkungen, insbesondere im Kontext der „Künstler-Bürger-Problematik“. Die Arbeit analysiert, wie diese Thematik in den Werken Thomas Manns behandelt wird und wie sie sich mit den poetologischen Aussagen Benns in Verbindung setzen lässt.
- Das Leiden an der Autorschaft
- Die „Künstler-Bürger-Problematik“
- Thomas Manns dichterisches Selbstverständnis
- Gottfried Benns poetologische Aussagen
- Die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Pythagoras und führt in die Thematik der Autorschaft ein. Es wird betont, dass Widerspruch erwünscht ist, aber durch eine fundierte Begründung der Arbeitsmethoden und -ergebnisse minimiert werden soll. Es werden die bevorzugten Analysetexte vorgestellt: Thomas Manns Novelle „Tonio Kröger“ und Gottfried Benns Rede „Probleme der Lyrik“. Die Einleitung endet mit einem Vergleich der heutigen Arbeitsbedingungen mit denen vergangener Zeiten.
Kapitel 2 widmet sich Thomas Manns dichterischem Selbstverständnis. Es werden seine Zweifel an der Gehörigkeit des Dichtertums und sein Streben nach realitätsnaher Darstellung beleuchtet. Es wird auf seine Briefwechsel und Tagebuchnotizen Bezug genommen, um Einblicke in seine Arbeitsweise und seine Sicht auf das Schreiben zu gewinnen. Es wird die Verbindung zwischen seinen literarischen Figuren und seinem eigenen Leben beleuchtet, wobei die Bedeutung der poetischen Überformung für den künstlerischen Prozess hervorgehoben wird.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit Gottfried Benns Status als „Gefühls-Verweigerer“. Es wird auf den inhaltlichen Wandel seines Schaffens im Laufe seines Lebens eingegangen. Es wird ein Vergleich zwischen Thomas Manns und Benns Werk gezogen, wobei die Unterschiede in ihrem Themenspektrum und ihrer Motivwahl hervorgehoben werden. Das Kapitel erläutert Benns Entwicklung vom expressionistischen Ich zum introvertierten Ich in seinen „Statischen Gedichten“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselthemen: Autorschaft, Kunst, Literatur, Thomas Mann, Gottfried Benn, Dichter, Künstler, Gesellschaft, „Künstler-Bürger-Problematik“, Selbstverständnis, „Probleme der Lyrik“, „Tonio Kröger“, „Wälsungenblut“, poetologische Aussagen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Künstler-Bürger-Problematik“ bei Thomas Mann?
Es beschreibt den inneren Konflikt des Künstlers, der sich zwischen der bürgerlichen Welt und seinem künstlerischen Dasein hin- und hergerissen fühlt.
Wie definiert Gottfried Benn seine „neue Dichtung“?
Benn vertritt ein Konzept der Gefühlsverweigerung und ein introvertiertes Ich, das sich in seinen „Statischen Gedichten“ ausdrückt.
Welche Werke von Thomas Mann werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit bezieht sich insbesondere auf die Novellen „Tonio Kröger“ und „Wälsungenblut“.
Was bedeutet der Begriff „poiesis“ in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf den Schöpfungsakt des Dichters und die psycho-physische Bestimmung der Autorschaft.
Warum wird der Dichter als „verdächtiges Subjekt“ bezeichnet?
Dies thematisiert die Zweifel an der moralischen und gesellschaftlichen Stellung des Künstlers, die Thomas Mann in seinen Werken oft reflektiert.
- Quote paper
- Kristina Werndl (Author), 2002, Aspekte der Autorschaft in der Kurzprosa Thomas Manns und in Benns Rede 'Probleme der Lyrik', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50326