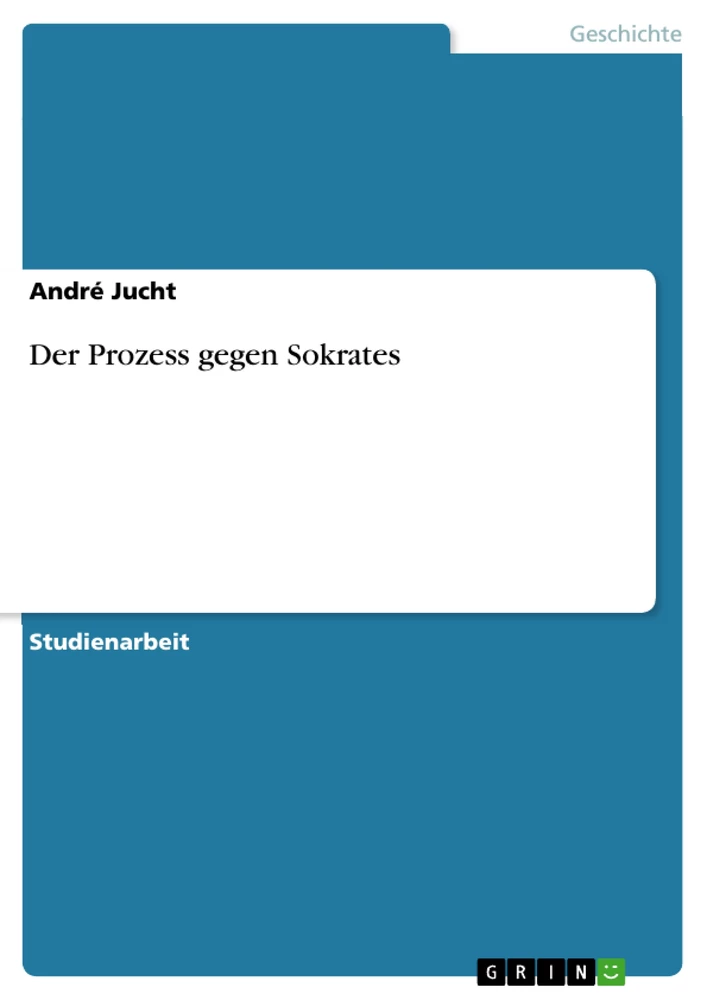Sokrates lernte von seinem Vater das Handwerk der Bildhauerei, gab es aber bald auf, um in freiwilliger Armut sich ganz der Philosophie zu widmen. Daneben erfüllte er seine Staatspflichten, verwaltete ab und zu ein Amt, kämpfte im Peloponnesischen Krieg und mußte im Alter von 70 Jahren, den heldenhaften Tod durch den Giftbecher zu sterben. Verstand und Wissen bedeutet für Sokrates alles, obwohl er immer von sich behauptet, dass er nichts weiß. Alles schien ihm lehrbar. Sogar vor dem Versuch, die Tugend zu lehren machte er nicht Halt. Auf sachliche Kenntnisse kam es ihm nicht an. Er kritisierte nur das, was er nach gründlicher Prüfung an sich selbst nicht anerkennen konnte. Um seine Selbsterkenntnistheorie zu fundieren und der Wahrheit eine Basis zu geben, bediente er sich seinem daimonion, welches er als Rechtfertigung für viele Dinge seines Werkens ausgab. Dies mag auch ein Grund gewesen sein, warum ihn und seinen Geist viele Athener nicht anerkannten und sogar verurteilten. Sokrates verstand es, seine Gesprächspartner dazu zu bringen, das sie genau das sagten, was er wollte. Er entlarvte jede Form von Heuchelei und Angeberei sofort und hatte keine Angst, seine Form von Wahrheit zu verbreiten. Auch deshalb könnte er in den Augen vieler ein Dorn gewesen sein. Auf Grund der überlieferten Quellen ist es unausweichlich zu sagen, das Sokrates ein Mann von hoher geistiger Größe und gelassener Standhaftigkeit gewesen sein musste, was auch zu seinem Tod geführt hat. Natürlich darf man bei den Gründen, die zu einer Anklage wegen Verleitung der Jugend und der Einführung neuer Götter ausgesprochen wurde nicht vergessen, das die Polis auch geschriebene und ungeschriebene Gesetze hatte, gegen die Sokrates unter Umständen verstoßen haben könnte. Diese aufzuzählen, zu untersuchen und den Prozessverlauf darzustellen werde ich versuchen, klar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antikes Religionsbewußtsein und der religiöse Charakter der sokratischen Anklage
- Die rechtliche Grundlage der Anklage
- Das sokratische Daimonion
- Der Prozess
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Prozess gegen Sokrates aus rechtlicher und religiöser Perspektive. Ziel ist es, die Hintergründe und Beweggründe der Anklage zu beleuchten und die rechtliche Grundlage des Verfahrens zu analysieren. Dabei wird insbesondere auf den religiösen Charakter der Anklage sowie die Rolle des sokratischen Daimonion eingegangen.
- Religiöses Bewusstsein im antiken Athen
- Rechtliche Grundlagen der Anklage
- Die Bedeutung des sokratischen Daimonion
- Der Prozessverlauf
- Die Rolle der Staatsreligion und individueller Überzeugungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Leben und Werk des Sokrates ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Kapitel 2.1 beleuchtet das antike Religionsbewußtsein und die Bedeutung der Götterverehrung in Athen. Dabei wird der Fokus auf die eusebeia und die Folgen des Abfalls von der Staatsreligion gelegt. Kapitel 2.2 analysiert die rechtliche Grundlage der Anklage gegen Sokrates, insbesondere hinsichtlich des Vorwurfs der Blasphemie. Dieses Kapitel betrachtet auch die Rolle von Xenophon und Platon als Quellen für die Rekonstruktion des historischen Prozesses.
Schlüsselwörter
Sokrates, Prozess, Athen, Staatsreligion, eusebeia, Blasphemie, Daimonion, Recht, Religion, Philosophie, Antike, Xenophon, Platon
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde Sokrates angeklagt?
Die offiziellen Anklagepunkte waren die Verführung der Jugend und die Einführung neuer Götter (Asebie/Gottlosigkeit) entgegen der staatlich anerkannten Religion Athens.
Was versteht man unter dem „sokratischen Daimonion“?
Das Daimonion war eine innere Stimme, die Sokrates als göttliches Zeichen interpretierte. Es warnte ihn meist vor falschen Handlungen und diente ihm als persönliche moralische Instanz.
Welche rechtliche Rolle spielte die Staatsreligion im antiken Athen?
Die Verehrung der Stadtgötter war eine Bürgerpflicht. Ein Abfall von der Staatsreligion galt als Gefährdung des Gemeinwohls (Polis) und konnte rechtlich als Blasphemie verfolgt werden.
Wie reagierte Sokrates auf seine Verurteilung?
Sokrates blieb standhaft und gelassen. Er weigerte sich zu fliehen, da er die Gesetze des Staates achtete, und trank schließlich den Giftbecher.
Wer sind die Hauptquellen für den Prozess gegen Sokrates?
Die wichtigsten zeitgenössischen Berichte stammen von seinen Schülern Platon und Xenophon, die den Prozessverlauf und die Verteidigungsrede (Apologie) überliefert haben.
- Arbeit zitieren
- André Jucht (Autor:in), 2004, Der Prozess gegen Sokrates, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50338