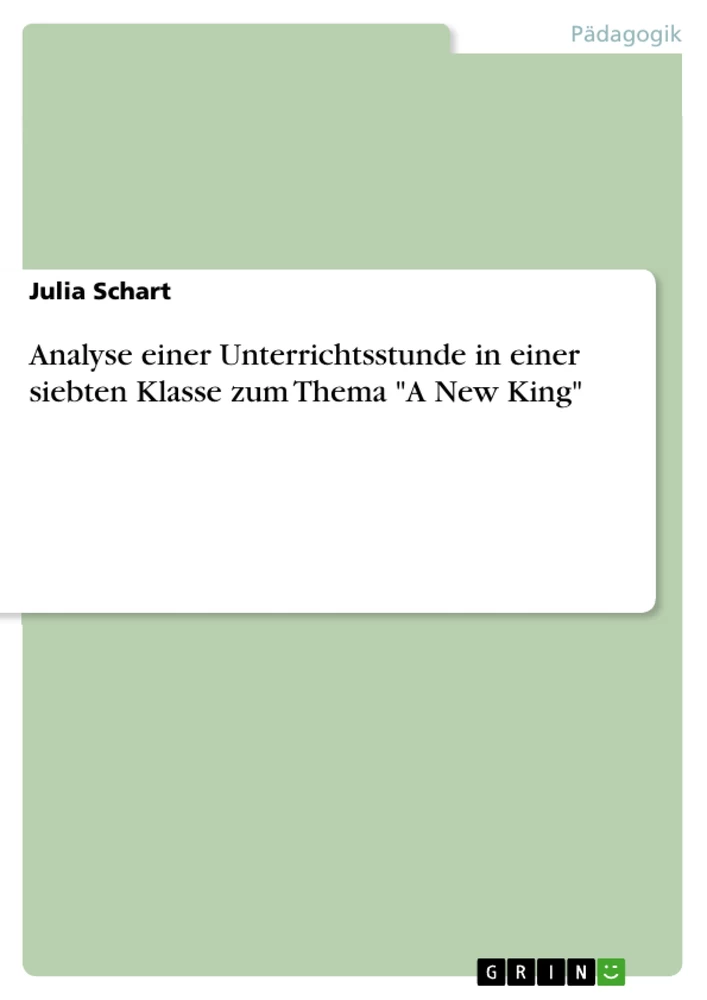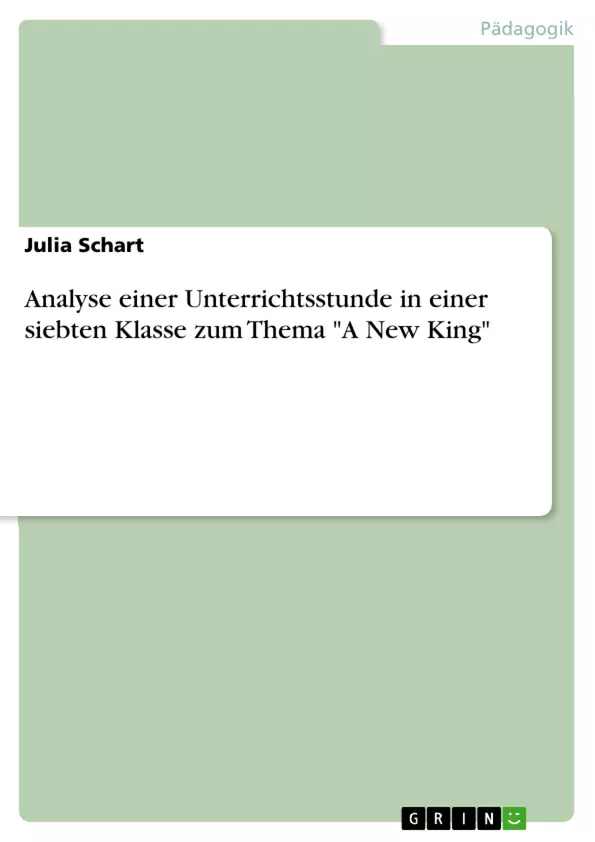In dieser Arbeit wird die Unterrichtsstunde zum Thema "King Arthur", die von der Autorin in einer siebten Klasse einer Realschule gehalten wurde, analysiert. Im Rahmen des studienbegleitenden Praktikums im Fach Englisch, ging es hierbei darum, kontinuierlich alle zwei bis drei Wochen erste Erfahrungen als Lehrkörper in der direkten Interaktion mit einer Klasse zu sammeln.
Zuallererst gilt es die Frage zu klären, auf welche Art und Weise dem Schüler ein Lehrbuchtext am interessantesten und vor allem am effektivsten näher gebracht werden kann. Hierbei muss man beachten, um welche Art von Text es sich handelt. Im Allgemeinen werden beispielsweise Dialoge oft mit verteilten Rollen gelesen, Berichte oder Reportagen meist nur für sich selbst und Sagen oder epische Texte in erzählerischer Form präsentiert. Zudem konnte die Klasse bereits in der Woche zuvor bei diversen Gruppenarbeiten ihr Leseverständnis unter Beweis stellen, daher lag es nahe diesmal verstärkt auf die Decodierung von auditiven Informationen zu setzen.
Da der unbekannte Text um König Arthur zunächst relativ lang erscheint, ist es zwingend notwendig sinntragende Wörter vorab zu erklären. Dabei handelt es sich um Begriffe, die völlig unbekannt sind, um Vokabular, welches für das zusammenhängende sinngemäße Textverständnis absolut unumgänglich ist oder um Wörter, die nicht vom Kontext her erschließbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- Klassen- und Unterrichtssituation
- Sachanalyse
- Lernziele
- Didaktisch-methodische Analyse
- Unterrichtsplanung
- Wissenschaftlich reflektierte Analyse
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse einer Unterrichtsstunde zum Thema "A New King" aus dem Lehrbuch "Eastwood" (28) befasst sich mit dem Einsatz einer Hörverstehensübung im Englischunterricht der siebten Jahrgangsstufe. Ziel der Stunde ist es, den Schülern den englischen Text "A New King" zu erschließen und ihnen die Möglichkeit zu geben, wichtige Informationen zu extrahieren und in kommunikativen Situationen zu verarbeiten. Dies beinhaltet den Erwerb neuer Vokabeln und das Training des Hörverstehens. Der Fokus liegt auf der didaktisch-methodischen Gestaltung der Stunde, wobei die Integration von spielerischen Elementen und aktiver Beteiligung der Schüler im Vordergrund steht.
- Erschließung des englischen Textes "A New King"
- Training des Hörverstehens und der Hörtextanalyse
- Vokabelerwerb und Erweiterung des Wortschatzes
- Aktive und interaktive Beteiligung der Schüler
- Spielerische Umsetzung der Unterrichtsinhalte
Zusammenfassung der Kapitel
Klassen- und Unterrichtssituation
Der Unterrichtsversuch fand am 2. Dezember 2009 an einer Realschule in der siebten Jahrgangsstufe statt. Die Klasse besteht aus 32 Schülern, davon 26 Jungen und 6 Mädchen, wobei vier Schüler an Legasthenie leiden. Die Stunde diente dazu, erste Erfahrungen als Lehrkraft in der direkten Interaktion mit einer Klasse zu sammeln. Die Schüler waren bereits mit der Thematik König Arthur und seinen Legenden vertraut, da sie sich in der vorherigen Woche in Gruppenarbeiten mit der Materie auseinandergesetzt hatten.
Sachanalyse
Der Text "A New King" erzählt die Geschichte von König Arthur, der sein Schwert in einem Stein findet und damit seine Vorbestimmung als König von Großbritannien erfährt. Der Text ist in der siebten Jahrgangsstufe als spielerisches Mittel geeignet, um den Schülern alte Märchen und Sagen näherzubringen.
Lernziele
Die Unterrichtsstunde zielte auf den Erwerb neuer Wörter und eine Erweiterung des Vokabulars, das gezielte Herausfiltern von Informationen aus dem Text und die Verarbeitung der Informationen in kommunikativen Situationen ab. Die Stunde sollte den Schülern auf spielerische Weise den Text zugänglich machen und sie gleichzeitig mit dem Hörverstehenstraining vertraut machen.
Schlüsselwörter
Die Analyse der Unterrichtsstunde verwendet Schlüsselbegriffe wie "Hörverstehen", "Vokabelerwerb", "Didaktik", "Methoden", "Spiele", "Interaktion", "Schülerbeteiligung" und "Englischunterricht". Der Fokus liegt auf der didaktisch-methodischen Gestaltung einer Englischstunde und der Einbindung von Hörverstehen und Vokabeltraining.
Häufig gestellte Fragen
Welches Thema behandelt die analysierte Englischstunde?
Die Unterrichtsstunde befasst sich mit der Legende von König Arthur anhand des Textes „A New King“.
Für welche Klassenstufe ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Entwurf ist für eine siebte Klasse an einer Realschule ausgelegt.
Was ist das Hauptlernziel der Stunde?
Hauptziele sind die Erschließung des Textes, das Training des Hörverstehens sowie der Erwerb neuer Vokabeln.
Warum werden Vokabeln vor der Hörverstehensübung erklärt?
Wichtige, sinntragende Wörter müssen vorab geklärt werden, damit die Schüler dem auditiven Text folgen und den Inhalt verstehen können.
Welche methodischen Elemente werden eingesetzt?
Die Stunde integriert spielerische Elemente, Hörverstehensübungen und interaktive Aufgaben zur Förderung der Schülerbeteiligung.
Wie wird mit heterogenen Lerngruppen (z. B. Legasthenie) umgegangen?
Die Analyse berücksichtigt die Klassensituation, zu der auch Schüler mit Legasthenie gehören, und passt die Methoden entsprechend an.
- Arbeit zitieren
- Julia Schart (Autor:in), 2009, Analyse einer Unterrichtsstunde in einer siebten Klasse zum Thema "A New King", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503422