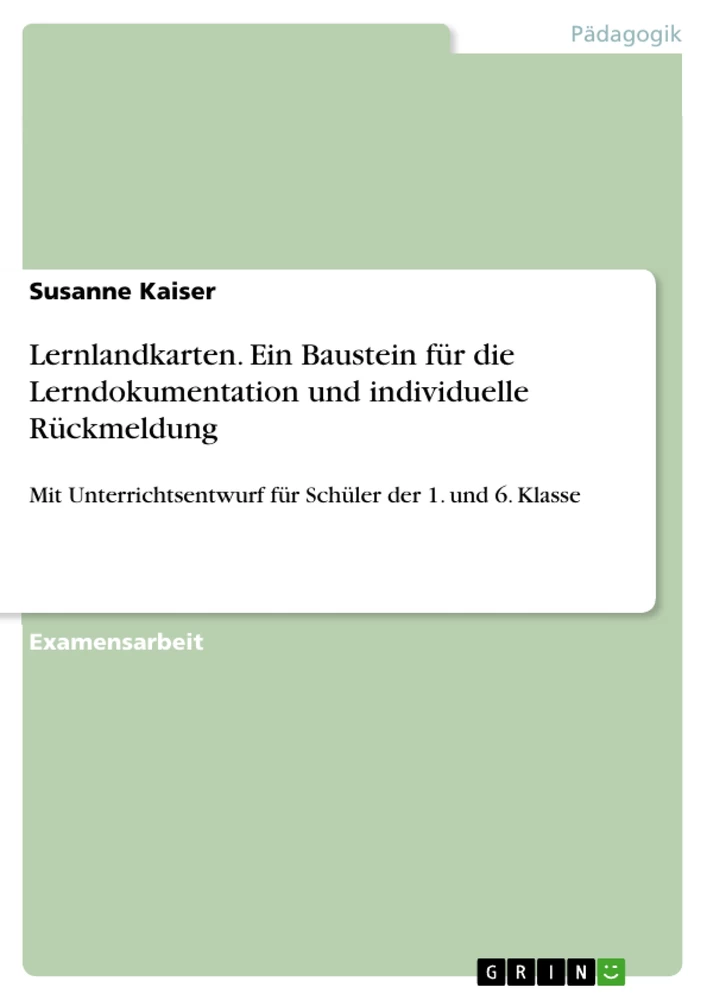Während meiner Vertretungslehrerzeit wurde ich zum ersten Mal mit einer Lernlandkarte konfrontiert und war sofort beeindruckt. Eine Kollegin führte die Methode in ihrer damals 3. Klasse ein. Das hohe Maß an Selbstorganisation, Kreativität und Individualität der entstandenen Karten motivierte mich in einen intensiven kollegialen Austausch zu gehen. Dabei wurde mir zunehmend bewusst, welches Potential bezüglich der Transparenz der individuellen Lernprozesse und der entsprechenden Lehrerrückmeldungen in dieser Methode stecken.
Diese sehr intensiven und schönen Erfahrungen haben mich motiviert, mein fragmentiertes theoretisches Wissen aufzuarbeiten. Dabei stehen die Erweiterung meiner Methodenkompetenz sowie das Bedürfnis, meinen SuS aus meiner Prüfungsklasse, eine neue offene Lernform im Unterricht anzubieten, unter anderem im Mittelpunkt dieser Aufarbeitung. Darüber hinaus sehe ich das hohe Potential der Lernlandkarten für die individuelle Rückmeldung außerhalb der standardisierten Notengebung.
Ich schreibe derzeit die Gutachten meiner 6. Klasse für das Ü7- Verfahren. Die Kategorisierung der Schüler in Nummern frustriert mich in den letzten Tagen zunehmend, da sie dem Maß an individuellen Fähig- und Fertigkeiten überhaupt nicht gerecht werden können. Ich erhoffe mir durch die intensive Auseinandersetzung im Rahmen dieser Arbeit eine Erweiterung meiner Bewertungskompetenz.
Die Lernlandkarte ist nach Wildt ein "kognitive[s] Netzwerk einer Person von einem bestimmten Lerngegenstand". Er bezeichnet diese Methode des selbstorganisierten Lernens als Sonderform der "concept map", die Lernende und Lehrende dabei unterstützt, sich in den individuellen Lernprozessen besser orientieren zu können. Dabei entsteht laut Olling ein Dialog, der Einsichten über die Auseinandersetzung und das Durchdringen des Lernenden mit dem Lernstoff sowie der Selbstwahrnehmung ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Methode der Lernlandkarte
- 2.1 Begriff und Metapher
- 2.2 Formen und Funktionen von Lernlandkarten
- 2.3 Möglichkeiten von Lernlandkarten
- 2.4 Einsatz in der Schule
- 3. Lernlandkarten in der Grundschule
- 3.1 Weltallkarten in Klasse 1
- 3.1.1 Voraussetzungen der Erstklässler
- 3.1.2 Form der Lernlandkarte - Weltall
- 3.1.3 Einführung der LLK - Weltall
- 3.1.4 Ziele für den Unterricht der Klasse 1
- 3.1.5 Zusammenfassung und Ausblick: Beitrag zur Lerndokumentation und individuellen Rückmeldung in der 1. Klasse
- 3.2 Themen-Lernlandkarten in Klasse 6
- 3.2.1 Voraussetzungen der Sechstklässler
- 3.2.2 Form der Lernlandkarte
- 3.2.3 Einführung der Themen-Lernlandkarte
- 3.2.4 Ziele für den Unterricht Klasse 6
- 3.2.5 Zusammenfassung und Ausblick: Beitrag zur Lerndokumentation und individuellen Rückmeldung in der 6. Klasse
- 4. Zusammenfassung
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Potential von Lernlandkarten für die Lerndokumentation und individuelle Rückmeldung im Unterricht. Die Autorin beschreibt ihre positiven Erfahrungen mit dieser Methode und analysiert ihren Einsatz in der Grundschule (Klasse 1 und 6). Ziel ist die Erweiterung der Methodenkompetenz der Autorin und die Entwicklung einer offenen Lernform, die der individuellen Förderung der Schüler dient und alternative Bewertungsansätze ermöglicht.
- Lernlandkarten als Methode der Lerndokumentation
- Individuelle Rückmeldung und Förderung durch Lernlandkarten
- Einsatz von Lernlandkarten in unterschiedlichen Klassenstufen
- Vergleich verschiedener Formen von Lernlandkarten
- Lernlandkarten als Alternative zur standardisierten Notengebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehungsgeschichte des Interesses der Autorin an Lernlandkarten, ausgehend von positiven Erfahrungen im Unterricht. Sie hebt die Vorteile der Methode hinsichtlich Selbstorganisation, Kreativität und individueller Lernförderung hervor und benennt die Motivation, diese Methode näher zu untersuchen und in der eigenen Praxis einzusetzen. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Lerndokumentation und der individuellen Rückmeldung, insbesondere als Alternative zu standardisierten Noten.
2. Die Methode der Lernlandkarte: Dieses Kapitel erläutert den Begriff und die Metapher der Lernlandkarte. Es wird der Zusammenhang mit „concept maps“ und „mind maps“ hergestellt und die Bedeutung für individuelles Lernen und die Berücksichtigung von Heterogenität im Unterricht betont. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit individueller Lernwege und -leistungen sowie die Rolle der Lernlandkarte als Werkzeug zur Visualisierung und Strukturierung dieser Prozesse. Die Bedeutung individueller Rückmeldungen und der Abkehr von sozialen Bezugsnorm wird hervorgehoben.
3. Lernlandkarten in der Grundschule: Dieses Kapitel beschreibt den praktischen Einsatz von Lernlandkarten in der 1. und 6. Klasse. Es werden die jeweiligen Voraussetzungen der Schüler, die Form der Lernlandkarten, die Einführung der Methode und die didaktischen Ziele detailliert dargestellt. Die Kapitel 3.1 und 3.2 analysieren jeweils den konkreten Einsatz in den unterschiedlichen Klassenstufen und beleuchten die spezifischen Herausforderungen und Erfolge. Der Fokus liegt auf dem Beitrag der Lernlandkarten zur Lerndokumentation und individuellen Rückmeldung.
Schlüsselwörter
Lernlandkarten, Lerndokumentation, individuelle Rückmeldung, individuelle Förderung, Heterogenität, Grundschule, Klassenstufe 1, Klassenstufe 6, Selbstorganisation, Kreativität, alternative Bewertung, concept map, mind map, individuelle Bezugsnorm.
Häufig gestellte Fragen zu "Lernlandkarten in der Grundschule"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einsatz von Lernlandkarten in der Grundschule (Klasse 1 und 6) zur Lerndokumentation und individuellen Rückmeldung. Sie analysiert das Potential dieser Methode zur individuellen Förderung von Schülern und als Alternative zu standardisierten Noten.
Welche Methoden werden in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Methode der Lernlandkarte im Detail. Es werden die verschiedenen Formen und Funktionen von Lernlandkarten erläutert und der Zusammenhang mit "concept maps" und "mind maps" hergestellt. Der Fokus liegt auf dem praktischen Einsatz in der Grundschule, inklusive der Einführung und Umsetzung in verschiedenen Klassenstufen.
Welche Klassenstufen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Einsatz von Lernlandkarten in der 1. und 6. Klasse der Grundschule. Für jede Klassenstufe werden die spezifischen Voraussetzungen der Schüler, die Form der Lernlandkarte, die Einführung der Methode und die didaktischen Ziele detailliert dargestellt.
Welche Ziele werden mit Lernlandkarten verfolgt?
Die Arbeit untersucht Lernlandkarten als Methode zur Verbesserung der Lerndokumentation und zur Bereitstellung individueller Rückmeldungen. Es geht um die individuelle Förderung der Schüler, die Berücksichtigung von Heterogenität im Unterricht und die Entwicklung alternativer Bewertungsansätze abseits der standardisierten Notengebung. Die Selbstorganisation und Kreativität der Schüler sollen gefördert werden.
Welche Vorteile bieten Lernlandkarten laut der Arbeit?
Laut der Arbeit bieten Lernlandkarten Vorteile hinsichtlich Selbstorganisation, Kreativität und individueller Lernförderung. Sie ermöglichen eine Visualisierung und Strukturierung individueller Lernprozesse und unterstützen die individuelle Bezugsnorm anstatt der sozialen Bezugsnorm. Sie dienen als Alternative zur standardisierten Notengebung.
Wie werden Lernlandkarten in der 1. Klasse eingesetzt?
In der 1. Klasse werden Weltallkarten als Lernlandkarten eingesetzt. Die Arbeit beschreibt die Voraussetzungen der Erstklässler, die Form der Weltallkarte, ihre Einführung im Unterricht, die Lernziele und die Zusammenfassung des Einsatzes mit Blick auf Lerndokumentation und individuelle Rückmeldung.
Wie werden Lernlandkarten in der 6. Klasse eingesetzt?
In der 6. Klasse werden Themen-Lernlandkarten eingesetzt. Die Arbeit beschreibt die Voraussetzungen der Sechstklässler, die Form der Lernlandkarten, ihre Einführung im Unterricht, die Lernziele und die Zusammenfassung des Einsatzes mit Blick auf Lerndokumentation und individuelle Rückmeldung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lernlandkarten, Lerndokumentation, individuelle Rückmeldung, individuelle Förderung, Heterogenität, Grundschule, Klassenstufe 1, Klassenstufe 6, Selbstorganisation, Kreativität, alternative Bewertung, concept map, mind map, individuelle Bezugsnorm.
- Quote paper
- Susanne Kaiser (Author), 2018, Lernlandkarten. Ein Baustein für die Lerndokumentation und individuelle Rückmeldung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504392