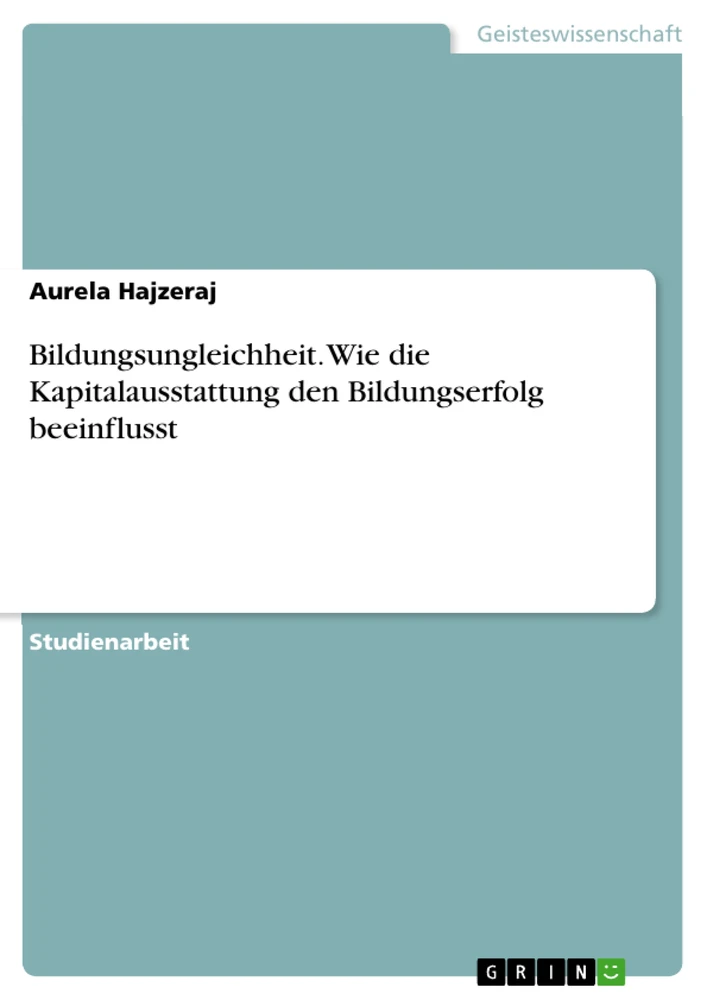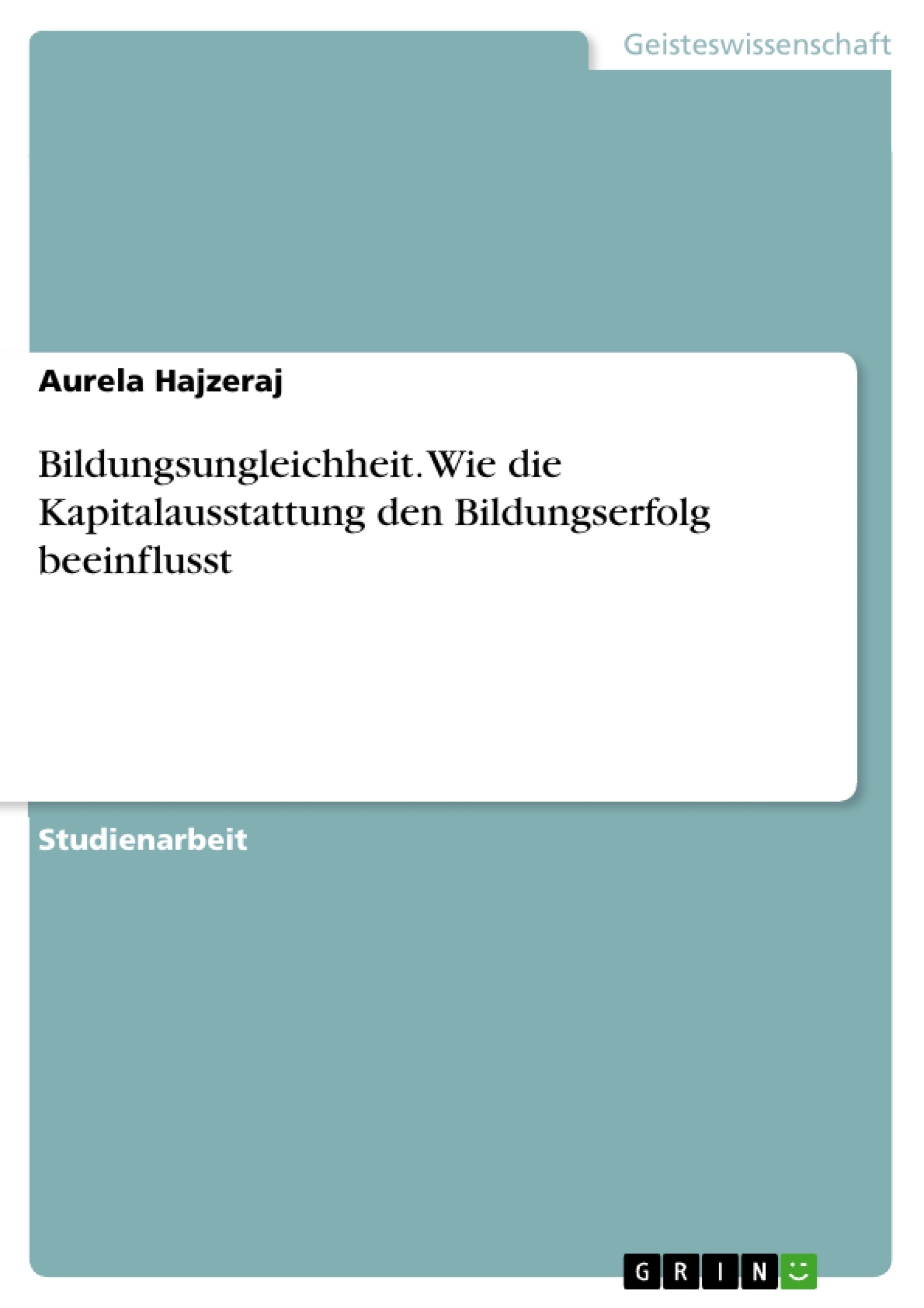Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst. Trotz der vermeintlichen Chancengleichheit in Schulen hängt der Bildungserfolg noch von weiteren Faktoren ab. Der Zugang zu Bildung ist nicht immer uneingeschränkt. Zum einen ist das Bildungsniveau der Herkunftsfamilie ein wichtiger Indikator für die schulische Lauf- und Bildungsbahn einer Person. Laut dem Bildungsbericht der Bundesregierung von 2018 besteht im Allgemeinen ein Trend zur Höherqualifizierung.
Neben dem Bildungsniveau der Eltern, stellt die Region in der man aufgewachsen ist, einen wichtigen Aspekt dar. Wo heute zumeist eine gute Infrastruktur zwischen ländlichen und städtischen Gebieten vorherrscht, war es früher für die meisten Kinder kaum möglich eine Schule in der Stadt zu besuchen. Dort war das Angebot an weiterführenden Schulen und Hochschulen jedoch größer. So hat man während der Bildungskampagne in den 60er Jahren herausgefunden, dass Kinder aus ländlichen Regionen seltener höhere Schulen besucht haben, als solche aus der Stadt. Neben der Erreichbarkeit waren auch die Erwerbschancen unterschiedlich, wobei hohe Qualifikationen eher in der Stadt als auf dem Land gesucht wurden und somit die Bildungsaspiration für letztere deutlich geringer war. Neben dem Bildungsniveau, der Region und des Einkommens, spielt die ethnische Herkunft eine entscheidende Rolle im Bildungsprozess und beeinflusst die Bildungschancen meist negativ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Bildungsungleichheit
- Soziale Herkunft
- Ursachen von Bildungsungleichheit
- Bildungsniveau der Familie
- Einkommen
- Regionale Disparitäten
- Ethnische Herkunft
- Kapitalsorten nach Bourdieu
- Kapitalsorten
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Kapitalumwandlung
- Kapitalsorten
- Bildungsungleichheit aufgrund sozialer Herkunft?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der Kapitalausstattung auf den Bildungserfolg und setzt sich mit dem Phänomen der Bildungsungleichheit auseinander. Sie betrachtet die verschiedenen Faktoren, die zu Ungleichheiten im Bildungssystem führen und hinterfragt, inwiefern die soziale Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst.
- Definition von Bildungsungleichheit und sozialer Herkunft
- Analyse der Ursachen von Bildungsungleichheit
- Erläuterung der Kapitalsorten nach Bourdieu und deren Einfluss auf Bildungschancen
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsungleichheit
- Bedeutung der Bildungsinstitutionen für die Entstehung und Bewältigung von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Bildungsungleichheit im deutschen Bildungssystem dar und erläutert die Relevanz der Thematik. In Kapitel 2 werden die verwendeten Begriffsdefinitionen von Bildungsungleichheit und sozialer Herkunft präzisiert. Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Ursachen von Bildungsungleichheit, darunter das Bildungsniveau der Familie, das Einkommen, regionale Disparitäten und die ethnische Herkunft. Kapitel 4 führt die Kapitalsorten nach Bourdieu ein und untersucht deren Rolle bei der Entstehung von Bildungsungleichheit. Kapitel 5 diskutiert die Frage, ob Bildungsungleichheit direkt auf die soziale Herkunft zurückzuführen ist.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungserfolg, Kapital, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, Bourdieu, Bildungssystem, Deutschland, Chancengleichheit, Bildungsexpansion, PISA-Studie.
- Quote paper
- Aurela Hajzeraj (Author), 2018, Bildungsungleichheit. Wie die Kapitalausstattung den Bildungserfolg beeinflusst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504485