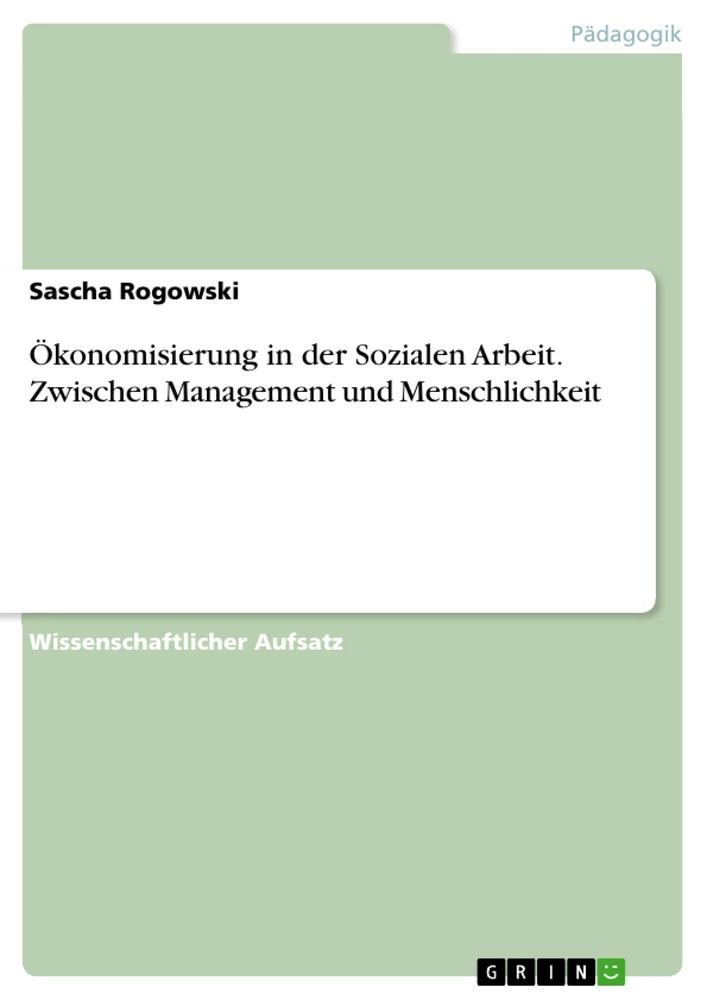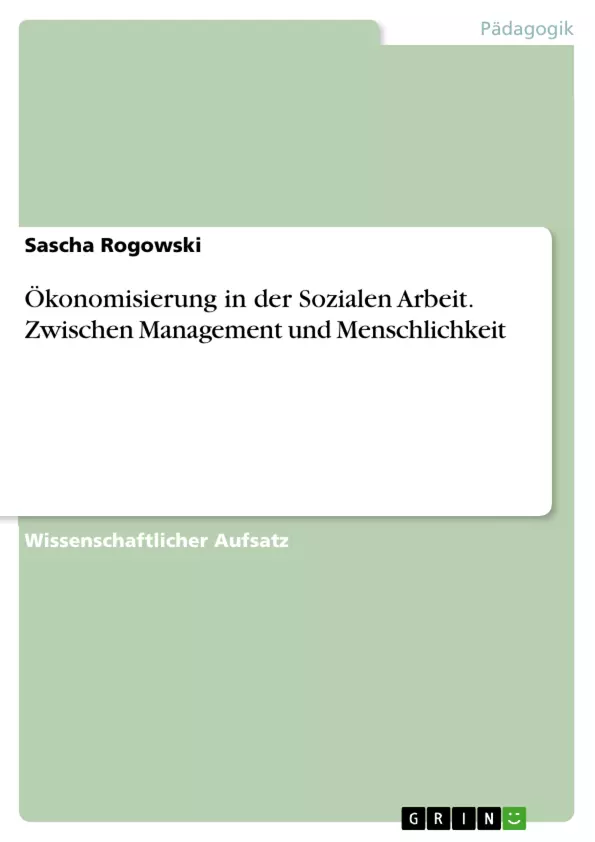Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die das ökonomische Denken auf die Soziale Arbeit ausübt. Dabei wird die folgende Frage beantwortet: Wie wird die Soziale Arbeit durch das ökonomische Denken beeinflusst? Nach einer kurzen Einführung in die Problematik werden These und Antithese diskutiert. Als methodische Unterstützung wird das Sanduhrprinzip verwendet. Es werden verschiedene Argumente zur Begründung der Antithese und These erörtert, diskutiert und einander gegenübergestellt.
Die Soziale Arbeit bewegt sich heutzutage in veränderten Bedingungen und setzt sich mit neuen Herausforderungen auseinander. Neoliberale und neosoziale Entwicklungen in der Sozialen Arbeit beeinflussen nicht nur ihre Ausprägung, sondern auch deren Wahrnehmung seitens der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund wird die Möglichkeit einer Vereinbarung der Sozialen Arbeit und der Managementprinzipien kritisch hinterfragt, was heute im Mittelpunkt von vielen sozialwissenschaftlichen Diskussionen steht. Es wird analysiert, ob Managementprinzipien in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden können und sollen. Dabei werden verschiedene Argumente gebracht, vor allem in Bezug auf die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und deren Folgen. Trotz der zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Problematik steht immer noch in Frage, auf welche Weise eine Balance zwischen der Berücksichtigung von grundlegenden Managementaspekten und der Förderung von Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit gefunden werden kann.
Die Soziale Arbeit hat einen Doppelauftrag und balanciert zwischen Hilfe und Kontrolle: einerseits soll sie den Menschen Hilfe und Unterstützung leisten, während sie andererseits die Gesellschaft vor jenen Menschen schützen soll, die in einer Notlage gegen gesellschaftliche Konventionen verstoßen. In ihrem aktuellen Verständnis ist die Soziale Arbeit berufen, den sozialen Wandel zu fördern und das Wohlbefinden von Menschen zu verbessern. So gehören zu den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit nicht nur die Sozial- und Jugendhilfe, sondern auch das Gesundheitswesen sowie die Alten- und Eingliederungshilfe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit zwischen Hilfe und Kontrolle
- Theoretische Auseinandersetzung
- Soziale Arbeit und das ökonomische Denken: Einführung in die Problematik
- Kritik der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
- Wohlverstandene Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des ökonomischen Denkens auf die Soziale Arbeit. Das Ziel besteht darin, die Auswirkungen des ökonomischen Denkens auf die Praxis der Sozialen Arbeit zu erforschen. Die Forschungsfrage lautet: Wie wird die Soziale Arbeit durch das ökonomische Denken beeinflusst?
- Die Auswirkungen des ökonomischen Denkens auf die Soziale Arbeit.
- Die Rolle des ökonomischen Denkens in der Gestaltung von Sozialpolitik.
- Die Bedeutung ethischer und menschenrechtlicher Prinzipien in der Sozialen Arbeit.
- Die Herausforderung, eine Balance zwischen ökonomischen und sozialen Bedürfnissen zu finden.
- Die Frage nach der Nachhaltigkeit und Effizienz in der Sozialen Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die beiden Thesen (positiver und negativer Einfluss des ökonomischen Denkens) vor. Der Aufbau der Arbeit wird erläutert.
- Soziale Arbeit zwischen Hilfe und Kontrolle: Dieses Kapitel beleuchtet das Wesen der Sozialen Arbeit als Theorie, Praxis, Beruf und gesellschaftliches Subsystem. Es wird auf die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen eingegangen.
Schlüsselwörter
Ökonomisierung, Soziale Arbeit, Managementprinzipien, Neoliberalismus, Neosoziales, Hilfe und Kontrolle, soziale Ungleichheit, Prekarisierung, gesellschaftliche Spaltung, soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst ökonomisches Denken die Soziale Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Managementprinzipien und wirtschaftliche Effizienz zunehmend die Praxis und Wahrnehmung der Sozialen Arbeit prägen.
Was ist der „Doppelauftrag“ der Sozialen Arbeit?
Soziale Arbeit steht im Spannungsfeld zwischen Hilfe für das Individuum und Kontrolle im Sinne der gesellschaftlichen Konventionen.
Welche Kritik gibt es an der Ökonomisierung?
Kritiker befürchten, dass durch den Fokus auf Kosten und Management die Menschlichkeit und die eigentlichen sozialen Aufgaben in den Hintergrund rücken.
Was bedeutet „neoliberale Entwicklung“ in diesem Kontext?
Es bezeichnet den Trend, soziale Dienstleistungen nach Marktprinzipien zu organisieren, was zu Prekarisierung und gesellschaftlicher Spaltung führen kann.
Kann man Management und Soziale Arbeit vereinbaren?
Die Arbeit diskutiert, wie eine Balance zwischen notwendigen Managementaspekten und der Förderung des Wohlbefindens der Menschen gefunden werden kann.
- Arbeit zitieren
- Sascha Rogowski (Autor:in), 2018, Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit. Zwischen Management und Menschlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504855