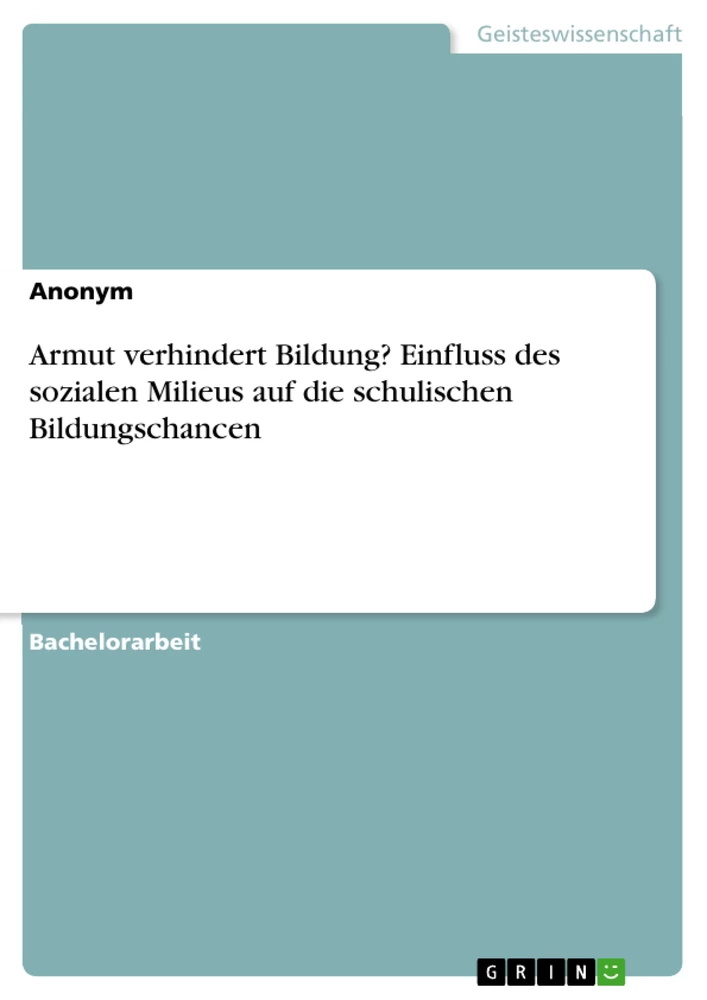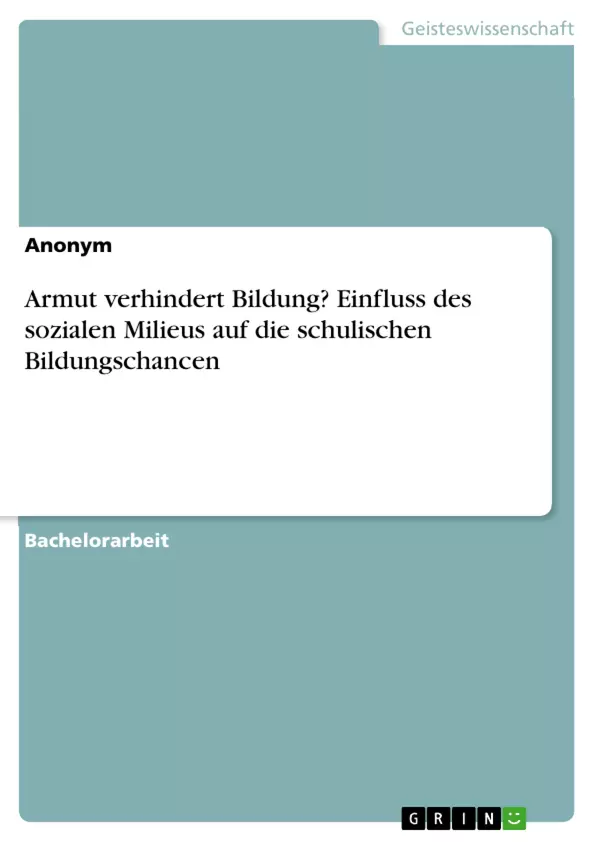Diese Bachelorarbeit widmet sie sich der Fragestellung, ob, und inwieweit, das soziale Milieu, sowie die Armutslagen von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik, Bildungschancen nachhaltig prägt. Dabei wird der eben getätigten Annahme - jedes Individuum habe eine Chance auf Bildung - nach der deutschen Gesetzeslage, nachgegangen.
Nach der Bestimmung wichtiger Grundlagen und der Definition relevanter Begriffe wird die Theorie von Pierre Bourdieu vorgestellt, die die Basis der Arbeit bilden. Darauf aufbauend werden Faktoren, welche Bildungschancen beeinflussen, untersucht. Das soziale Milieu und dessen Einfluss auf die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern werden dann genauer betrachtet.
Hier ein kleines Gedankenexperiment: Sie sind Lehrkraft an einer beliebigen Grundschule. Im Rahmen des Sachunterrichts in Klasse 3 behandeln Sie das Thema Berufe. Alle Kinder dieser heterogenen Lerngruppe erhalten den Auftrag ihren Traumberuf auf ein Blatt Papier zu malen oder zu schreiben. Am Ende der Unterrichtseinheit stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse kurz und präzise der Klasse vor. Die Kinder haben klare und sehr unterschiedliche Traumberufe. Tierärztin, Fußballspielerin, Polizistin, Krankenpfleger, Lehrer, Pilotin und "Chefin" sind die Berufe, welche am häufigsten von den Schülerinnen und Schülern Ihrer Klasse genannt werden. Sie als Lehrkörper erklären den Kindern daraufhin - nach dem Motto "from rags to riches" - dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man nur hart genug dafür kämpft und die Schülerinnen und Schüler demnach später jeden Beruf ausüben können, den sie möchten. Stimmt das?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Bildung
- Bildungschance
- Soziale Ungleichheit
- Soziales Milieu
- Armut
- Absolute Armut
- Relative Armut
- Ressourcenansatz
- Lebenslagenansatz
- Bourdieus Theorie zu den Ursachen sozialer Ungleichheit
- Kapitalsorten
- Habitus
- Der soziale Raum
- Bildungsungleichheit im Bildungswesen
- Einflussgrößen von Bildungschancen
- Ökonomische Einflussgrößen
- Haushaltsnettoeinkommen
- Verfügbarer Wohnraum
- Zwischenfazit der ökonomischen Einflussgrößen
- Soziale Einflussgrößen
- Sozialisation im Elternhaus
- Soziale Netzwerke
- Zwischenfazit der sozialen Einflussgrößen
- Kulturelle Einflussgrößen
- Familie als Bildungsort
- Bildungs- und Berufsstand der Eltern
- Qualität von Bildungseinrichtungen
- Zwischenfazit der kulturellen Einflussgrößen
- Ökonomische Einflussgrößen
- Zusammenhang: soziales Milieu, Armut und Bildungschancen
- Zusammenhang: Bildungschancen und hoher Kapitalbesitz
- Zusammenhang: Bildungschancen und geringer Kapitalbesitz
- Zusammenhang: soziales Milieu und Bildungschancen
- Zusammenhang: Armut und Bildungschancen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss des sozialen Milieus auf die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern. Sie beleuchtet die Frage, inwieweit Armut die Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Die Arbeit analysiert die Ursachen sozialer Ungleichheit anhand der Theorie Pierre Bourdieus und untersucht verschiedene Einflussfaktoren auf Bildungschancen, wie ökonomische, soziale und kulturelle Faktoren.
- Soziale Ungleichheit und Bildungschancen
- Armut als Hindernis für Bildung
- Einfluss des sozialen Milieus auf Bildungschancen
- Bourdieus Theorie des Kapitals und Habitus
- Ökonomische, soziale und kulturelle Einflussfaktoren auf Bildungschancen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von sozialer Ungleichheit und dem Einfluss von Armut auf Bildungschancen dar. Sie erläutert die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Bildung, Bildungschance, soziale Ungleichheit und soziales Milieu.
- Armut: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Armutsformen, wie absolute Armut und relative Armut, und erklärt verschiedene Ansätze zur Definition von Armut.
- Bourdieus Theorie zu den Ursachen sozialer Ungleichheit: Dieses Kapitel stellt Bourdieus Theorie zur Erklärung sozialer Ungleichheit vor, wobei die Konzepte Kapital, Habitus und sozialer Raum im Vordergrund stehen.
- Einflussgrößen von Bildungschancen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Faktoren, die Bildungschancen beeinflussen, unterteilt in ökonomische, soziale und kulturelle Einflussgrößen.
- Zusammenhang: soziales Milieu, Armut und Bildungschancen: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen dem sozialen Milieu, Armut und Bildungschancen, insbesondere in Bezug auf Bourdieus Kapitaltheorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Bildung, Bildungschance, soziale Ungleichheit, soziales Milieu, Armut, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales), Habitus, Bourdieu, Bildungsungleichheit, Einflussfaktoren auf Bildungschancen, ökonomische Einflussgrößen, soziale Einflussgrößen, kulturelle Einflussgrößen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Armut verhindert Bildung? Einfluss des sozialen Milieus auf die schulischen Bildungschancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504868