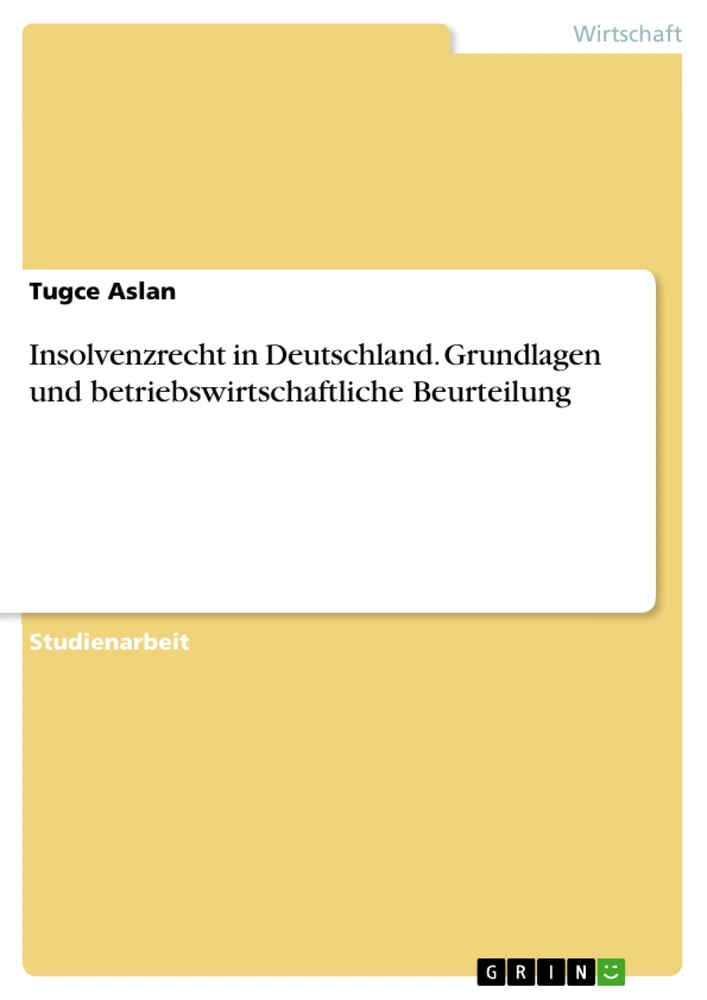Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Insolvenzrecht in Deutschland. Neben den Grundzügen des Insolvenzrechts soll im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beurteilung die Arbeit abgerundet werden. Der Schwerpunkt der betriebswirtschaftlichen Beurteilung liegt in dieser Arbeit dabei hauptsächlich auf den Eröffnungsgründen des Insolvenzverfahrens.
Im zweiten Kapitel wird zunächst auf die Geschichte des Insolvenzrechts eingegangen, sowie die Verfahrensziele des Insolvenzverfahrens genauer erläutert. Im dritten Kapitel soll dann der typische Ablauf eines (Regel-)Insolvenzverfahrens dargestellt werden, wobei hier zwischen dem Eröffnungsverfahren, dem eröffneten Verfahren sowie der Beendigung des Verfahrens unterschieden wird. Im vorletzten Kapitel sollen als besondere Verfahren im Insolvenzrecht das Insolvenzplanverfahren sowie die Eigenverwaltung genauer betrachtet und kritisch beurteilt werden.
Zum Schluss erfolgt eine Schlussbetrachtung. Durch die vorliegende Arbeit soll vor allem auch deutlich gemacht werden, dass eine Insolvenz nicht immer gleich die Liquidation, sondern auch immer einen Neuanfang für das Unternehmen bedeuten kann. Das Verbraucherinsolvenzverfahren sowie die Restschuldbefreiung sind nicht Bestandteil dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Die Insolvenzordnung und ihre Verfahrensziele
- 3. Ablauf des (Regel-) Insolvenzverfahrens
- 3.1 Das Eröffnungsverfahren
- 3.1.1 Voraussetzungen für die Eröffnung
- 3.1.2 Die vorläufigen Sicherungsmaßnahmen
- 3.1.3 Entscheidung über den Antrag
- 3.2 Das eröffnete Verfahren
- 3.2.1 Wirkungen der Eröffnung
- 3.2.2 Befriedigung der Gläubiger
- 3.3 Beendigung des Verfahrens
- 4. Besondere Verfahrensarten nach der Insolvenzordnung
- 4.1 Das Insolvenzplanverfahren
- 4.2 Die Eigenverwaltung
- 4.3 Kritische Würdigung
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das deutsche Insolvenzrecht und seine betriebswirtschaftliche Relevanz. Der Fokus liegt auf den Eröffnungsgründen des Insolvenzverfahrens und der Darstellung verschiedener Verfahrensarten. Ziel ist es, die Entwicklung des Insolvenzrechts zu beleuchten und aufzuzeigen, dass Insolvenz nicht automatisch Liquidation bedeutet, sondern auch Chancen für einen Unternehmensneuanfang bieten kann.
- Entwicklung des Insolvenzrechts in Deutschland
- Verfahrensziele und -ablauf im Insolvenzverfahren
- Eröffnungsgründe des Insolvenzverfahrens (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung)
- Besondere Insolvenzverfahren (Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung)
- Betriebswirtschaftliche Beurteilung von Insolvenzverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Insolvenz ein und beschreibt die anfängliche negative Konnotation des Begriffs in Deutschland. Sie hebt die historische Entwicklung des Insolvenzrechts hervor, von der primär auf Liquidation ausgerichteten Konkursordnung hin zu einem Rechtssystem, das die Sanierung von Unternehmen und den Erhalt von Arbeitsplätzen stärker betont. Die Bedeutung des Zeitpunkts der Antragstellung und der Eröffnungsgründe (Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit) wird am Beispiel des Unternehmens Sin-Leffers illustriert, welches durch frühzeitige Antragstellung und ein Insolvenzplanverfahren gerettet werden konnte. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und fokussiert auf die betriebswirtschaftliche Beurteilung der Eröffnungsgründe.
2. Die Insolvenzordnung und ihre Verfahrensziele: Dieses Kapitel beleuchtet die Insolvenzordnung (InsO) von 1999 und ihre Ziele. Es diskutiert die Gründe für die Ablösung der alten Konkursordnung, vor allem die hohen Ablehnungsquoten aufgrund fehlender Masse und die niedrige Konkursquote. Die InsO führte das Ziel der Unternehmenssanierung neben der Liquidation ein, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Der Fokus liegt auf dem Wandel vom rein liquidatorischen Ansatz zu einem Ansatz, der auch die Sanierung und den Fortbestand von Unternehmen anstrebt.
3. Ablauf des (Regel-) Insolvenzverfahrens: Dieses Kapitel beschreibt den typischen Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens. Es unterteilt sich in das Eröffnungsverfahren (mit seinen Voraussetzungen, vorläufigen Sicherungsmaßnahmen und der Antragsentscheidung), das eröffnete Verfahren (mit seinen Wirkungen und der Gläubigerbefriedigung) und die Beendigung des Verfahrens. Es bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Phasen und die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte. Die Darstellung beleuchtet die verschiedenen Schritte und die jeweilige Bedeutung für die betroffenen Unternehmen und Gläubiger.
4. Besondere Verfahrensarten nach der Insolvenzordnung: Dieses Kapitel behandelt spezielle Verfahren im Insolvenzrecht, nämlich das Insolvenzplanverfahren und die Eigenverwaltung. Es analysiert die jeweiligen Verfahrensabläufe, Voraussetzungen und Möglichkeiten, und bietet eine kritische Würdigung der Vor- und Nachteile beider Verfahren. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Verfahren und ihrer Anwendung in der Praxis sowie auf der Analyse ihrer Effektivität im Hinblick auf die Unternehmensrettung und Gläubigerbefriedigung.
Schlüsselwörter
Insolvenzrecht, Insolvenzordnung, Unternehmenssanierung, Liquidation, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung, Eröffnungsgründe, Gläubigerbefriedigung, Betriebswirtschaftliche Beurteilung, Wirtschaftsstandort Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Deutsches Insolvenzrecht und seine betriebswirtschaftliche Relevanz
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das deutsche Insolvenzrecht und seine betriebswirtschaftliche Relevanz. Der Fokus liegt auf den Eröffnungsgründen des Insolvenzverfahrens und der Darstellung verschiedener Verfahrensarten. Ziel ist es, die Entwicklung des Insolvenzrechts zu beleuchten und aufzuzeigen, dass Insolvenz nicht automatisch Liquidation bedeutet, sondern auch Chancen für einen Unternehmensneuanfang bietet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Insolvenzrechts in Deutschland, die Verfahrensziele und den Ablauf im Insolvenzverfahren, die Eröffnungsgründe (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung), besondere Insolvenzverfahren (Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung) und die betriebswirtschaftliche Beurteilung von Insolvenzverfahren. Es wird der Wandel vom rein liquidatorischen Ansatz zu einem Ansatz, der auch die Sanierung und den Fortbestand von Unternehmen anstrebt, beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Thematik einführt und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel zur Insolvenzordnung und ihren Verfahrenszielen, zum Ablauf des Regelinsolvenzverfahrens (inklusive Eröffnungs-, eröffnetem Verfahren und Beendigung), zu besonderen Verfahrensarten (Insolvenzplanverfahren und Eigenverwaltung mit kritischer Würdigung) und schliesslich eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche besonderen Insolvenzverfahren werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Insolvenzplanverfahren und die Eigenverwaltung. Für beide Verfahren werden der Ablauf, die Voraussetzungen und die Möglichkeiten sowie eine kritische Würdigung der Vor- und Nachteile beschrieben. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Verfahren und ihrer Anwendung in der Praxis sowie auf der Analyse ihrer Effektivität im Hinblick auf die Unternehmensrettung und Gläubigerbefriedigung.
Was sind die Eröffnungsgründe eines Insolvenzverfahrens?
Die Eröffnungsgründe eines Insolvenzverfahrens sind Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Die Arbeit beleuchtet diese im Detail und zeigt deren betriebswirtschaftliche Relevanz auf.
Welche Ziele verfolgt die Insolvenzordnung (InsO)?
Die InsO von 1999 verfolgt das Ziel der Unternehmenssanierung neben der Liquidation, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Die Arbeit diskutiert die Gründe für die Ablösung der alten Konkursordnung, vor allem die hohen Ablehnungsquoten aufgrund fehlender Masse und die niedrige Konkursquote.
Wie wird der Ablauf des Regelinsolvenzverfahrens beschrieben?
Der Ablauf des Regelinsolvenzverfahrens wird in drei Phasen unterteilt: das Eröffnungsverfahren (mit Voraussetzungen, vorläufigen Sicherungsmaßnahmen und Antragsentscheidung), das eröffnete Verfahren (mit Wirkungen und Gläubigerbefriedigung) und die Beendigung des Verfahrens. Die Arbeit bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Phasen und die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Insolvenzrecht, Insolvenzordnung, Unternehmenssanierung, Liquidation, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung, Eröffnungsgründe, Gläubigerbefriedigung, Betriebswirtschaftliche Beurteilung, Wirtschaftsstandort Deutschland.
- Quote paper
- Tugce Aslan (Author), 2017, Insolvenzrecht in Deutschland. Grundlagen und betriebswirtschaftliche Beurteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505049