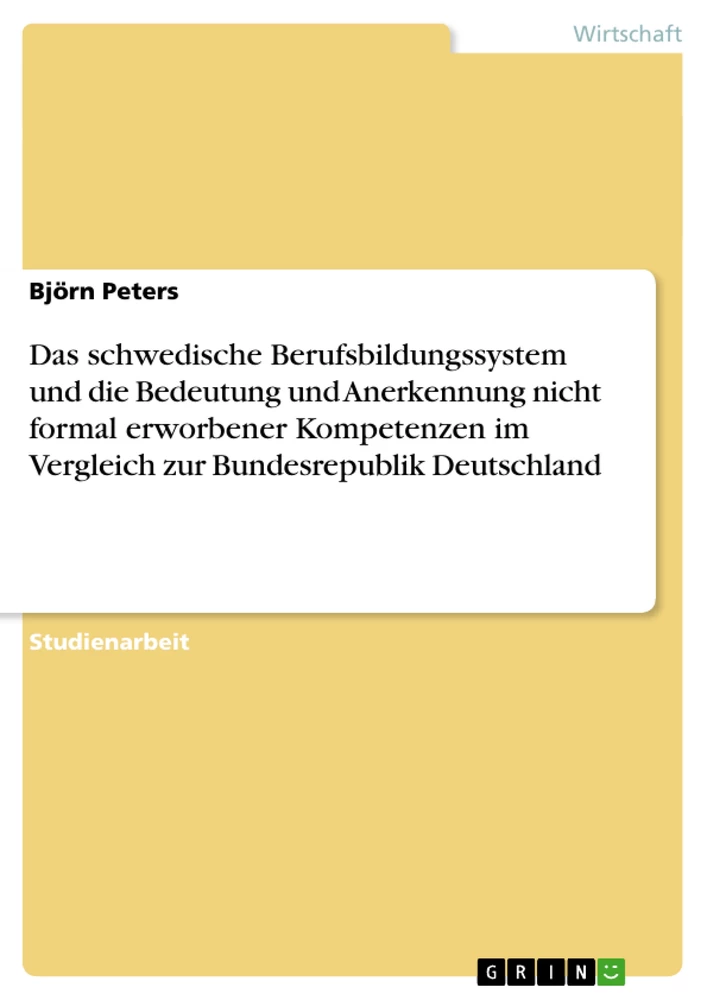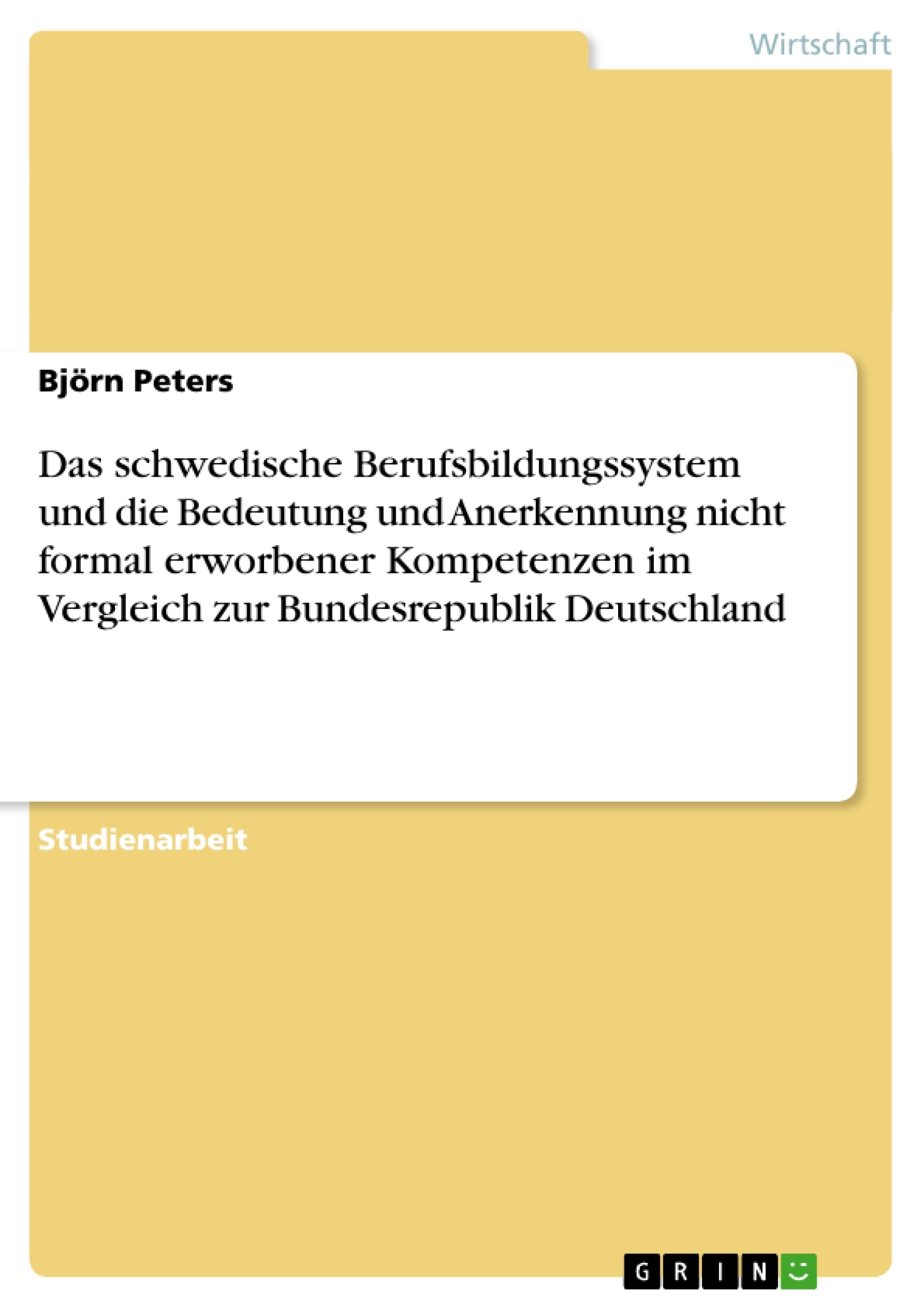In einer Zeit, die geprägt ist durch einen stetigen Wandel und der zunehmenden Bedeutung von Globalisierung, unterliegt unser Leben laufenden Veränderungen. Insbesondere die europäischen Länder rücken näher zusammen. Grenzen verlieren an Bedeutung, wirtschaftlich sowie auch kulturell. Demographische Verschiebungen, gesellschaftlicher Wertewandel, die Unbeständigkeit des Arbeitsmarktes, sowie neue Technologien haben starken Einfluss auf die berufliche und private Umwelt. Um diesen Anforderungen gewachsen zu sein, reicht das Wissen und Können der schulischen Bildung sowie der beruflichen Erstausbildung allein nicht aus. Permanentes Lernen und ständige Weiterbildung werden zur Notwendigkeit. Neue Kompetenzen werden in den verschiedensten Formen und an den unterschiedlichsten Orten erworben, organisiert in Veranstaltungen, aber auch beiläufig im Alltag.
Seit dem europäischen Jahr des lebenslangen Lernens 1996, gewinnt das Konzept des lebenslange Lernen zunehmend an Tragweite und erfährt verstärkt Berücksichtigung in politischen Diskussionen und Strategien. Die Definition des lebenslangen Lernens durch die EU ist jedoch weit gefasst, und so wird das Konzept in den Mitgliedstaaten nach länderspezifischen Vorstellungen unterschiedlich aufgefasst und umgesetzt. Ein wesentlicher Unterschied in den einzelnen Ländern besteht in der Wertung und Akzeptanz von nicht formal erworbenen Qualifikationen; etwa 70% der menschlichen Lernprozesse spielen sich nicht mehr in organisierten Bildungsveranstaltungen, sondern in der Lebens-, Arbeits- und Medienwelt ab.
Während in dem deutschen Bildungssystem über Jahre hinweg die formalen Bildungseinrichtungen den Mittelpunkt bilden, besteht in den skandinavischen Ländern eine lange Tradition der Volksschulen und Studienzirkel, durch die der Stellenwert von Fähigkeiten, die außerhalb des regulären Bildungssystems erworben werden, stark geprägt wird.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht daher das schwedische Berufsbildungssystem und die Bedeutung und Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen im Rahmen des lebenslangen Lernens. Hierbei sollen insbesondere die Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland bezüglich der Relevanz und Akzeptanz nicht formal erworbener Kompetenzen erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die schwedische Landesstruktur, Staatordnung und Wirtschaft
- Das schwedische Bildungssystem
- Allgemeine Merkmale
- Grundlegende Prinzipien
- Institutionelle Verantwortung
- Die Pflichtschulausbildung
- Die obere Sekundarstufe
- Die Hochschulbildung
- Die Erwachsenenbildung
- Allgemeine Merkmale
- Das schwedische Berufsbildungssystem
- Die berufliche Erstausbildung
- Die berufliche Weiterbildung
- Lebenslanges Lernen
- Die Entwicklung und die aktuelle Bedeutung
- Definition
- Zentrale Elemente des aktuellen Konzeptes lebenslangen Lernens
- Interpretation in Schweden
- Interpretation in Deutschland
- Einstellung der Bürger in Schweden und Deutschland
- Definition der unterschiedlichen Lernformen
- Vorraussetzungen für die Anerkennung nichtformal erworbener Kompetenzen
- Nicht formales Lernen in Schweden
- Nicht formales Lernen in Deutschland
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem schwedischen Berufsbildungssystem und der Bedeutung und Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen im Kontext des lebenslangen Lernens. Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland sollen die Unterschiede bezüglich der Relevanz und Akzeptanz von nicht formal erworbenen Kompetenzen herausgestellt werden.
- Das schwedische Bildungssystem und seine Grundprinzipien
- Das schwedische Berufsbildungssystem und die Rolle der beruflichen Weiterbildung
- Das Konzept des lebenslangen Lernens in Schweden und Deutschland
- Unterschiedliche Lernformen und die Bedeutung des informellen und nichtformellen Lernens
- Die Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen in Schweden und Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema lebenslanges Lernen und die wachsende Bedeutung nicht formal erworbener Kompetenzen ein. Es wird die Relevanz des schwedischen Berufsbildungssystems im Vergleich zu Deutschland hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Die schwedische Landesstruktur, Staatordnung und Wirtschaft: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die geografischen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten Schwedens, um den Kontext des Bildungssystems zu beleuchten.
- Das schwedische Bildungssystem: Dieses Kapitel beschreibt das schwedische Bildungssystem in seinen verschiedenen Stufen, von der Grundschule bis zur Hochschule. Es werden die wichtigsten Prinzipien und die institutionelle Verantwortung für die Bildung erläutert, sowie die Bedeutung der Erwachsenenbildung im Kontext des lebenslangen Lernens.
- Das schwedische Berufsbildungssystem: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die berufliche Erstausbildung und die berufliche Weiterbildung in Schweden. Es werden die Bedeutung des lebenslangen Lernens und die Rolle der beruflichen Weiterbildung im öffentlichen Bildungswesen hervorgehoben.
- Lebenslanges Lernen: Dieses Kapitel behandelt das Konzept des lebenslangen Lernens in Schweden und Deutschland. Es werden unterschiedliche Lernformen, die Bedeutung des informellen und nichtformellen Lernens, sowie die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen in beiden Ländern erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des schwedischen Berufsbildungssystems, der Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen, dem Konzept des lebenslangen Lernens und dem Vergleich zwischen Schweden und Deutschland. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildungssystem, Erwachsenenbildung, berufliche Weiterbildung, informelles Lernen, nicht formales Lernen, Qualifikationsanerkennung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind nicht formal erworbene Kompetenzen?
Dabei handelt es sich um Fähigkeiten, die außerhalb des regulären Schul- oder Hochschulsystems erworben wurden, zum Beispiel durch Berufserfahrung, Ehrenämter oder im Alltag.
Wie unterscheidet sich das schwedische vom deutschen Bildungssystem?
Schweden hat eine lange Tradition in der Erwachsenenbildung (z. B. Volkshochschulen und Studienzirkel) und legt einen größeren Fokus auf die Anerkennung informellen Lernens als Deutschland.
Welche Rolle spielt das lebenslange Lernen in Schweden?
In Schweden ist lebenslanges Lernen tief in der Bildungspolitik verankert, wobei der Staat flexible Wege für die berufliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung bietet.
Warum gewinnt die Anerkennung informeller Bildung an Bedeutung?
Durch Globalisierung und schnellen technologischen Wandel reicht die Erstausbildung oft nicht mehr aus. Etwa 70% der Lernprozesse finden heute außerhalb organisierter Veranstaltungen statt.
Was sind die Voraussetzungen für die Anerkennung dieser Kompetenzen?
Die Arbeit untersucht die länderspezifischen Verfahren und Kriterien, mit denen informell erworbene Qualifikationen in formale Zertifikate oder Berechtigungen umgewandelt werden können.
Wie sieht die berufliche Erstausbildung in Schweden aus?
Die Arbeit beschreibt die Struktur der schwedischen Sekundarstufe und die Integration beruflicher Bildungsgänge in das allgemeine Schulsystem.
- Quote paper
- Björn Peters (Author), 2004, Das schwedische Berufsbildungssystem und die Bedeutung und Anerkennung nicht formal erworbener Kompetenzen im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50562