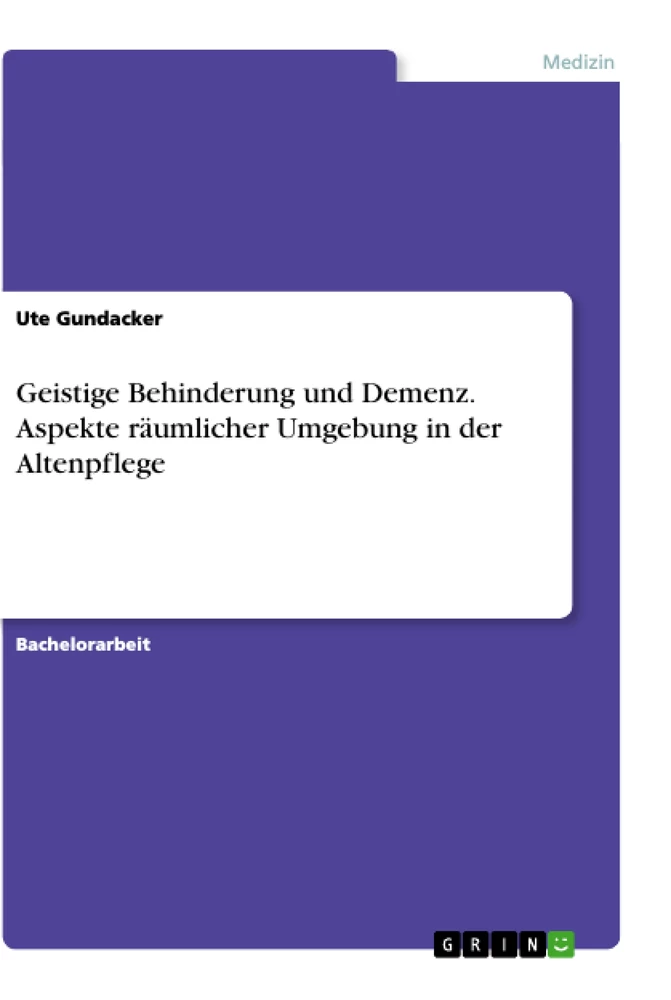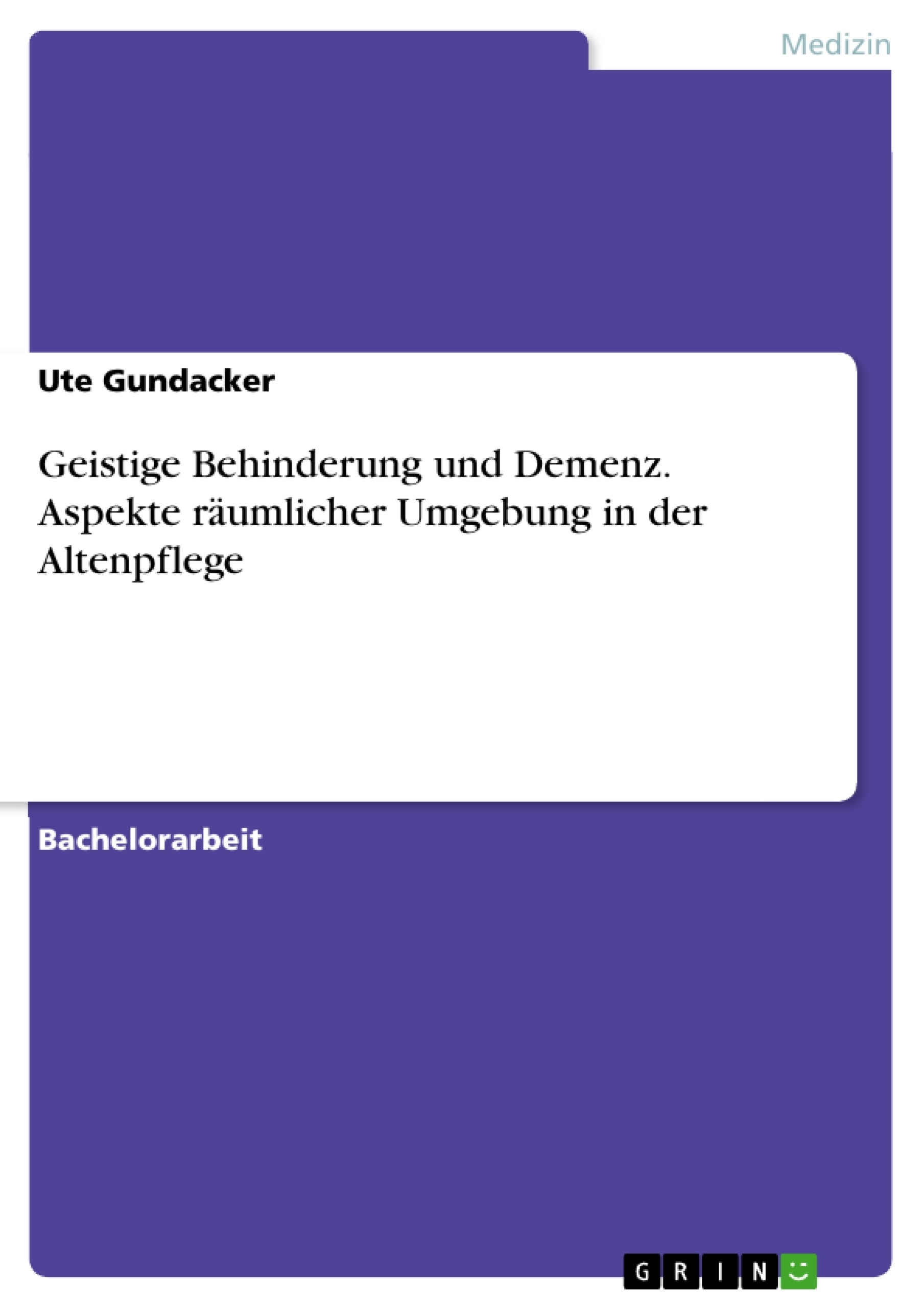Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Wie kann die Lebensqualität betroffener Personen erhalten werden und wo können Behindertenhilfe und Altenarbeit voneinander lernen, auch was Aufbau und Gestaltung der Lebensumwelt der BewohnerInnen angeht? Welche Faktoren können schwierige Situationen und herausforderndes Verhalten abmildern oder vermeiden? Wie schafft man eine Umgebung, die ausreichend Schutz, aber auch Aktivierung bietet?
Einen Bogen zur Berufspraxis schlagen Experteninterviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, die sich mit bisherigen beruflichen Erfahrungen zu dieser Thematik und Planungen bezüglich des zukünftigen Umgangs mit Demenzerkrankungen in ihrer Einrichtung beschäftigen.
Die Altenarbeit wird in unserer alternden Gesellschaft immer wichtiger und bietet dadurch ein großes Betätigungsfeld auch für soziale Arbeit und Forschung. Dagegen bleibt eine andere, ähnliche und doch speziellere Thematik eher unbeachtet durch die breite Öffentlichkeit: Menschen mit einer geistigen Behinderung, die in gehobenem Lebensalter an einer Demenz erkranken.
Zudem stellt sich gerade bei geistig behinderten Menschen, die in einer Wohneinrichtung leben die Frage, ob und mit welchen Hilfsmitteln sie in ihrem Zuhause bleiben können, oder ob sie in ein Senioren- oder Pflegeheim umziehen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geistige Behinderung
- 3. Demenz
- 4. Wohnraumgestaltung für demenzkranke Menschen in stationären Einrichtungen
- 5. Herausforderung geistige Behinderung und Demenz
- 6. Befragung von Beschäftigten in einer Wohnstätte
- 7. Auswertung und Deutung der Interviews
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen, die das gleichzeitige Auftreten von geistiger Behinderung und Demenz in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung darstellt. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe und analysiert, wie die Lebensumwelt gestaltet werden kann, um die Lebensqualität zu erhalten und schwierige Situationen zu vermeiden.
- Geistige Behinderung und ihre verschiedenen Ausprägungen
- Demenz im Kontext geistiger Behinderung
- Gestaltung demenzfreundlicher Wohnumgebungen
- Erfahrungen von Beschäftigten in Wohnstätten
- Möglichkeiten der Verbesserung der Lebensqualität betroffener Personen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die wachsende Bedeutung der Demenz im Kontext des demografischen Wandels. Sie hebt die besondere Herausforderung hervor, die sich aus dem gleichzeitigen Auftreten von geistiger Behinderung und Demenz ergibt, und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit: Wie kann eine Einrichtung der Behindertenhilfe auf demenzielle Erkrankungen reagieren und die Lebensumwelt der Betroffenen positiv beeinflussen?
2. Geistige Behinderung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "geistige Behinderung" und erläutert verschiedene Klassifikationen gemäß ICD-10, wobei verschiedene Grade der Intelligenzminderung und deren Auswirkungen auf das Alltagsleben beschrieben werden. Es betont die Komplexität der Definition und die Notwendigkeit, die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen.
3. Demenz: Dieses Kapitel (angenommen, es existiert im Originaltext) würde die verschiedenen Formen der Demenz erläutern, ihre Symptome beschreiben und den Verlauf der Erkrankung skizzieren. Der Fokus läge dabei wahrscheinlich auf den Besonderheiten der Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung im Vergleich zu nicht-behinderten Menschen.
4. Wohnraumgestaltung für demenzkranke Menschen in stationären Einrichtungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Prinzipien der Gestaltung von Wohnräumen, die auf die Bedürfnisse demenzkranker Menschen zugeschnitten sind. Es analysiert den Einfluss von baulichen Maßnahmen, Licht, Farben und anderen Gestaltungselementen auf die Lebensqualität der Betroffenen und beschreibt Beispiele für gute Praxis. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Anpassung dieser Prinzipien an die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung.
5. Herausforderung geistige Behinderung und Demenz: Dieses Kapitel würde die besonderen Herausforderungen behandeln, die sich aus dem gleichzeitigen Vorliegen von geistiger Behinderung und Demenz ergeben. Es werden wahrscheinlich spezifische Probleme angesprochen, die über die Herausforderungen bei Demenz allein hinausgehen, und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
6. Befragung von Beschäftigten in einer Wohnstätte: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Ergebnisse von Experteninterviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Interviews konzentrierten sich auf die bisherigen Erfahrungen mit demenziell erkrankten Bewohnern und auf die Planungen für den zukünftigen Umgang mit Demenz in der Einrichtung. Die gewonnenen Erkenntnisse werden detailliert dargestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Demenz, Wohnraumgestaltung, demenzfreundliche Umgebung, Behinderung und Alter, Experteninterviews, Lebensqualität, Betreuung, Herausforderungen, Wohnstätte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Herausforderungen durch das gleichzeitige Auftreten von geistiger Behinderung und Demenz
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem gleichzeitigen Auftreten von geistiger Behinderung und Demenz in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung ergeben. Sie analysiert die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe und beleuchtet Möglichkeiten zur Gestaltung der Lebensumwelt, um die Lebensqualität zu erhalten und schwierige Situationen zu vermeiden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst Themen wie die Definition und verschiedenen Ausprägungen geistiger Behinderung, Demenz im Kontext geistiger Behinderung, die Gestaltung demenzfreundlicher Wohnumgebungen, die Erfahrungen von Beschäftigten in Wohnstätten und Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität betroffener Personen. Es werden verschiedene Formen der Demenz, deren Symptome und Verlauf beschrieben, mit besonderem Fokus auf die Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu geistiger Behinderung und Demenz, ein Kapitel zur Wohnraumgestaltung für demenzkranke Menschen in stationären Einrichtungen, ein Kapitel zu den spezifischen Herausforderungen des gleichzeitigen Auftretens beider Erkrankungen, ein Kapitel über die Befragung von Beschäftigten in einer Wohnstätte mit Auswertung der Interviews, und abschließend ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert unter anderem auf Experteninterviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Interviews konzentrierten sich auf Erfahrungen mit demenziell erkrankten Bewohnern und Planungen für den zukünftigen Umgang mit Demenz in der Einrichtung. Die Ergebnisse dieser Interviews werden detailliert dargestellt und analysiert.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Befragung der Beschäftigten?
Die Ergebnisse der Befragung der Beschäftigten werden im Kapitel 6 detailliert dargestellt und analysiert. Es wird beschrieben, wie die bisherigen Erfahrungen mit demenziell erkrankten Bewohnern waren und wie die Einrichtung den zukünftigen Umgang mit Demenz plant.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit (Kapitel 8) fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und bietet möglicherweise Handlungsempfehlungen für die Gestaltung demenzfreundlicher Wohnumgebungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Die genaue Aussage des Fazits ist im vorliegenden Text-Preview jedoch nicht enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Demenz, Wohnraumgestaltung, demenzfreundliche Umgebung, Behinderung und Alter, Experteninterviews, Lebensqualität, Betreuung, Herausforderungen, Wohnstätte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Behindertenhilfe, Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz, Planer von Wohnstätten und alle, die sich mit der Betreuung und Pflege demenziell erkrankter Menschen mit geistiger Behinderung befassen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten im Umgang mit dieser Personengruppe.
- Citation du texte
- Ute Gundacker (Auteur), 2012, Geistige Behinderung und Demenz. Aspekte räumlicher Umgebung in der Altenpflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505647