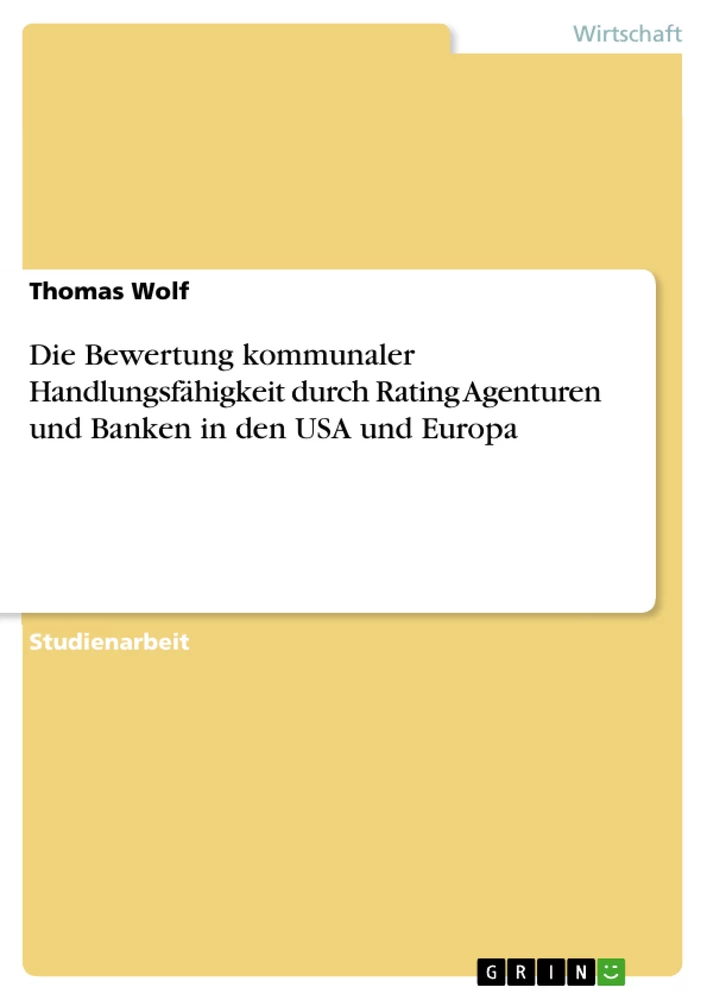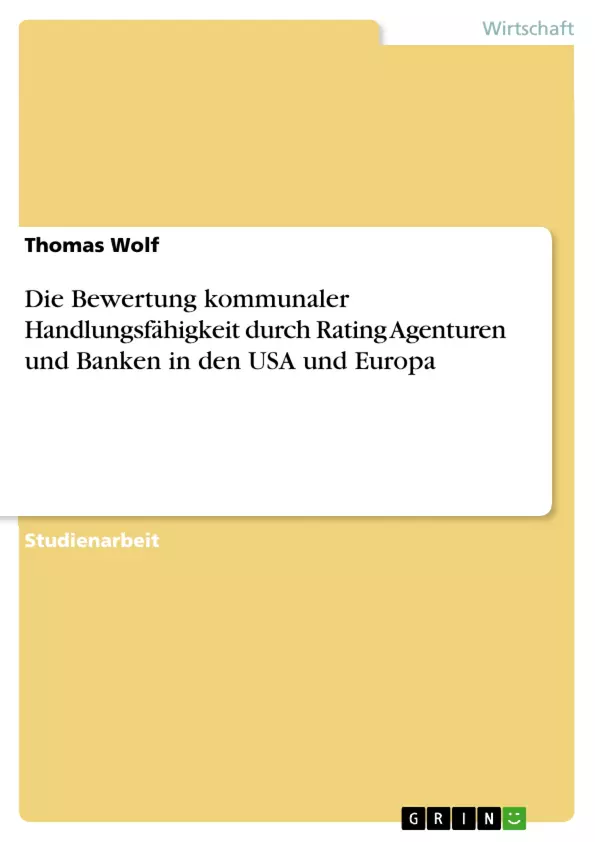Zu den Einnahmequellen von Kommunen gehört neben Steuer- und Gebührenerhebung auch die Möglichkeit Kredite aufzunehmen. In den letzten 15 Jahren hat jedoch Verschuldung der öffentlichen Hand in der BRD recht stark zugenommen. Auf der Gemeinde- und Länderebene haben sich die Schulden seit 1991 circa verdoppelt. Auf Bundesebene vollzog sich ein Schuldenanstieg um etwa 300 Prozent1. Eine Ausweitung der Fremdkapitalverbindlichkeiten steht im Zusammenhang mit der Ausdehnung von Zins- und Tilgungsverpflichtungen, welche die öffentlichen Haushalte nachhaltig belasten. So ereignete sich Ende der neunziger Jahre der Zahlungsausfall einer Kommune in der Schweiz, als diese nicht mehr im Stande war ihre Zinszahlungen zu leisten.
Neben diesem Beispiel existieren noch eine Reihe weiterer öffentlicher Schuldner die in der Vergangenheit Probleme hatte ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, als Beispiel seien Argentinien, Russland und Provinzen in Mexiko genannt. Zusätzlich hat auch der Bankensektor, welcher zweifelsfrei zu den größten Fremdkapitalgebern von Kommunen zählt, seine Anforderungen an Kreditrisikomanagement und Bonitätseinschätzung von Schuldnern entscheidend verschärft. Die Ursache hierfür sind die ab 2007 in Kraft tretenden Basel 2 Regelungen. Im Angesicht solcher Entwicklung stellt sich die Frage, ob eine Bonitätsbeurteilung für Gemeinden und öffentliche Gebietskörperschaften sinnvoll und notwendig ist. Nachfolgende Hausarbeit soll einen Einblick in das Thema Kommunal-Rating vermitteln und die damit verbundenen Auswirkungen für Gemeinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Ursprünge des Rating-Begriffes
- 2.1 Definition und Historie
- 2.2 Herausgeber von Ratings
- 2.3 Ratingsymbole und Veränderungen der Bonitätseinstufung
- 2.4 Ratingarten
- 2.5 Rating-Methodik
- 3. Exkurs Basel 2
- 3.1 Baseler Akkord 1 und 2
- 3.2 Welche Rating-Methoden werden Banken gemäß Basel 2 benutzen?
- 3.3 Diskussionen um Rating-Zwang in Deutschland
- 4. Besonderheiten des Kommunal-Ratings
- 4.1 Die kommunale Eigenbonität
- 4.2 Support-Rating
- 5. Der Nutzen von Ratings aus Gemeindesicht
- 6. Derzeitige Bedeutung von Kommunal-Rating in verschiedenen Ländern
- 6.1 Kommunalfinanzierungen und Rating in Deutschland
- 6.2 Kommunalfinanzierung und Rating in der Schweiz
- 6.2 Kommunalfinanzierung und Rating in den USA
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewertung kommunaler Handlungsfähigkeit durch Ratingagenturen und Banken in den USA und Europa. Das Hauptziel ist es, einen umfassenden Überblick über das Kommunal-Rating zu geben und dessen Bedeutung für Gemeinden zu beleuchten.
- Definition und Entwicklung des Rating-Begriffes
- Der Einfluss der Basel II-Regelung auf das Kommunal-Rating
- Die Besonderheiten des Kommunal-Ratings im Vergleich zu anderen Ratingarten
- Der Nutzen und die Bedeutung von Kommunal-Ratings aus der Sicht der Gemeinden
- Ein Ländervergleich der Bedeutung von Kommunal-Ratings (Deutschland, Schweiz, USA)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den steigenden Schuldenstand öffentlicher Haushalte in Deutschland und anderen Ländern, den damit verbundenen Anstieg der Zins- und Tilgungsverpflichtungen und die verschärften Anforderungen des Bankensektors an das Kreditrisikomanagement im Kontext der Basel II-Regelungen. Sie führt in die Thematik des Kommunal-Ratings ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit.
2. Definition und Ursprünge des Rating-Begriffes: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Rating" und beschreibt seine historische Entwicklung. Es behandelt die verschiedenen Herausgeber von Ratings, die verwendeten Ratingsymbole, die verschiedenen Ratingarten und die Methodik der Ratingverfahren. Es legt die Grundlage für das Verständnis des nachfolgenden Kapitels über die Besonderheiten des Kommunal-Ratings.
3. Exkurs Basel 2: Das Kapitel erläutert den Baseler Akkord und dessen Auswirkungen auf das Kreditrisikomanagement von Banken. Es beleuchtet die Bedeutung von Ratingmethoden im Kontext von Basel II und diskutiert die Kontroversen um den Ratingzwang in Deutschland. Dieser Exkurs zeigt die Relevanz von Ratings für die Kreditvergabe an Kommunen auf.
4. Besonderheiten des Kommunal-Ratings: Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifischen Aspekte des Kommunal-Ratings, insbesondere die kommunale Eigenbonität und das Support-Rating. Es analysiert die Faktoren, die die Kreditwürdigkeit von Kommunen beeinflussen und differenziert diese von anderen Ratingobjekten. Die Ausführungen liefern ein vertieftes Verständnis der Herausforderungen und Besonderheiten im Bereich des Kommunal-Ratings.
5. Der Nutzen von Ratings aus Gemeindesicht: Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorteilen von Kommunal-Ratings aus der Perspektive der Gemeinden. Es analysiert, wie Ratings die Kreditwürdigkeit und die Finanzierungsfähigkeit von Kommunen beeinflussen und welche positiven Auswirkungen sich daraus ergeben können. Es wird die Perspektive der Gemeinden auf die Thematik beleuchtet und der Nutzen der Ratings für sie dargestellt.
6. Derzeitige Bedeutung von Kommunal-Rating in verschiedenen Ländern: Dieses Kapitel vergleicht die Bedeutung von Kommunal-Ratings in Deutschland, der Schweiz und den USA. Es analysiert die Unterschiede in den Finanzierungsstrukturen und den jeweiligen Rollen von Ratingagenturen in diesen Ländern. Der Ländervergleich veranschaulicht die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und die internationale Relevanz der Thematik.
Schlüsselwörter
Kommunal-Rating, Ratingagenturen, Banken, Basel II, Kreditrisikomanagement, Kommunalfinanzierung, Bonität, Eigenbonität, Support-Rating, Deutschland, Schweiz, USA.
Häufig gestellte Fragen zum Kommunal-Rating
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Kommunal-Rating. Sie beinhaltet eine Definition des Begriffs, seine historischen Ursprünge, die verschiedenen Ratingarten und -methoden sowie den Einfluss von Basel II. Besonderheiten des Kommunal-Ratings, der Nutzen aus Gemeindesicht und ein Ländervergleich (Deutschland, Schweiz, USA) werden ebenfalls behandelt.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Kommunal-Ratings zu liefern und dessen Bedeutung für Gemeinden zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Bewertung kommunaler Handlungsfähigkeit durch Ratingagenturen und Banken in den USA und Europa.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung des Rating-Begriffes, den Einfluss von Basel II, Besonderheiten des Kommunal-Ratings im Vergleich zu anderen Ratingarten, den Nutzen und die Bedeutung von Kommunal-Ratings aus der Sicht der Gemeinden sowie einen Ländervergleich der Bedeutung von Kommunal-Ratings (Deutschland, Schweiz, USA).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition und Ursprünge des Rating-Begriffes (inkl. Unterkapitel zu Definition & Historie, Herausgebern, Ratingsymbolen, Ratingarten und -methodik), Exkurs Basel II (inkl. Baseler Akkord, Ratingmethoden nach Basel II und Diskussionen um Rating-Zwang), Besonderheiten des Kommunal-Ratings (inkl. kommunaler Eigenbonität und Support-Rating), Der Nutzen von Ratings aus Gemeindesicht, Derzeitige Bedeutung von Kommunal-Rating in verschiedenen Ländern (Deutschland, Schweiz, USA) und Fazit.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert ein umfassendes Verständnis des Kommunal-Ratings, seiner Bedeutung für Gemeinden und die Unterschiede in der Anwendung in verschiedenen Ländern. Sie beleuchtet den Einfluss von Basel II und die Besonderheiten des Kommunal-Ratings im Vergleich zu anderen Ratingarten. Die Ergebnisse zeigen den Nutzen von Ratings aus der Sicht der Gemeinden und die unterschiedlichen Entwicklungsstufen in Deutschland, der Schweiz und den USA.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kommunal-Rating, Ratingagenturen, Banken, Basel II, Kreditrisikomanagement, Kommunalfinanzierung, Bonität, Eigenbonität, Support-Rating, Deutschland, Schweiz, USA.
Wie wird der Baseler Akkord in der Arbeit behandelt?
Der Baseler Akkord und seine Auswirkungen auf das Kreditrisikomanagement von Banken werden in einem eigenen Kapitel erläutert. Die Bedeutung von Ratingmethoden im Kontext von Basel II und die Kontroversen um den Ratingzwang in Deutschland werden diskutiert, um die Relevanz von Ratings für die Kreditvergabe an Kommunen aufzuzeigen.
Welche Besonderheiten des Kommunal-Ratings werden hervorgehoben?
Die Arbeit fokussiert auf die spezifischen Aspekte des Kommunal-Ratings, insbesondere die kommunale Eigenbonität und das Support-Rating. Es werden die Faktoren analysiert, die die Kreditwürdigkeit von Kommunen beeinflussen und diese von anderen Ratingobjekten differenzieren.
Wie wird der Nutzen von Kommunal-Ratings aus Gemeindesicht dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie Ratings die Kreditwürdigkeit und die Finanzierungsfähigkeit von Kommunen beeinflussen und welche positiven Auswirkungen sich daraus ergeben können. Die Perspektive der Gemeinden auf die Thematik wird beleuchtet und der Nutzen der Ratings für sie dargestellt.
Wie werden die Unterschiede im Kommunal-Rating zwischen Deutschland, der Schweiz und den USA verglichen?
Das Kapitel zum Ländervergleich analysiert die Unterschiede in den Finanzierungsstrukturen und den jeweiligen Rollen von Ratingagenturen in Deutschland, der Schweiz und den USA. Es veranschaulicht die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und die internationale Relevanz der Thematik.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Thomas Wolf (Author), 2005, Die Bewertung kommunaler Handlungsfähigkeit durch Rating Agenturen und Banken in den USA und Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50569