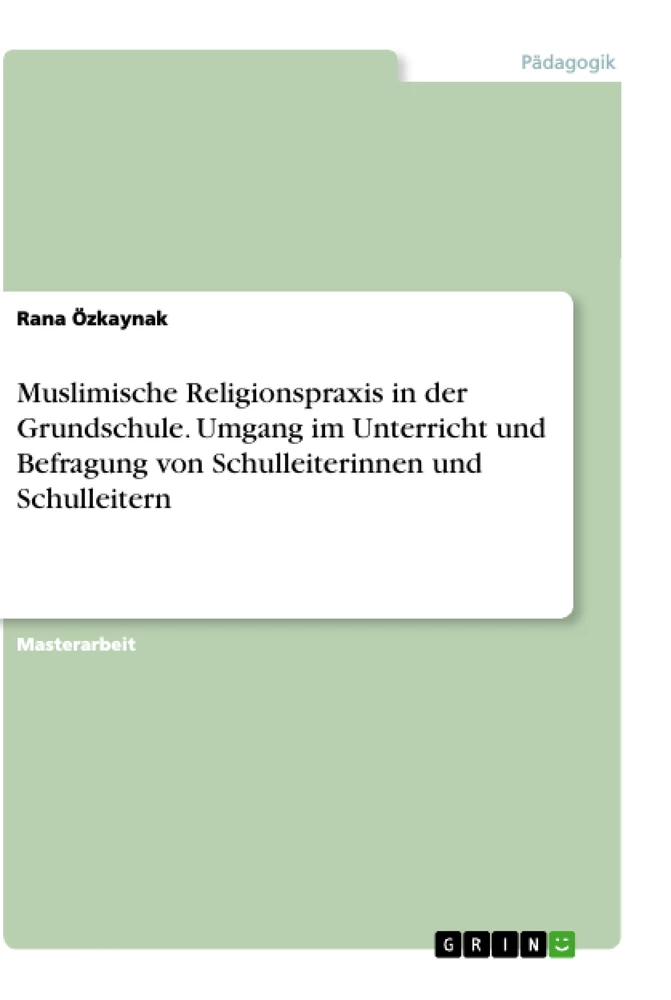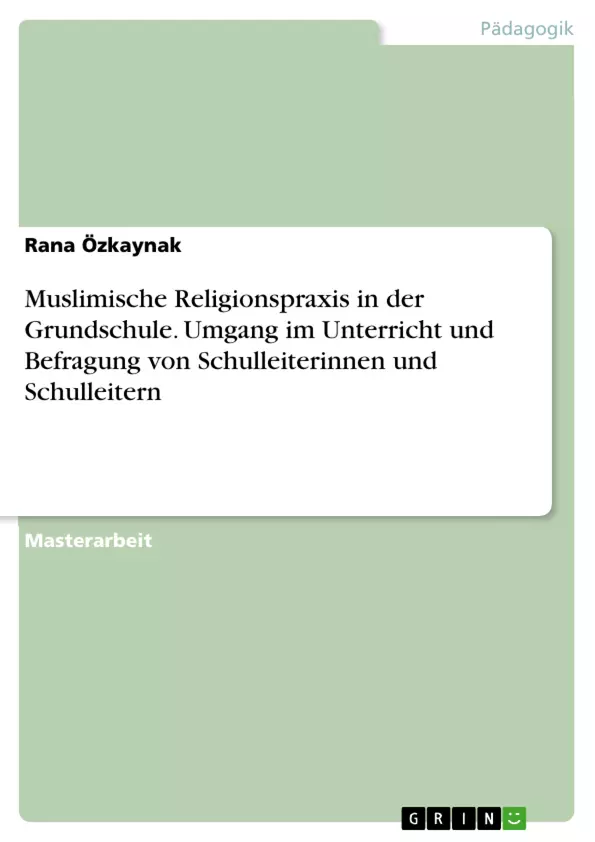Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Umgang mit muslimischer Religionspraxis im Schulalltag. Wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit fastenden Schülerinnen und Schülern um und was tun, wenn muslimische Mädchen nicht schwimmen wollen ? Wo liegen die Grenzen der Religionsfreiheit? Welche Unterstützungsmöglichkeiten hat die Schule?
Hier geht es darum, wie weit eine Lehrkraft gehen darf und wo die Grenzen der Religionsfreiheit liegen. Die Diskussion über den Umgang mit muslimischen Schülerinnen und Schülern ist hoch aktuell und nicht immer wissen sich die Lehrkräfte zu helfen. Einige Immigranten haben bereits in Schulen in ihrem Heimatland besucht und sind geprägt von dem dort vorherrschenden Weltbild.
Dies zu wissen ist für Lehrerinnen und Lehrer von großer Bedeutung, denn es begründet in einigen Fällen das Verhalten muslimischer Schülerinnen und Schüler. Lehrkräfte sollten sich mit der Thematik auseinandersetzen, um befremdende oder störende Faktoren im Unterricht, die aus der muslimischen Religionspraxis hervorgehen, verstehen und adäquat darauf reagieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begründung der Themenwahl und Aktualität der Thematik
- 1.2 Gliederung der Arbeit und Vorgehensweise
- 1.3 Forschungsgegenstand
- I Theoretischer Teil
- 2. Definition und Erklärung der Begrifflichkeiten
- 2.1 Säkularität in Deutschland
- 2.1.1 Islam und der säkulare demokratische Rechtsstaat
- 2.2 Religionsfreiheit (positiv/negativ) und die Grenzen der Religionsfreiheit
- 2.2.1 Religionsfreiheit und Schule
- 3. Muslimische Religionspraxis im Schulalltag - Forschungsstand
- 3.1 Thematische Fokussierung
- 3.2 Situation an Bremer Schulen
- II Empirischer Teil
- 4. Methodisches Vorgehen
- 4.1 Erhebungsphase
- 4.2 Transkription
- 4.3 Auswertungsphase
- III Darstellung der Ergebnisse und Diskussion
- 5. Erkenntnisgewinn durch die Befragungen der Schulleiterinnen und Schulleiter
- 6. Diskussion der Ergebnisse
- 6.1 Methodenkritik (Gütekriterien)
- 6.2 Interpretation der gewonnenen Ergebnisse
- IV Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Umgang mit muslimischer Religionspraxis im Bremer Grundschulalltag. Ziel ist es, die Erfahrungen von Schulleiterinnen und Schulleitern in diesem Bereich zu erforschen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Lösungsansätze im Kontext von Säkularität, Religionsfreiheit und interkulturellem Verständnis.
- Religionsfreiheit und ihre Grenzen im schulischen Kontext
- Konkrete Beispiele muslimischer Religionspraxis (Ramadan, Kopftuch, Gebet etc.)
- Herausforderungen für Schulleitungen im Umgang mit muslimischen Schülerinnen und Schülern
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit muslimischen Eltern
- Methodische Reflexion der durchgeführten Befragung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der muslimischen Religionspraxis im Grundschulalltag ein und begründet die Aktualität und Relevanz der Forschungsfrage. Es werden aktuelle Medienberichte zu relevanten Fällen (z.B. Fasten während der Schulzeit, Nichtteilnahme am Schwimmunterricht) herangezogen, um die Notwendigkeit der Untersuchung zu unterstreichen. Zusätzlich wird die Problematik anhand von Beispielen aus Schulbüchern islamisch geprägter Länder illustriert, welche unterschiedliche Perspektiven auf den Westen und Geschlechterrollen verdeutlichen. Das Kapitel dient der Kontextualisierung und der Abgrenzung des Forschungsfokus.
2. Definition und Erklärung der Begrifflichkeiten: Hier werden zentrale Begriffe wie Säkularität, Religionsfreiheit und deren Grenzen im deutschen Kontext definiert und erläutert. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen dem säkularen, demokratischen Rechtsstaat und der Ausübung der Religionsfreiheit, insbesondere im schulischen Umfeld. Die Kapitel unterstreicht die komplexen rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit muslimischer Religionspraxis in der Schule.
3. Muslimische Religionspraxis im Schulalltag - Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Es werden verschiedene Aspekte muslimischer Religionspraxis im Schulalltag thematisiert, wie beispielsweise der Ramadan, das Kopftuch, der Islamunterricht, Klassenfahrten und der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Der Abschnitt beleuchtet den bestehenden Forschungsdiskurs und liefert wichtige Kontextinformationen für die eigene empirische Untersuchung. Die Situation an Bremer Schulen wird im Anschluss spezifisch betrachtet.
4. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es wird das methodische Vorgehen bei der Erhebung und Auswertung der Daten erläutert, einschliesslich der Entwicklung des Interviewleitfadens, der Auswahl der Interviewpartner und der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Der Abschnitt legt den Fokus auf die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses.
5. Erkenntnisgewinn durch die Befragungen der Schulleiterinnen und Schulleiter: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern zu verschiedenen Aspekten der muslimischen Religionspraxis im Schulalltag. Es werden die Erfahrungen und Herausforderungen im Umgang mit Essensvorschriften, Ramadan, Unterricht und muslimischer Religionspraxis, Kopftuch, Umgang mit dem anderen Geschlecht, Gebet in der Schule, sowie Elternarbeit systematisch dargestellt. Die Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Praxis an Bremer Grundschulen.
6. Diskussion der Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie kritisch diskutiert und interpretiert. Es erfolgt eine methodische Reflexion und eine Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse in den bestehenden Forschungsstand. Die Diskussion widmet sich der Interpretation der Ergebnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen und der gesellschaftlichen Herausforderungen im Umgang mit religiöser Vielfalt. Es wird auf methodische Limitationen und potentielle Forschungslücken eingegangen, welche die Grundlage für weitere Studien bilden könnten.
Schlüsselwörter
Muslimische Religionspraxis, Grundschule, Bremen, Säkularität, Religionsfreiheit, Kopftuch, Ramadan, Gebet, Essensvorschriften, interkulturelle Kompetenz, Schulleitung, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Elternarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Muslimische Religionspraxis im Bremer Grundschulalltag
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Umgang mit muslimischer Religionspraxis im Bremer Grundschulalltag. Sie erforscht die Erfahrungen von Schulleiterinnen und Schulleitern und analysiert die Herausforderungen und Lösungsansätze im Kontext von Säkularität, Religionsfreiheit und interkulturellem Verständnis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Religionsfreiheit und ihre Grenzen im schulischen Kontext, konkrete Beispiele muslimischer Religionspraxis (Ramadan, Kopftuch, Gebet etc.), Herausforderungen für Schulleitungen im Umgang mit muslimischen Schülerinnen und Schülern, Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit muslimischen Eltern und eine methodische Reflexion der durchgeführten Befragung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einleitung, Theoretischer Teil (Definitionen, Forschungsstand), Empirischer Teil (Methodisches Vorgehen) und Darstellung der Ergebnisse und Diskussion, sowie ein Fazit und Ausblick. Der theoretische Teil beleuchtet Säkularität in Deutschland, Religionsfreiheit und deren Grenzen, sowie den Forschungsstand zur muslimischen Religionspraxis an Bremer Schulen. Der empirische Teil beschreibt die Methodik (qualitative Interviews mit Schulleitungen und Inhaltsanalyse). Die Ergebnisse werden präsentiert und diskutiert, inklusive einer Methodenkritik.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Es wurden Interviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern geführt. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Arbeit legt Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern werden systematisch dargestellt und analysiert. Es werden die Erfahrungen und Herausforderungen im Umgang mit Aspekten wie Essensvorschriften, Ramadan, Unterricht und muslimischer Religionspraxis, Kopftuch, Umgang mit dem anderen Geschlecht, Gebet in der Schule sowie Elternarbeit beleuchtet. Die Ergebnisse liefern einen Beitrag zum Verständnis der Praxis an Bremer Grundschulen.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und interpretiert. Es erfolgt eine methodische Reflexion und eine Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse in den bestehenden Forschungsstand. Die Diskussion widmet sich der Interpretation der Ergebnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen und der gesellschaftlichen Herausforderungen im Umgang mit religiöser Vielfalt. Methodische Limitationen und potentielle Forschungslücken werden ebenfalls angesprochen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Muslimische Religionspraxis, Grundschule, Bremen, Säkularität, Religionsfreiheit, Kopftuch, Ramadan, Gebet, Essensvorschriften, interkulturelle Kompetenz, Schulleitung, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Elternarbeit.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument gibt einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
- Quote paper
- Rana Özkaynak (Author), 2019, Muslimische Religionspraxis in der Grundschule. Umgang im Unterricht und Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505767