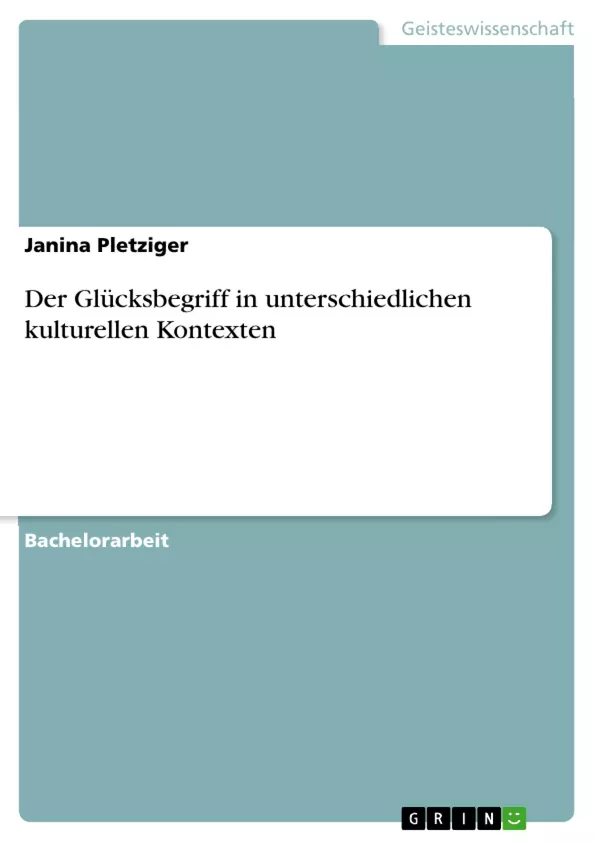Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Glücksbegriff in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. In welchem Bezug stehen die Wege zum Glück im kulturellen Kontext einer Gesellschaft und welche Lebensstrategien ermöglichen ein erfolgreiches Leben im Sinne einer Lebenskunst? Während meines Studienprojektes habe ich gelernt, dass das Lebensglück in engem Zusammenhang mit dem soziokulturellen Umfeld einer Gesellschaft steht und die kulturelle Umgebung mit ihren Instrumenten, Gedanken, Philosophien und Lebenseinstellungen wesentlich zum subjektiven Glücksempfinden bei trägt.
Das Thema Glück hat Hochkonjunktur, in den Buchhandlungen wimmelt es nur so von Glücksratgebern und auch im Fernsehen bemühen sich selbst ernannte Glücksgurus, wie beispielsweise Eckhart von Hirschhausen, den glückssuchenden Zuschauern einen optimalen Weg zu weisen. Die vielfältige Beschäftigung mit dem Thema Glück hat sicher auch damit zu tun, dass sich die Welt in den letzten 20 Jahren sehr schnell verändert hat. Die weltweilte Globalisierung hat zu einer enormen Beschleunigung der Lebensverhältnisse und zu jeder Menge Unübersichtlichkeiten geführt. Noch keine Generation stand so sehr im Bann des Glücks wie unsere, so klagt der französische Philosoph und Schriftsteller Pascal Bruckner. Jeder sucht nach dem Schlüssel, sei es der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zur Freiheit oder der Schlüssel zum Erfolg.
Jedoch scheint es so, als würden alle diesen Schlüssel am falschen Ort suchen. So sind wir verführt und geblendet von den schrillen Reklamebotschaften der Glücksindustrie und suchen unseren Glücksschlüssel draußen im Scheinwerfer der Werbung und der Gesellschaft. Jedoch haben wir ihn in unserem Inneren verloren und es bedarf der Selbstreflexion um unser wahres Glück zu finden.
Oder wie Ernst Stürmer es passend beschreibt: "Der Zeitgenössische Glückssucher droht in ein verwirrendes Labyrinth zu geraten, ein Irrgarten mit Wegverzweigungen, Sackgassen, Umwegen, Schleifen und Fallen, wenn er auf das gängige Glücksblabla unserer Konsum- und Spaßgesellschaft hereinfällt und sich vom schillernden Talmiglanz des Pseudoglücks blenden lässt." So folgt diese Arbeit nicht den Meinungen von "Glücksdiletanten", die Plastikglück fabrizieren und dieses marktschreierisch im Sonderangebot verkaufen, sondern den Spuren von Meistern der Lebenskunst aller Zeiten über die ganze Welt verteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Semantik des Glücks
- Europäische Glückswege
- Glück in der Antike
- Glücksphilosophie der klassischen Periode
- Glücksphilosophie im Hellenismus
- Europäische Glücksphilosophie nach der Antike
- Glück im Mittelalter
- Glück in der frühen Neuzeit und Moderne
- Fazit der europäischen Glücksphilosophie
- Glück in der Antike
- Das Glück des langen gesunden Lebens in China
- Konfuzius und die konfuzianische Glücksphilosophie
- Laotse und die daoistische Glücksphilosophie
- Glück im Zen-Buddhismus
- Chinesisches Glück im 20. Jahrhundert
- You Chinesischer Flow-Effekt
- Fazit der chinesischen Glücksphilosophie
- Glück als Überwindung des Leidens in Indien
- Der Hinduismus und seine Glückssymbole
- Glück im Buddhismus
- Der Yoga des Patanjâli
- Glücksverständnis im hinduistischen Tantrismus
- Indien im 20. Jahrhundert, Materialismus und Mc Donalds
- Fazit der indischen Glücksphilosophie
- Glück als Gottesliebe in der arabischen Welt
- Glück im Islam
- Glück im Sufismus
- Fazit der arabischen Glücksphilosophie
- Lebenskunst im indigenen Kontext
- Heiterkeit bei den Amazonas Indianern
- Glück bei den Yequana Indianern
- Die sechs Juwelen der Nordamerikanischen Indianer
- Glück in Afrika
- Fazit der indianischen und afrikanischen Glücksphilosophie
- Messbares Glück
- Ländervergleiche
- Bruttoglücksprodukt Bhutan
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Glücksbegriff in verschiedenen kulturellen Kontexten. Ziel ist es, die Vielfältigkeit der Wege zum Glück aufzuzeigen und den Einfluss soziokultureller Faktoren auf das subjektive Glücksempfinden zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf der persönlichen Erfahrung der Autorin in Benin und hinterfragt den oft angenommenen Zusammenhang zwischen materiellem Wohlstand und Glück.
- Der Einfluss kultureller Normen und Werte auf das Verständnis von Glück
- Vergleichende Analyse von Glückskonzepten in verschiedenen Kulturen (Europa, China, Indien, arabische Welt, indigene Kulturen)
- Die Rolle von Philosophie und Religion im Verständnis von Glück
- Der Widerspruch zwischen materiellem Wohlstand und Glück
- Alternative Konzepte von Glück und Lebenszufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Schilderung der persönlichen Erfahrungen der Autorin in Benin, die ihre Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen materiellem Wohlstand und Glück nachhaltig verändert hat. Sie beschreibt den Kontrast zwischen Armut und Lebensfreude in Benin und stellt die Frage nach dem Einfluss des soziokulturellen Umfelds auf das subjektive Glücksempfinden. Die Einleitung dient als Motivation und Einführung in die Thematik der kulturellen Vielfalt des Glücksbegriffs.
Europäische Glückswege: Dieses Kapitel zeichnet einen historischen Überblick über die europäische Glücksphilosophie von der Antike bis zur Moderne nach. Es werden verschiedene Philosophien und Epochen untersucht, um aufzuzeigen, wie sich das Verständnis von Glück im Laufe der Zeit verändert hat. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen und den jeweiligen soziokulturellen Kontexten, in denen diese Konzepte entstanden sind. Dies bildet eine Grundlage für den Vergleich mit nicht-europäischen Kulturen.
Das Glück des langen gesunden Lebens in China: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Glück in der chinesischen Kultur, unter Einbezug konfuzianischer, daoistischer und buddhistischer Philosophien. Es analysiert, wie diese Traditionen Glück definieren und welche Wege zur Erreichung von Glück vorgeschlagen werden. Der Einfluss des 20. Jahrhunderts und die Bedeutung des "You" (chinesischer Flow-Effekt) werden ebenfalls thematisiert. Die Kapitel verdeutlicht den Stellenwert von Harmonie, innerem Frieden und sozialer Integration im chinesischen Glücksverständnis.
Glück als Überwindung des Leidens in Indien: Dieses Kapitel erörtert das Verständnis von Glück im hinduistischen und buddhistischen Kontext. Es wird untersucht, wie Glück als Überwindung von Leid und als Erreichen von Erleuchtung konzipiert wird. Der Yoga und der Tantrismus werden als Wege zur spirituellen Entwicklung und zum Glückserleben vorgestellt. Der Einfluss des modernen Materialismus und die Herausforderungen der Globalisierung für das traditionelle Glücksverständnis in Indien werden ebenfalls diskutiert.
Glück als Gottesliebe in der arabischen Welt: Dieses Kapitel analysiert das Konzept des Glücks im Islam und Sufismus. Es untersucht, wie Glück mit der Gottesliebe, der Erfüllung religiöser Pflichten und der Hinwendung zu Gott verbunden wird. Der Fokus liegt auf der spirituellen Dimension des Glücks und den verschiedenen Wegen, um Gottesnähe und damit Glück zu erlangen. Die Kapitel vergleicht und kontrastiert diese Konzepte mit anderen Glücksverständnissen.
Lebenskunst im indigenen Kontext: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Glücksverständnis verschiedener indigener Kulturen in Südamerika und Afrika. Es analysiert, wie Glück in diesen Kulturen mit der Natur, der Gemeinschaft und spirituellen Praktiken verbunden ist. Es werden Beispiele aus unterschiedlichen Kulturen präsentiert, um die Vielfalt indigener Glücksvorstellungen aufzuzeigen und diese mit den zuvor beschriebenen Konzepten zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Gemeinschaft, Naturverbundenheit und spiritueller Praxis für das Glücksempfinden in indigenen Kulturen.
Messbares Glück: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Versuch, Glück messbar zu machen. Es werden Ländervergleiche und das Bruttoglücksprodukt Bhutans als Beispiele für Ansätze zur quantitativen Erfassung von Glück vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Diskussion der Vor- und Nachteile solcher Messmethoden und ihrer Grenzen im Kontext unterschiedlicher kultureller Werte und Normen.
Schlüsselwörter
Glück, Kultur, Glücksbegriff, Glücksforschung, soziokultureller Kontext, Lebenszufriedenheit, Philosophie, Religion, Materialismus, Spiritualität, Indien, China, Arabische Welt, Indigene Kulturen, Europa, Vergleichende Kulturforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kulturelle Vielfalt des Glücksbegriffs
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Glücksbegriff in verschiedenen kulturellen Kontexten. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie ein Stichwortverzeichnis. Der Text analysiert philosophische und religiöse Ansätze zum Glück in Europa, China, Indien, der arabischen Welt und bei indigenen Kulturen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich zwischen materiellem Wohlstand und Glück.
Welche Kulturen werden im Text behandelt?
Der Text untersucht das Verständnis von Glück in europäischen, chinesischen, indischen, arabischen und indigenen Kulturen. Innerhalb dieser Kulturen werden verschiedene philosophische und religiöse Traditionen betrachtet (z.B. Konfuzianismus, Daoismus, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Sufismus).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind der Einfluss kultureller Normen und Werte auf das Verständnis von Glück, ein Vergleich verschiedener Glückskonzepte, die Rolle von Philosophie und Religion, der Widerspruch zwischen materiellem Wohlstand und Glück sowie alternative Konzepte von Glück und Lebenszufriedenheit.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einer bestimmten Kultur oder einem Aspekt des Glücksbegriffs auseinandersetzen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst, um einen schnellen Überblick über den Inhalt zu ermöglichen. Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation der Autorin und den Ausgangspunkt ihrer Arbeit beschreibt.
Welche Methoden werden verwendet?
Der Text verwendet eine vergleichende Methode, um die verschiedenen Glückskonzepte zu analysieren und zu kontrastieren. Er stützt sich auf philosophische und religiöse Texte sowie auf kulturelle Beobachtungen. Die Autorin bezieht auch persönliche Erfahrungen mit ein, insbesondere ihre Erfahrungen in Benin.
Gibt es einen Fokus auf messbares Glück?
Ja, ein Kapitel widmet sich dem Thema „Messbares Glück“. Hier werden Ländervergleiche und das Bruttoglücksprodukt Bhutans als Beispiele für quantitative Ansätze zur Erfassung von Glück diskutiert. Die Grenzen solcher Messmethoden im Kontext unterschiedlicher kultureller Werte werden kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Glück, Kultur, Glücksbegriff, Glücksforschung, soziokultureller Kontext, Lebenszufriedenheit, Philosophie, Religion, Materialismus, Spiritualität, Indien, China, Arabische Welt, Indigene Kulturen, Europa, Vergleichende Kulturforschung.
Für wen ist dieser Text bestimmt?
Dieser Text richtet sich an Leser, die sich für das Thema Glück und dessen kulturelle Vielfalt interessieren. Er eignet sich für akademische Zwecke, insbesondere für die Analyse von Themen im Bereich Kulturwissenschaften, Philosophie und Religionswissenschaften.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in den im Text zitierten Quellen und weiteren wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Glück und Kultur gefunden werden. Eine detailliertere Literaturrecherche zu den einzelnen Kulturen und philosophischen Traditionen ist empfehlenswert.
- Quote paper
- Janina Pletziger (Author), 2013, Der Glücksbegriff in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505883