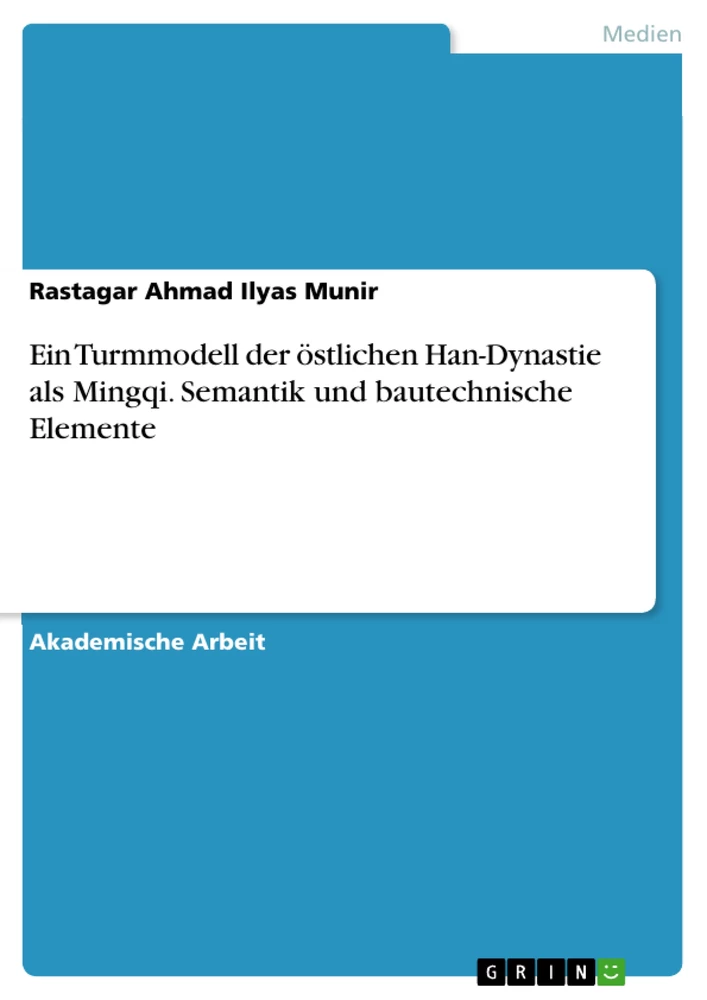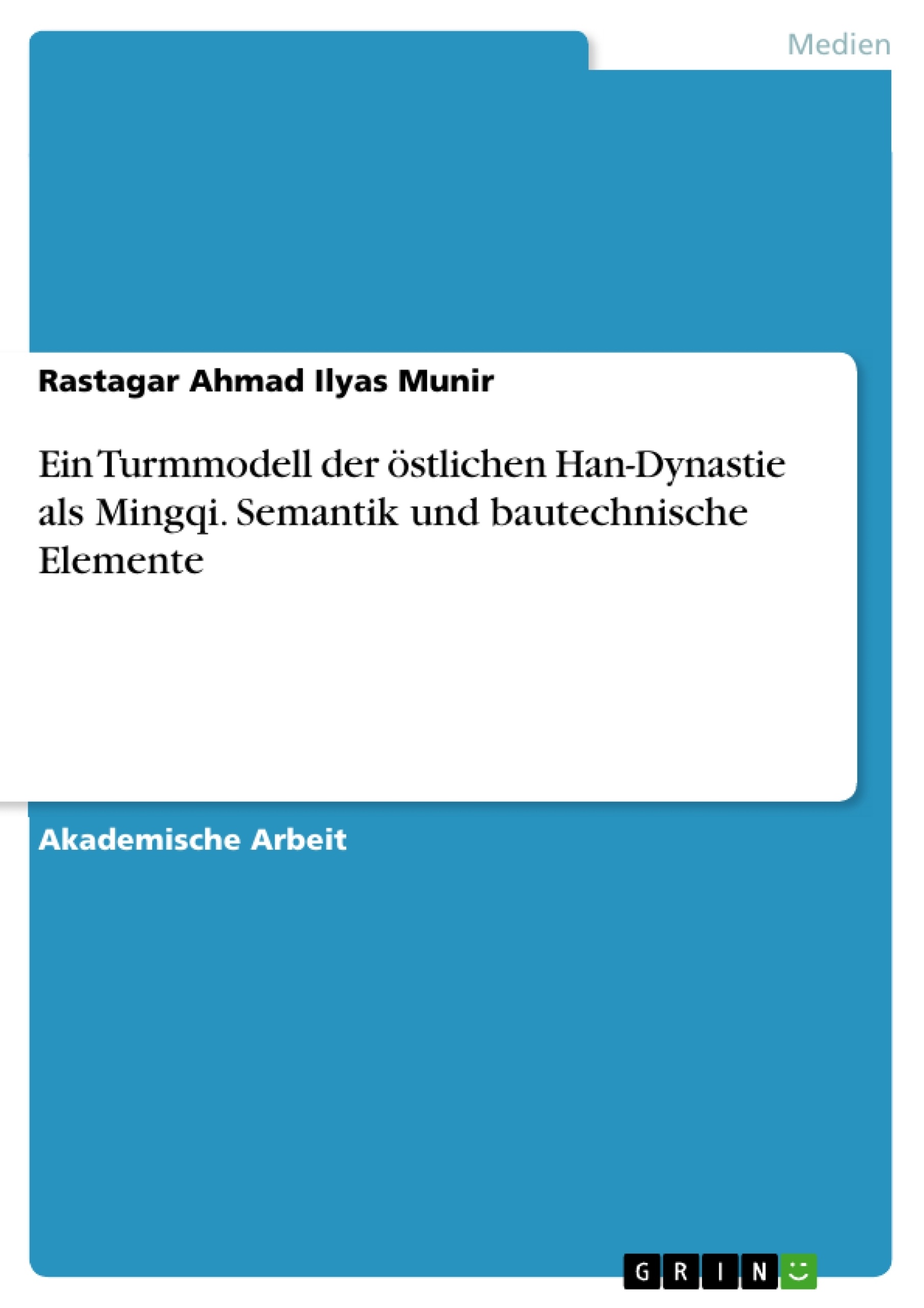Von allen Han-zeitlichen Mingqi in Form von Turmmodellen sind es vor allem die Funde aus Fucheng in Hebei, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Dies liegt darin begründet, dass sich diese Turmmodelle von anderen modellhaften Nachbildungen dieser nun nicht mehr erhaltenen Bauten in ihrer enormen Größe unterscheiden. Da diese Objektgruppe in der deutschsprachigen Sekundärliteratur bislang nur im Rahmen von Katalogtexten oder in kurzen Erwähnungen, jedoch nicht in Form von eigens dieser Objektgruppe gewidmeten Arbeiten bearbeitet wurden, versucht der Autor hiermit, diese Lücke etwas zu schließen.
In dieser Arbeit konzentriert sich der Autor auf einen 2,16 Meter hohen Wachturm aus glasierter Irdenware aus dem Hebei Institute of Archaeology. Er datiert in die östliche Han-Dynastie (25-220 n. Chr.) und ist das bislang höchste Turmmodell. 1990 wurde er in Sangzhuang, Fucheng, in Hebei in einem mehrräumigen Ziegelsteingrab entdeckt. Das Grab ist in der Ortschaft als "Maulbeerhaus" bekannt und verläuft von Westen nach Osten. Dieses Exemplar gehört zur Gruppe der Modelltürme mit Mezzaninen, welche nur in Hebei gefunden wurden. Ziel dieser Arbeit ist, die einzelnen bautechnischen und gestalterischen Elemente des Turmmodells zu analysieren, um schließlich dessen Semantik und dessen Funktion im Grab eruieren zu können.
Beim Übergang von der westlichen zur östlichen Han-Dynastie fand ein Wandel in der Thematik der Mingqi statt. Während in der ersteren bevorzugt anthropomorphe Figuren bei häuslichen Tätigkeiten oder Festen abgebildet wurden, verlagerte sich in der östlichen Han-Zeit, wohl bedingt durch das Aufkommen der Shi-Klasse des Feudalwesens , die Thematik hin zu Bauwerken. So wurden vor allem inmitten von Metropolregionen, wie in Henan, Hebei oder auch in Shanxi, Modelle größerer Architekturkomplexe produziert. Diese gaben nun konkrete und vertraute Orte wieder, was der zu dieser Zeit als Staatsideologie aufblühende Konfuzianismus forderte. Diese magische Imitation der realen Welt schaffte Orientierung im unbekannten Jenseits. Innerhalb der Architekturdarstellungen verdienen die Modelle von Türmen (lou) besondere Aufmerksamkeit. Diese geben neben den späteren Pagoden den einzigen Gebäudetyp innerhalb der chinesischen Architektur mit vertikaler Ausrichtung wieder, waren doch im chinesischen Formenreichtum horizontale Bauten von geringer Höhe vorherrschend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pingzuo und Umfassungsmauer
- Toreingang
- Soldatenfiguren mit Waffen
- Konsolensysteme
- Blattzierden
- Vogelfiguren
- Gong im obersten Geschoss
- Dachfirst
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ein 2,16 m hohes Wachturmmodell aus glasierter Irdenware aus der östlichen Han-Dynastie (25-220 n. Chr.), gefunden in einem Grab in Hebei. Ziel ist die Analyse der bautechnischen und gestalterischen Elemente, um die Semantik und Funktion des Modells im Grabkontext zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Architektur des Turms und seiner Bedeutung im Kontext der Han-Dynastie.
- Architektur der östlichen Han-Dynastie
- Funktion von Grabbeigaben (Mingqi)
- Apotropäische Elemente in der Architektur
- Soziokulturelle Bedeutung von Türmen
- Rekonstruktion verlorener Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Thematik von Grabbeigaben (Mingqi) während des Übergangs von der westlichen zur östlichen Han-Dynastie. Während in der westlichen Han-Zeit vor allem anthropomorphe Figuren im Vordergrund standen, konzentrierten sich die Grabbeigaben der östlichen Han-Zeit verstärkt auf Architekturmodelle, insbesondere Türme (lou), die den Gutsbesitz der Feudalklasse im Jenseits repräsentierten. Diese Modelle sind wichtige Quellen zur Rekonstruktion verlorener Architekturformen, da frühzeitliche Holzbauten nur spärlich erhalten sind. Die Arbeit konzentriert sich auf ein besonders hohes und detailreiches Turmmodell aus Hebei.
Pingzuo und Umfassungsmauer: Dieses Kapitel beschreibt die Plattform (pingzuo), auf der der Turm steht, und die ihn umgebende Mauer. Die Mauer ist mit einem parkettierten Muster aus Rauten und Kreisen verziert, das auch auf den Podesten des Turms vorkommt. Die Funktion der Mauer wird diskutiert: Sie definiert nicht nur den Bereich des Turms, sondern schützt ihn auch und könnte eine rituell-magische Bedeutung haben.
Toreingang: Der Toreingang des Turmmodells wird detailliert analysiert. Die geflügelte Tür ist mit Türklopfern in Form von Schreckensgestalten versehen, die apotropäische Funktionen hatten und Böses abwehren sollten. Die Wahl des Tores als Platzierung dieser Figuren ist signifikant, da es der einzige Zugang zum Bereich ist. Das Kapitel vergleicht diese Türklopfer mit ähnlichen Beispielen aus anderen Kontexten und diskutiert ihre transmediale Verwendung in Architektur und Alltagskultur. Das Kapitel beschreibt auch das Satteldach des Tores mit seinen Details und den darauf sitzenden Vögeln.
Schlüsselwörter
Östliche Han-Dynastie, Mingqi, Turmmodell, Architekturmodell, Grabbeigabe, Hebei, Sangzhuang, Apotropäisches, Bautechnik, Architekturgeschichte, Chinesische Architektur, Lou, Pingzuo, Ritual, Magie.
Häufig gestellte Fragen zum Wachturmmodell aus der östlichen Han-Dynastie
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Arbeit analysiert ein 2,16 m hohes Modell eines Wachturms aus glasierter Irdenware. Das Modell stammt aus der östlichen Han-Dynastie (25-220 n. Chr.) und wurde in einem Grab in Hebei gefunden. Es handelt sich um eine Grabbeigabe (Mingqi), die Aufschluss über die Architektur und die kulturellen Praktiken der damaligen Zeit gibt.
Welche Aspekte des Turmmmodells werden untersucht?
Die Analyse umfasst die bautechnischen und gestalterischen Elemente des Turms, inklusive der Plattform (Pingzuo), der Umfassungsmauer, des Toreingangs mit seinen apotropäischen Türklopfern, der Konsolen, Blattzierden, Vogelfiguren, des Gongs im obersten Geschoss und des Dachfirsts. Die Studie untersucht die Funktion des Modells im Grabkontext und seine Bedeutung im Kontext der Architektur der östlichen Han-Dynastie.
Was ist die Zielsetzung der Studie?
Die Hauptziele sind die Analyse der Architektur des Turms, die Bestimmung seiner Funktion als Grabbeigabe und die Interpretation seiner semiotischen Bedeutung. Die Studie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der Architektur, der religiösen Praktiken und der soziokulturellen Verhältnisse der östlichen Han-Dynastie zu gewinnen und zur Rekonstruktion verlorener Architektur beizutragen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die Architektur der östlichen Han-Dynastie, die Funktion von Grabbeigaben (Mingqi), apotropäische Elemente in der Architektur, die soziokulturelle Bedeutung von Türmen und die Rekonstruktion verlorener Architektur. Jedes Kapitel konzentriert sich auf einen spezifischen Aspekt des Turms, beginnend mit der Einleitung und der Beschreibung des Kontextes bis hin zur detaillierten Analyse einzelner Elemente.
Welche Bedeutung haben die apotropäischen Elemente?
Die apotropäischen Elemente, wie die Schreckensgestalten an den Türklopfern des Tores, dienten dem Schutz vor bösen Geistern und hatten eine rituell-magische Funktion. Ihre Platzierung am einzigen Zugang zum Turm unterstreicht ihre Bedeutung für den Schutz des Modells und möglicherweise auch des darin symbolisierten Besitzers im Jenseits.
Wie trägt die Studie zur Architekturgeschichte bei?
Da frühzeitliche Holzbauten aus der Han-Dynastie nur spärlich erhalten sind, liefern solche detaillierten Architekturmodelle wertvolle Informationen für die Rekonstruktion verlorener Architekturformen. Die Studie leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der chinesischen Architekturgeschichte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Studie prägnant beschreiben, sind: Östliche Han-Dynastie, Mingqi, Turmmodell, Architekturmodell, Grabbeigabe, Hebei, Sangzhuang, Apotropäisches, Bautechnik, Architekturgeschichte, Chinesische Architektur, Lou, Pingzuo, Ritual, Magie.
- Quote paper
- Rastagar Ahmad Ilyas Munir (Author), 2019, Ein Turmmodell der östlichen Han-Dynastie als Mingqi. Semantik und bautechnische Elemente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506014