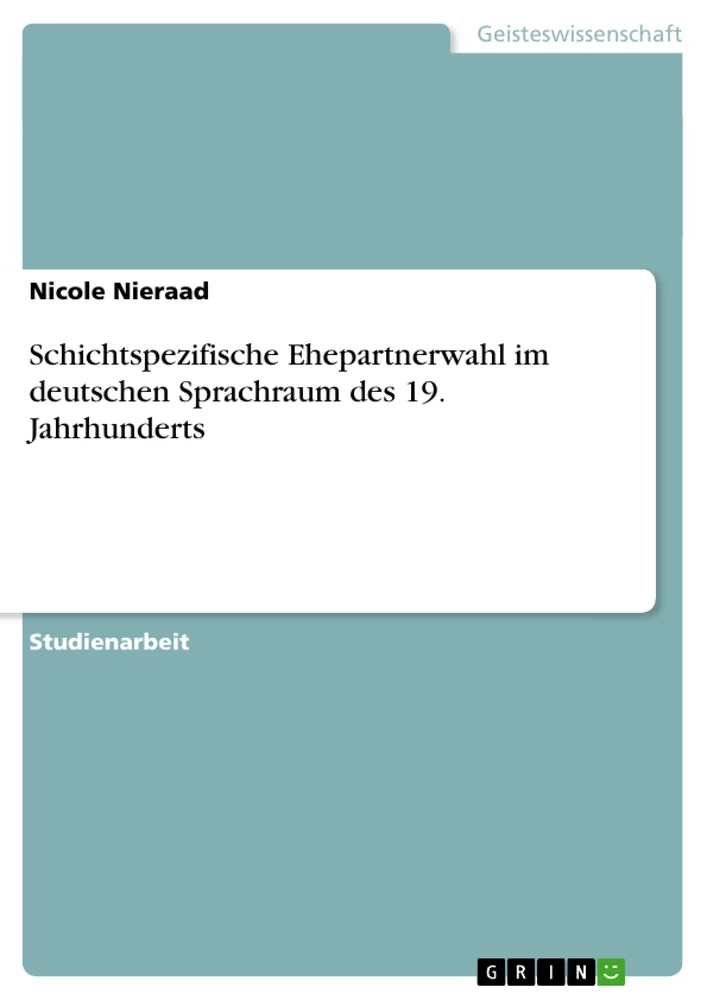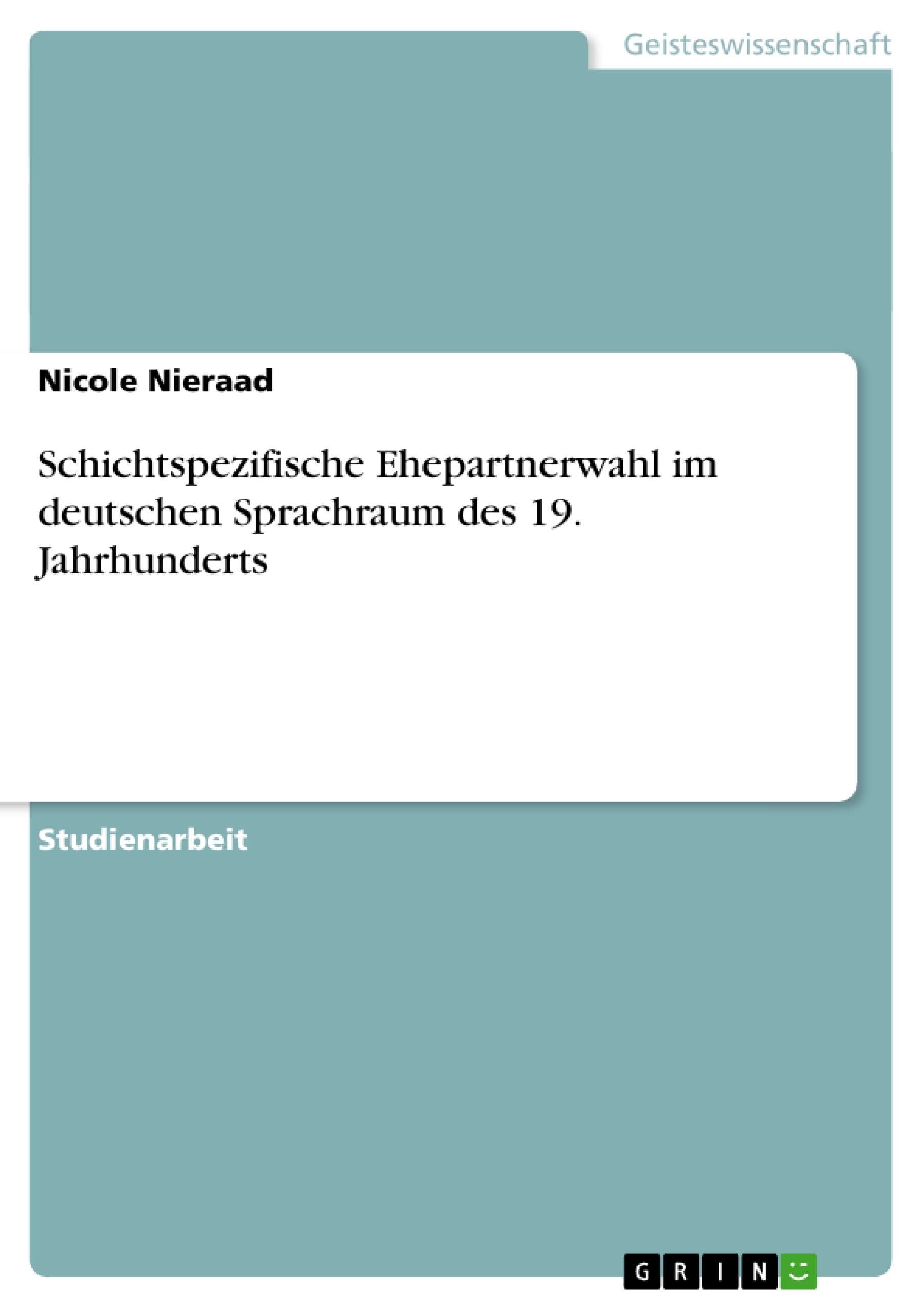„Die Familie ist wohl genau so alt wie die menschliche Kultur. Ja, man könnte mit einem gewissen Recht auch die Meinung vertreten, Familie und Ehe seien älter als die menschliche Kultur.“, schreibt René König. Auch im alltäglichen Verständnis wird Familie als statisches Gebilde angesehen. Auch in der historischen Familienforschung wird oft der soziokulturelle Kontext außer Acht gelassen. Doch da Familie ein soziales Gebilde ist, wird sie stark beeinflusst von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Strukturen. Alle Lebensformen einer Gesellschaft sind abhängig von der materiellen Produktion. Somit unterschieden sich je nach sozialer Schicht und Erwerbsquelle die jeweiligen Beziehungen der Familienmitglieder, die Sozialisation, die familiären Rollen und entsprechend das Alltagsleben gravierend voneinander. Auch die Ehe war somit großen Differenzierungen unterworfen.
Durch Modernisierungsprozesse wie Urbanisierung und Industrialisierung entstanden immer mehr Möglichkeiten, seinen produzierenden Beruf getrennt vom Haushalt auszuüben. Durch diese Trennung konnte sich die Privatisierung der Familie erst entwickeln. Nicht zu unterschätzen ist hierbei das Entstehen und Wirken des „bürgerlichen Familienideals“. Dieses Leitbild, das neben der Liebesehe u.a. auch die Konzentration auf Kinder mit einschloss, entwickelte sich schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Doch erst durch Prozesse wie Vergesellschaftung und Ausdifferenzierung des Bereichs „Familie“ im Laufe des 19. Jahrhunderts konnte das Ideal seine Wirkung auf weitere Teile der Bevölkerung ausdehnen. Der eigene Wohnbereich wurde zum ersten Mal zu einem intimen Raum, in dem persönliche, intensive Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern stattfinden konnten. In diesem Zusammenhang kann auch die Aufwertung des emotionalen und sexuellen Verhältnisses zwischen den Ehepartnern verstanden werden. So vereinheitlichte sich die Produktion in großen Teilen der Gesellschaft und die Familienstrukturen schienen sich aus heutiger Betrachtung anzugleichen. Dennoch betraf diese Entwicklung hauptsächlich Schichten, bei denen die Trennung der Intimsphäre von der Produktion tatsächlich wirtschaftlich realisierbar war.
Dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Erfordernissen, Produktion, Eheideal und Eherealität wird verdeutlicht am Beispiel der unterschiedlichen Kriterien zur Wahl des Ehepartners in verschiedenen Schichten der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Heiratsverhalten im Bürgertum
- Spätes 18. Jahrhundert
- Bürgerliches Liebesideal
- Eherealität
- Spätes 19. Jahrhundert
- Spätes 18. Jahrhundert
- Heiratsverhalten in Handwerksfamilien
- Notwendigkeit der Ehe für den handwerklichen Haushalt
- Kriterien der Wahl
- Heiratsverhalten bei Hausindustriellen
- Wichtigkeit der Ehe für die Heimarbeiterfamilie
- Auswahlkriterien
- Proletarisches Eheverständnis
- Ehepartnerwahl bei den Bauern
- Stellenwert der Ehe in der bäuerlichen Gesellschaft
- Kriterien der Partnerwahl
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der schichtspezifischen Ehepartnerwahl im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die unterschiedlichen Kriterien und Normen der Partnerwahl in verschiedenen sozialen Schichten aufzuzeigen und zu analysieren, wie diese von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Zwängen beeinflusst wurden.
- Einfluss von gesellschaftlichen Strukturen und Produktionsformen auf Familienleben und Ehe
- Entwicklung des bürgerlichen Familienideals und seine Auswirkungen auf die Partnerwahl
- Schichtenspezifische Unterschiede in der Partnerwahl im 19. Jahrhundert
- Rolle von Liebe, wirtschaftlichen Erwägungen und sozialen Normen bei der Partnerwahl
- Veränderung des Familienverständnisses im Kontext von Urbanisierung und Industrialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Das Kapitel legt den Fokus auf die Veränderung des Familienbildes im Laufe der Geschichte, unterstreicht die soziale Konstruktion von Familie und die Bedeutung von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Familienstrukturen. Die Einbindung der Familie in den Produktionsprozess und die daraus resultierende Abhängigkeit von ökonomischen Faktoren werden beleuchtet.
- Heiratsverhalten im Bürgertum: Dieser Abschnitt thematisiert die Entwicklung des bürgerlichen Liebesideals im späten 18. Jahrhundert. Die ideologische Entkopplung der Partnerwahl von wirtschaftlichen Erwägungen sowie die Betonung von Werten wie Enthaltsamkeit, Leistung und Innerlichkeit werden hervorgehoben. Der Unterschied zwischen „vernünftiger Liebe“ und „romantischer Leidenschaft“ wird erklärt.
- Heiratsverhalten in Handwerksfamilien: Hier wird die Notwendigkeit der Ehe für den handwerklichen Haushalt und die damit verbundenen Kriterien der Partnerwahl beleuchtet.
- Heiratsverhalten bei Hausindustriellen: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung der Ehe für die Heimarbeiterfamilie und die spezifischen Auswahlkriterien, die in diesem Kontext Anwendung finden.
- Proletarisches Eheverständnis: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Eheverständnis in der proletarischen Schicht.
- Ehepartnerwahl bei den Bauern: Hier werden der Stellenwert der Ehe in der bäuerlichen Gesellschaft und die entscheidenden Kriterien der Partnerwahl betrachtet.
Schlüsselwörter
Schichtenspezifische Ehepartnerwahl, Familienstrukturen, bürgerliches Familienideal, Liebesideal, Industrialisierung, Urbanisierung, Produktionsprozess, ökonomische Faktoren, soziale Normen, Heiratsverhalten, Handwerksfamilien, Hausindustrielle, Proletariat, Bauern.
- Citation du texte
- M.A. Nicole Nieraad (Auteur), 2003, Schichtspezifische Ehepartnerwahl im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50621