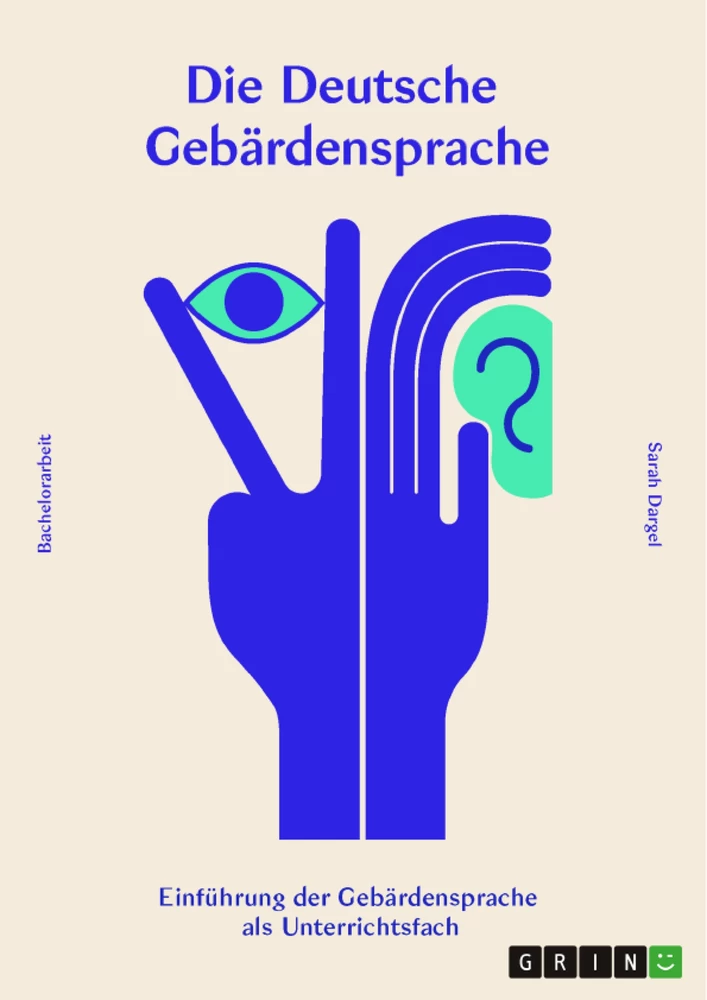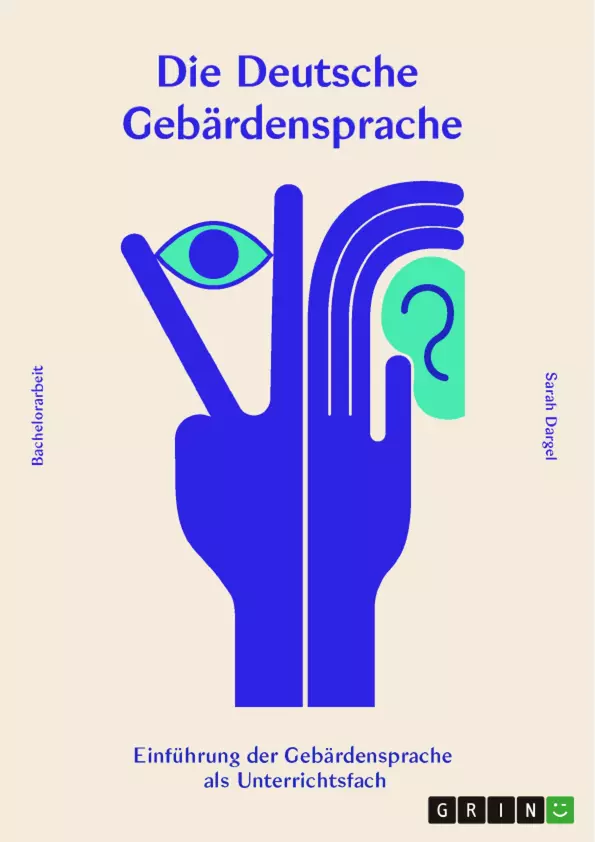Gehörlosigkeit muss nicht soziale Isolation bedeuten. Deshalb werde ich mich in dieser Arbeit damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es gibt die Gebärdensprache für hörende Menschen präsenter zu machen.
Schon Paul Watzlawick sagte "Man kann nicht nicht kommunizieren." Demzufolge gibt es viele Möglichkeiten der Kommunikationen. Nicht nur verbal, sondern auch nonverbal, durch Mimik, Gestik, Körperhaltung. In Deutschland ist es vor allem die Lautsprache, die verwendet wird. Doch es gibt einige Menschen, die die Lautsprache nicht wahrnehmen können. Diese Menschen sind gehörlos. Einige von ihnen sind von Geburt an gehörlos, andere verlieren ihr Gehör im Kindes-, Jugend- oder Erwachsenenalter.
Viele gehörlose Menschen verwenden die Gebärdensprache um sich (untereinander) zu verständigen. "Die Gebärdensprache ermöglicht Gehörlosen eine entspannte und verlässliche Kommunikation. Diese Sprache ist aber noch mehr: Sie bildet die Grundlage einer eigenen Sprachgemeinschaft und Kultur, zu der sich auch Hörende, die die Gebärdensprache beherrschen, zugehörig fühlen."
Gegenwärtig sind in Deutschland nur wenig hörende Menschen in der Lage die Gebärdensprache anzuwenden. Die Gehörlosengemeinschaft erscheint meines Erachtens dadurch relativ isoliert. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Hörende meist kaum Kontakt mit Gehörlosen haben. Außerdem entsteht der Eindruck, dass Hörende wenig Wissen über die Gehörlosen, ihre Kultur und vor allem die Gebärdensprache haben. Seit ich an dieser Hochschule studiere und den Gebärdensprachkurs besuche, habe ich zunehmend ein großes Interesse an der Gebärdensprache entwickelt. Während dieser drei Jahre und vor allem jetzt in der Zeit des Schreibens dieser Bachelorarbeit habe ich mit vielen Freunden, Kollegen, und Bekannten gesprochen, die kaum etwas über die Gebärdensprache wussten.
Dabei rückte insbesondere die Fragestellung, ob die Gebärdensprache international gültig sei, in den Fokus. Dieser Fragestellung werde ich mich im Laufe dieser Arbeit noch widmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gehörlosigkeit und Hörschädigungen
- 3 Gebärdensprache
- 3.1 Definition
- 3.2 Geschichte
- 3.3 Verbreitung
- 3.4 Aufbau und Struktur von Gebärden
- 4 Bedingungen des Gebärdenspracherwerbs
- 5 Gebärdensprache im deutschen Schulsystem
- 5.1 Gebärdensprache als Unterrichtsfach
- 5.1.1 Inhalte im Gebärdensprachunterricht
- 5.1.2 Leistungsbeurteilung im Unterricht
- 5.2 Gebärdensprache als Fremdsprache
- 5.3 Bilingualer Unterricht und Chancengleichheit in Erziehung und Bildung
- 5.1 Gebärdensprache als Unterrichtsfach
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gebärdensprache und deren Bedeutung für gehörlose Menschen in Deutschland. Das Ziel ist, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Gebärdensprache für hörende Menschen präsenter zu machen und so die soziale Isolation gehörloser Menschen zu verringern.
- Die Rolle der Gebärdensprache in der Kommunikation und Kultur gehörloser Menschen
- Die Integration der Gebärdensprache in das deutsche Schulsystem
- Der Einfluss der Gebärdensprache auf Chancengleichheit in Erziehung und Bildung
- Die Möglichkeiten der Gebärdensprache als Unterrichts- oder Fremdsprachenfach
- Die Bedeutung des bilingualen Unterrichts für gehörlose und hörende Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der sozialen Isolation gehörloser Menschen dar und erklärt die Notwendigkeit, die Gebärdensprache im deutschen Bildungssystem stärker zu integrieren.
- Kapitel 2: Gehörlosigkeit und Hörschädigungen: Dieses Kapitel erklärt verschiedene Formen der Gehörlosigkeit, Ursachen und die Rolle des Cochlea-Implantats.
- Kapitel 3: Gebärdensprache: Hier werden die Definition, Geschichte, Verbreitung und der Aufbau der Gebärdensprache erläutert.
- Kapitel 4: Bedingungen des Gebärdenspracherwerbs: Dieses Kapitel fokussiert auf die Unterschiede im Erwerb der Gebärdensprache bei angeborener und erworbener Gehörlosigkeit.
- Kapitel 5: Gebärdensprache im deutschen Schulsystem: Es werden die Möglichkeiten der Integration der Gebärdensprache als Unterrichtsfach, die relevanten Inhalte und die Leistungsbewertung behandelt. Auch der bilinguale Unterricht und die Chancengleichheit in Erziehung und Bildung werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gebärdensprache, Gehörlosigkeit, inklusive Bildung, Chancengleichheit, Sprachentwicklung, Kommunikation, Schulsystem, Unterrichtsfach, bilinguale Pädagogik. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Gebärdensprache als Mittel zur Inklusion und zur Stärkung der Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen.
- Quote paper
- Sarah Dargel (Author), 2019, Die deutsche Gebärdensprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506220