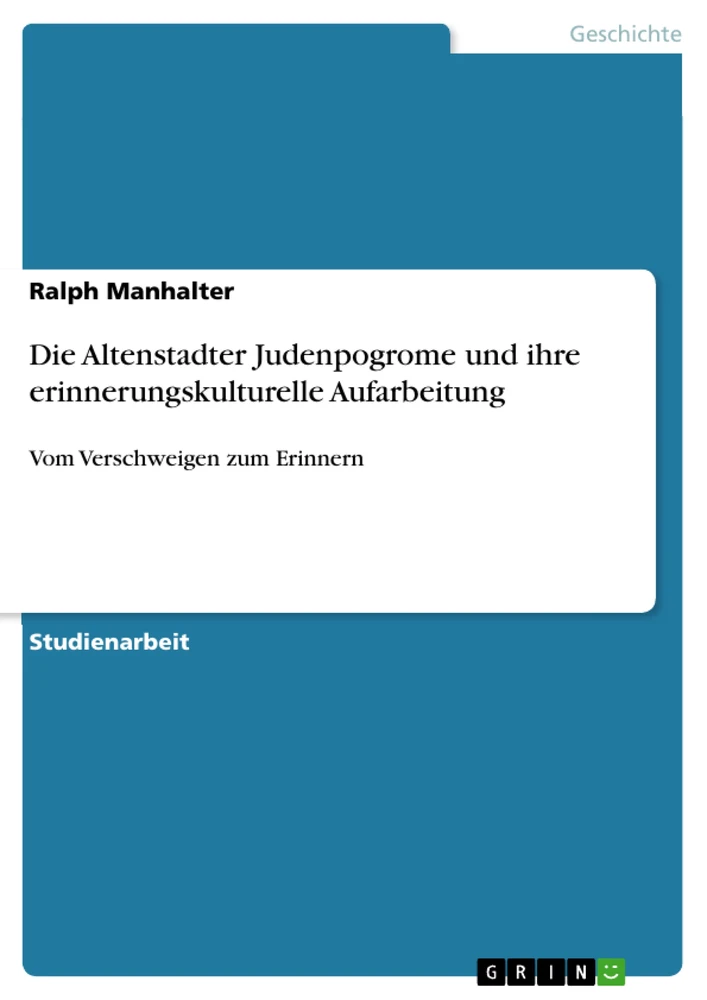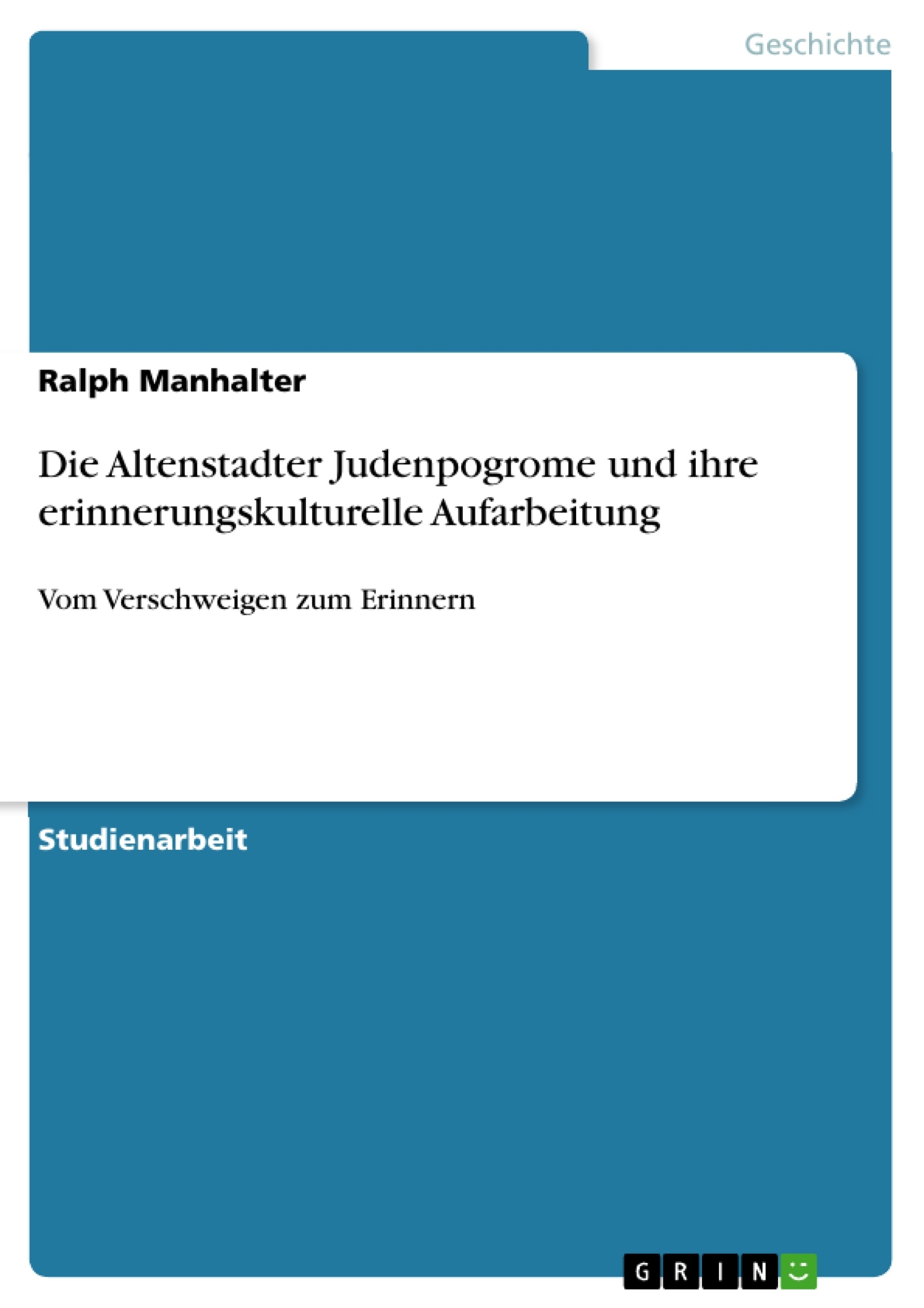Vielleicht gibt es kein Tätertrauma, dennoch ist die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik zunächst geprägt von einer Kultur des Verdrängens und Verschweigens der Greueltaten des Dritten Reiches. Dieses nahezu alle Schichten berührende Phänomen soll anhand einer regionalen Untersuchung näher beleuchtet werden. Dabei richtet sich der Blick stets auch auf die gesamtdeutsche Situation und versucht, die örtlichen Ereignisse damit in Einklang zu bringen. Mit Blick auf den deutschen Südwesten - hier das heutige Bundesland Baden-Württemberg sowie den grenznahen bayerischen Teil – schildert die Arbeit anhand mehrerer Beispiele den Umgang der einheimischen Bevölkerung mit dem lokalen jüdischen Erbe in den vergangenen Jahrzehnten.
Die Untersuchung erfährt eine exaktere Präzision bei der Beleuchtung der Umstände, welche zum Abbruch der ehemaligen Synagoge in Altenstadt führten. Dieses Ereignis ist primär im Kontext der erinnerungskulturellen Situation in den ersten Nachkriegsjahren zu sehen. Hierzu wurden erstmals schriftliche und mündliche Quellen ausgewertet und chronologisch zusammengestellt. Aus dieser Position heraus wagt der Verfasser einen Ausblick, nicht nur auf die lokale Situation, sondern anhand jüngerer politischer Ereignisse auch auf deren Auswirkung auf die deutsche Erinnerungskultur
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Nachkriegserinnerung und Behandlung jüdischen Kulturgutes im Südwesten mit Hinblick auf den gesamtdeutschen Kontext
- Genese und Vernichtung der Altenstadter Judengemeinde
- Wandel der Erinnerungsmentalität am Beispiel Altenstadt
- Die ersten Jahre bis 1955
- Der Beginn einer Erinnerung
- Jüngste Entwicklungen und Gegenwart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Erinnerungskultur und Aufarbeitung der Altenstadter Judenpogrome im Kontext der Nachkriegszeit. Sie betrachtet den Wandel der Erinnerungskultur und beleuchtet die Schwierigkeiten der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
- Die Entwicklung der Erinnerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Bedeutung der unmittelbaren Nachkriegserfahrung für die Aufarbeitung der Vergangenheit
- Der Umgang mit jüdischem Kulturgut im Südwesten Deutschlands
- Die Rolle der Erinnerungskultur in der Vergangenheitsbewältigung
- Der Wandel der Erinnerungskultur im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit stellt die Thematik der Erinnerung an die Altenstadter Judenpogrome in den Kontext des Kriegsendes und der damit einhergehenden Nachkriegszeit. Sie beleuchtet den Einfluss des Generationenwechsels auf die Erinnerungskultur und die Bedeutung von Zeitzeugenberichten.
- Die Nachkriegserinnerung und Behandlung jüdischen Kulturgutes im Südwesten mit Hinblick auf den gesamtdeutschen Kontext: Dieses Kapitel analysiert die schwierige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit und die Bedeutung der Verdrängung als Reaktion auf traumatische Ereignisse. Es wird auf die unterschiedlichen Strategien der Erinnerungskultur in West- und Ostdeutschland eingegangen.
- Genese und Vernichtung der Altenstadter Judengemeinde: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Altenstadter Judengemeinde und deren Vernichtung im Zuge der nationalsozialistischen Herrschaft. Es setzt die Fokussierung auf den Wandel der Erinnerungskultur im Laufe der Zeit fort.
- Wandel der Erinnerungsmentalität am Beispiel Altenstadt: Dieses Kapitel betrachtet die Entwicklung der Erinnerungskultur in Altenstadt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es analysiert die unterschiedlichen Phasen der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und beleuchtet die Rolle von Zeitzeugenberichten und historischen Forschungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erinnerungskultur, Aufarbeitung der Vergangenheit, Holocaust, Judenpogrome, Altenstadt, Südwesten Deutschlands, Nachkriegszeit, Zeitzeugen, Verdrängung, Trauma, Generationenwechsel, Geschichtsbewusstsein.
- Citation du texte
- Ralph Manhalter (Auteur), 2019, Die Altenstadter Judenpogrome und ihre erinnerungskulturelle Aufarbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506903