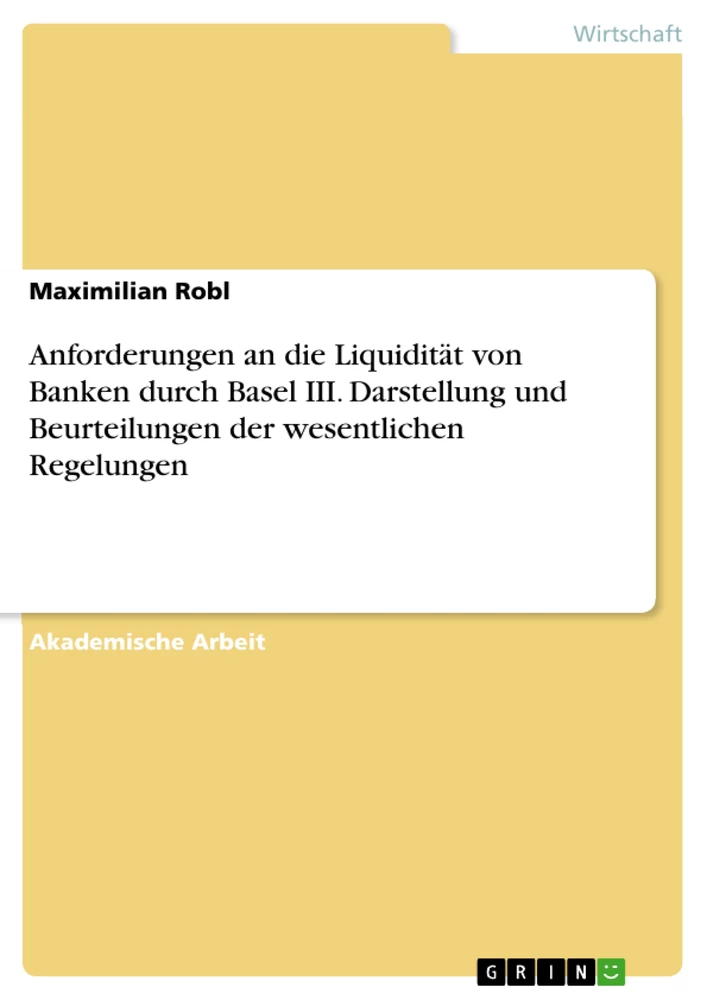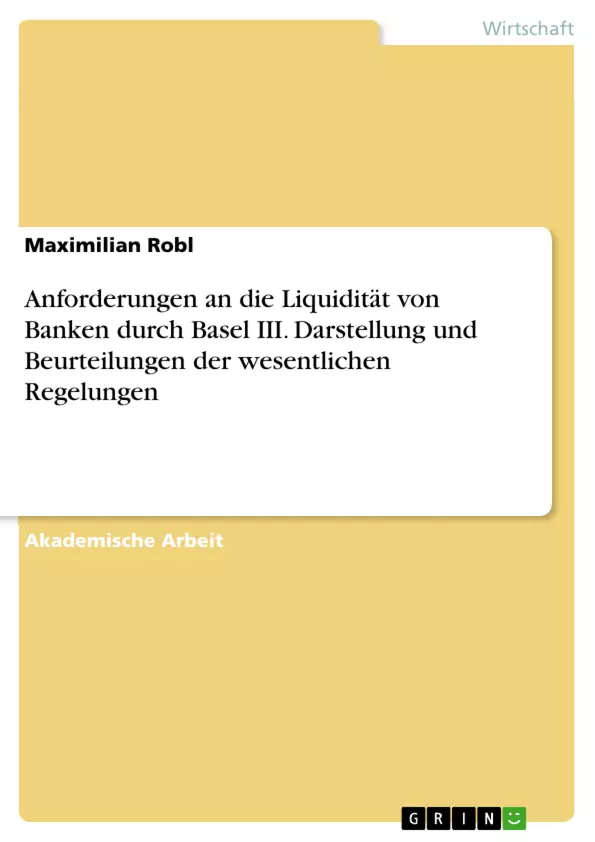In der Arbeit werden die wesentlichen Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen nach Basel III erläutert. Die Eigenkapitalrichtlinie Basel III wurde 2010 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht beschlossen. Im Ausschuss sitzen sowohl Mitglieder der Notenbanken als auch Bankaufseher aus 27 Ländern. Ziel des Ausschusses war es, die Widerstandsfähigkeit des kompletten Bankensektors gegenüber Stresssituationen im Bereich der Finanzdienstleistungen signifikant zu erhöhen. Diese Entscheidung fiel, nachdem im Jahr 2007 während der weltweiten Finanzkrise klar wurde, dass das vorhandene Eigenkapital im Verhältnis zu den Risiken meist nicht ausreichte und daher führende Großbanken von den jeweiligen Staaten gerettet werden mussten. Die bis dahin geltende Eigenkapitalrichtlinie Basel II wurde 2010 im Zuge einer Modifizierung durch Basel III ersetzt. Grundsätzlich regelt Basel III die gleichen Sektionen wie Basel II, jedoch in verschärftem Maße. Vor allem die Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen wurden einer Neuordnung unterzogen. Das Eigenkapital einer Bank setzt sich aus hartem Kernkapital, weichem Kernkapital und Ergänzungskapital zusammen.
Das harte Kernkapital dient als Stabilisator in möglichen Krisensituationen und besteht aus mehreren Elementen. Es setzt sich weitgehend zusammen aus Stammaktien, beziehungsweise deren Äquivalent bei Nicht-Aktiengesellschaften, aus Gewinnrücklagen der Bank und aus anderen offenen Rücklagen. Zudem besteht es sowohl aus Aufgeld, das aus der Emission von Stammaktien stammt, als auch aus eingeschränkten Minderheitenanteilen Dritter am harten Kernkapital, vorausgesetzt, diese erfüllen die Anerkennungskriterien. Das weiche Kernkapital setzt sich aus schwächeren Bestandteilen bezüglich der Verlustteilnahme zusammen. Darunter fallen etwa stille Einlagen, falls diese die vorgegebenen Kriterien des weichen Kernkapitals erfüllen, sowie Kapitalinstrumente wie Vorzugsaktien und das Aufgeld, das aus der Emission dieser gewonnen wird. Auch das weiche Kernkapital kann Minderheitenanteile Dritter enthalten, solange die Kriterien zur Anerkennung erfüllt sind. Das Ergänzungskapital ist ebenfalls ein Bestandteil des Eigenkapitals einer Bank und beinhaltet beispielsweise Genussrechte und langfristige Verbindlichkeiten, jedoch wiederum nur, falls diese den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Eigenkapital- und Liquiditätsregeln
- Erhöhung der Qualität des Kapitals
- Quantitative Verschärfungen
- Kapitalpuffer
- Kontrahentenrisiko
- Neue Liquiditätsregeln nach Basel III
- Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
- Leverage Ratio
- Rechtliche Umsetzung
- Bewertung der Regelung nach Basel III
- Positiv
- Negativ
- Persönliches Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln, die durch das Abkommen Basel III eingeführt wurden. Ziel ist es, die wesentlichen Regelungen des Abkommens darzustellen und zu beurteilen, wobei die Fokussierung auf die Anpassung der Anforderungen an die Qualität des Eigenkapitals und die Einführung neuer Liquiditätskennzahlen liegt.
- Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen
- Einführung neuer Liquiditätskennzahlen
- Qualitätsverbesserung des Eigenkapitals
- Rechtliche Umsetzung von Basel III
- Bewertung der Auswirkungen von Basel III auf die Bankenlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Basel III und dessen Entstehungsgeschichte im Kontext der Finanzkrise von 2007 dar. Die Studie beleuchtet die Notwendigkeit einer erhöhten Kapitalausstattung und die Einführung neuer Liquiditätsvorschriften, um die Widerstandsfähigkeit von Banken gegenüber zukünftigen Krisen zu stärken.
- Neue Eigenkapital- und Liquiditätsregeln: Dieses Kapitel behandelt die Kernpunkte von Basel III und erläutert die Veränderungen in Bezug auf die Eigenkapitalanforderungen und die Einführung neuer Liquiditätskennzahlen. Es werden die einzelnen Komponenten des Eigenkapitals detailliert beschrieben und die Steigerungen des harten Kernkapitals sowie die Senkungen des weichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals erläutert.
- Erhöhung der Qualität des Kapitals: Der Abschnitt fokussiert sich auf die qualitative Verbesserung des Eigenkapitals. Er beschreibt die erhöhte Gewichtung von qualitativ hochwertigen Eigenkapitalkomponenten und analysiert die Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Eigenkapitals.
- Neue Liquiditätsregeln nach Basel III: Dieses Kapitel erläutert die neuen Liquiditätsregelungen, die durch Basel III eingeführt wurden. Es stellt die Liquidity Coverage Ratio, die Net Stable Funding Ratio und die Leverage Ratio vor und erklärt deren Bedeutung für die Liquiditätsvorsorge von Banken.
Schlüsselwörter
Die Studie beleuchtet zentrale Themen wie Eigenkapital, Liquidität, Basel III, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätskennzahlen, Kapitalpuffer, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Finanzkrise, Bankenaufsicht, Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde das Abkommen Basel III eingeführt?
Basel III wurde als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise von 2007 entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors gegenüber Stresssituationen zu erhöhen.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Basel II und Basel III?
Basel III verschärft die bereits in Basel II bestehenden Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen erheblich und führt neue Kennzahlen ein.
Woraus setzt sich das 'harte Kernkapital' einer Bank zusammen?
Es besteht weitgehend aus Stammaktien, Gewinnrücklagen und anderen offenen Rücklagen, die als Stabilisator in Krisen dienen.
Was versteht man unter der 'Liquidity Coverage Ratio' (LCR)?
Die LCR ist eine neue Liquiditätskennzahl, die sicherstellen soll, dass Banken über genügend erstklassige liquide Aktiva verfügen, um einen 30-tägigen Stressszenario zu überstehen.
Was ist die 'Leverage Ratio'?
Die Leverage Ratio ist eine nicht risikogewichtete Höchstverschuldungsquote, die das Verhältnis des Kernkapitals zur gesamten Engagementsposition einer Bank begrenzt.
Welche Rolle spielen Kapitalpuffer bei Basel III?
Kapitalpuffer dienen dazu, in wirtschaftlich guten Zeiten zusätzliches Kapital aufzubauen, das in Krisenzeiten zur Verlustabdeckung genutzt werden kann.
- Citation du texte
- Maximilian Robl (Auteur), 2016, Anforderungen an die Liquidität von Banken durch Basel III. Darstellung und Beurteilungen der wesentlichen Regelungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506932