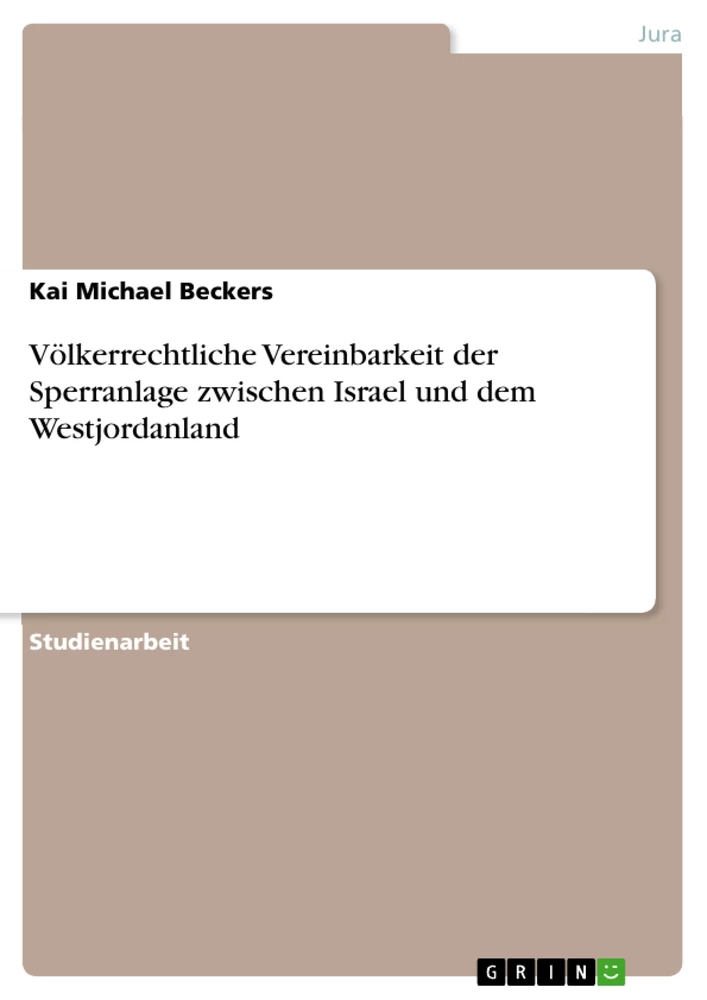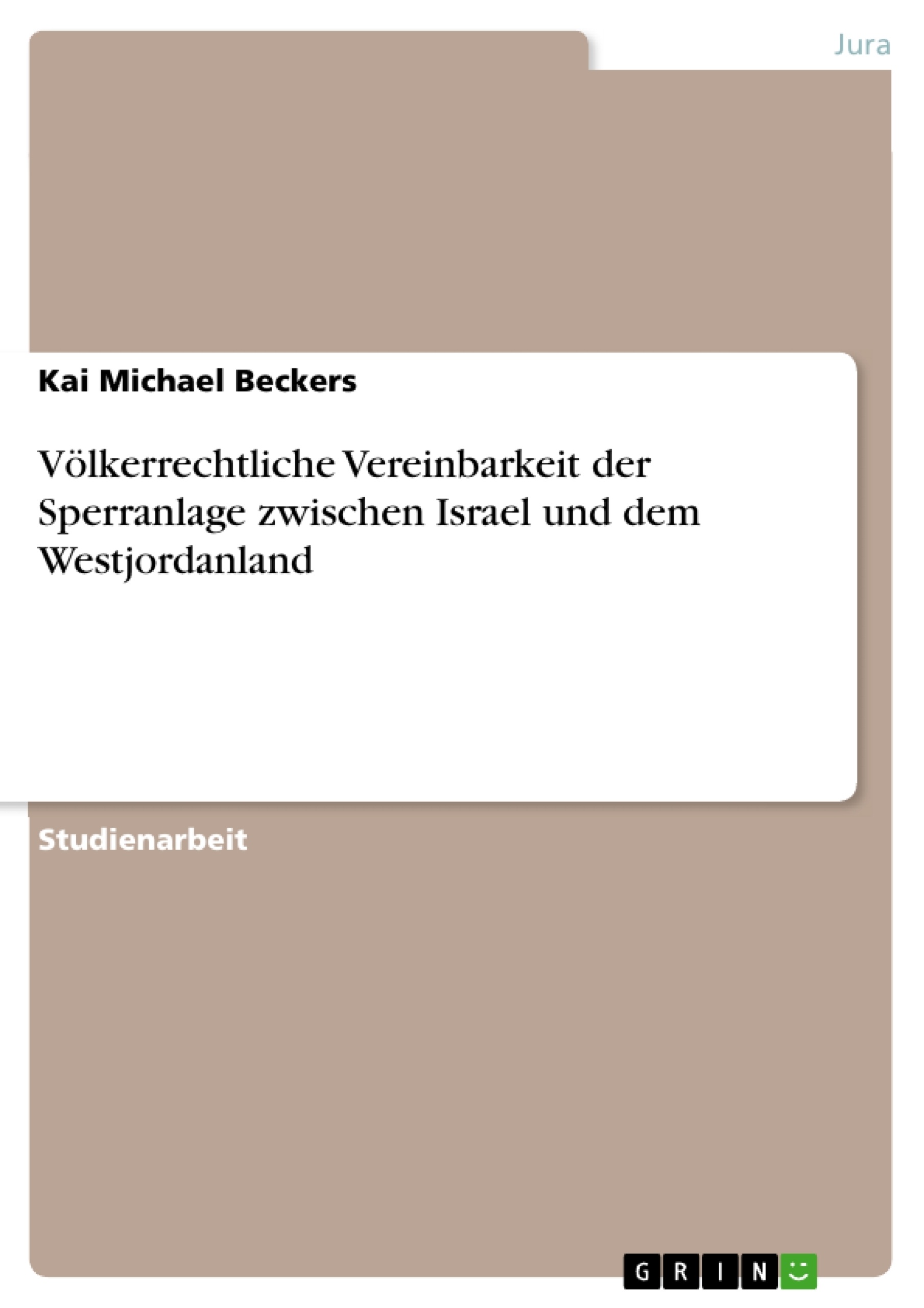In dieser Arbeit soll es zu einer Darstellung des historischen Hintergrunds des Nahostkonfliktes, sowie der einschlägigen gerichtlichen Entscheidungen kommen. Es handelt sich um eine rechtliche Diskussion über die völkerrechtliche Vereinbarkeit der Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland. Dabei wird beginnend ausführlich auf den historischen Hintergrund eingegangen, um die Kernfragen für jeden Leser zugänglich zu machen. Anschließend wird die Frage der Vereinbarkeit aus Sicht verschiedener Rechtsinstitutionen beleuchtet und diskutiert. Außerdem wird genauer auf die Schutzbedürftigkeit beider Parteien eingegangen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird außerdem betrachtet, welche internationalen Bemühungen in den letzten Jahren getätigt wurden, um den Konflikt zu beenden und wo deren rechtliche Probleme lagen.
Es ist seit Jahrzehnten nahezu ein Ding der Unmöglichkeit eine zufriedenstellende Lösung für den Nahostkonflikt zwischen den jüdischen Israelis und den muslimischen Palästinensern zu finden. Es geht um den Anspruch von heiligen Stätten, über Siedlungsbau bis hin zu Terroranschlägen. Um sich vor diesen Anschlägen schützen zu können, baute Israel mit Beginn dieses Jahrhunderts eine über 750 Kilometer lange Sperranlage, welche verhindern sollte, dass muslimische Attentäter Zugang zu israelischem Territorium bekommen, um dort Anschläge zu verüben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Geschichtlicher Hintergrund der Sperranlagen zwischen Israel und dem Westjordanland
- I. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Yom Kippur-Krieg
- 1. Der UN-Teilungsplan und seine Folgen
- 2. Suezkrise von 1956
- 3. Veränderungen durch den Sechs-Tage-Krieg im Jahre 1967 und den Yom Kippur-Krieg 1973
- II. Die erste Intifada und die Al-Aqsa-Intifada als Begründung zum Bau der Sperranlagen
- III. Verlauf - Begrifflichkeit – Beschaffenheit - Folgen
- I. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Yom Kippur-Krieg
- C. Rechtsgrundlage und Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts
- I. Einordnung der auf israelisch Gebiet liegenden Abschnitte der Anlage
- II. Einordnung der Teile der Sperranlage auf dem Gebiet des Westjordanland
- III. Anwendung der Haager Landkriegsordnung (HLKO)
- 1. Aus Sicht des IGH
- 2. Aus Sicht Israels
- IV. Anwendbarkeit des IV. Genfer Abkommens
- D. Rechtsgrundlage und Anwendbarkeit von Menschenrechtsnormen
- I. Existenz eines palästinensischen Volkes
- E. Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes
- I. Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung und Verstoß gegen Art 49 Abs. 6 IV. GK
- II. Verletzung des völkerrechtlichen Schutzes der palästinensischen Bevölkerung
- III. Israels Rechtfertigung durch das Notstandsrecht
- F. Entscheidungen des israelischen Verfassungsgerichts
- I. Die „Beit Sourik“-Entscheidung des ISC vom 30. Juni 2004
- II. Die,,Alfei Menashe\"-Entscheidung des ISC vom 15. September 2005
- III. Der Bil'in-Fall vom 4. September 2007
- IV. Resümee der israelischen Urteile
- G. Folgen des IGH Gutachtens und die aktuelle Situation
- H. Ist die Sperranlage mit der innerdeutschen Mauer vergleichbar?
- I. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland. Sie analysiert die historische Entwicklung des Nahostkonflikts, die juristischen Aspekte der Sperranlage im Lichte des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, sowie die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des israelischen Verfassungsgerichts.
- Historischer Hintergrund des Nahostkonflikts und die Entwicklung der Sperranlagen
- Rechtliche Einordnung der Sperranlage im Rahmen des humanitären Völkerrechts
- Anwendbarkeit des IV. Genfer Abkommens und der Haager Landkriegsordnung
- Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes im Kontext der Sperranlage
- Vergleich der Sperranlage mit der innerdeutschen Mauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Nahostkonflikts und die Rolle der Sperranlage dar. Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des Konflikts, beginnend mit dem Ersten Weltkrieg, dem UN-Teilungsplan, der Suezkrise und den Kriegen von 1967 und 1973. Kapitel C befasst sich mit der Rechtsgrundlage und Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf die Sperranlage, wobei die Haager Landkriegsordnung und das IV. Genfer Abkommen im Vordergrund stehen. Kapitel D untersucht die Anwendbarkeit von Menschenrechtsnormen, insbesondere die Existenz eines palästinensischen Volkes. Kapitel E beschäftigt sich mit der Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes durch die Sperranlage, insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung und den völkerrechtlichen Schutz der Bevölkerung. Kapitel F analysiert Entscheidungen des israelischen Verfassungsgerichts, die sich mit der Sperranlage befassen. Der Vergleich der Sperranlage mit der innerdeutschen Mauer erfolgt im Kapitel H. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit in der Zusammenfassung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Nahostkonflikt, Sperranlage, Israel, Westjordanland, humanitäres Völkerrecht, Haager Landkriegsordnung, IV. Genfer Abkommen, Menschenrechte, Selbstbestimmung, palästinensisches Volk, Internationaler Gerichtshof, israelisches Verfassungsgericht, innerdeutsche Mauer.
- Citar trabajo
- Kai Michael Beckers (Autor), 2017, Völkerrechtliche Vereinbarkeit der Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506976