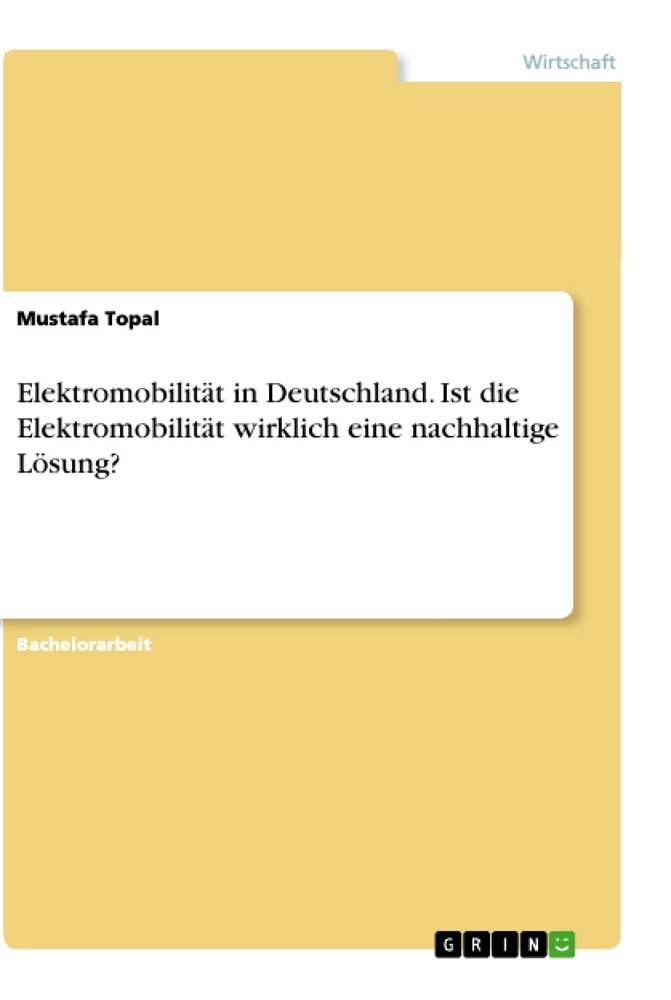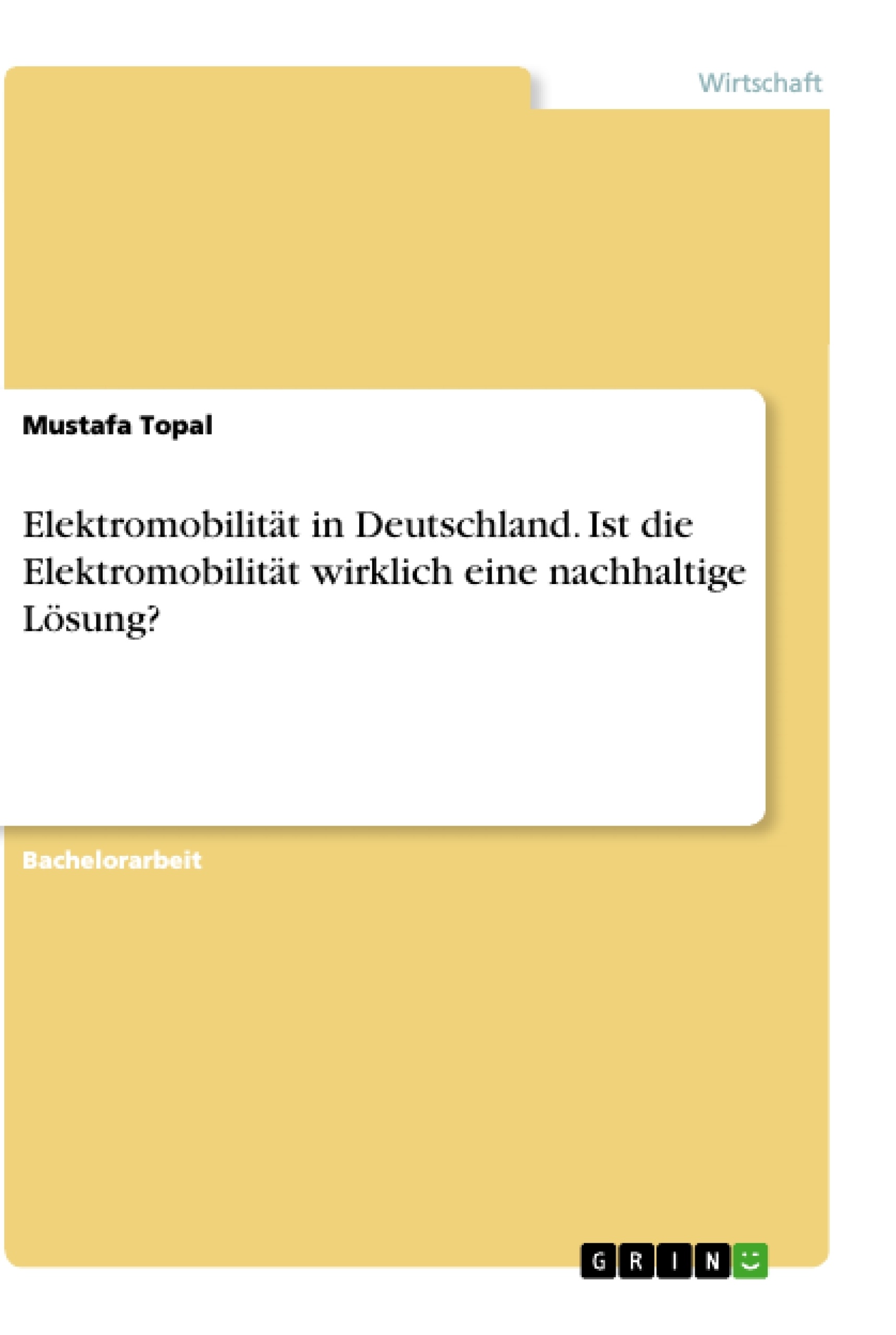Kernpunkt der Arbeit ist die Ausgangsfrage zu dem zu analysierenden Thema: Der Nachhaltigkeitsaspekt als Ganzes vom Rohstoffabbau bis hin zu Recycling beziehungsweise Entsorgung und die Wirtschaftlichkeit des E-Mobil gegenüber dem konventionellen Verbrennungsmotor.
Trotz der beendeten Ölkrise steht das System der Mobilität vor einem großen Wandel, zum einen bedingt durch das rasant angestiegene Verkehrsaufkommen in den Städten und zum anderen durch die Debatten um die Umweltverschmutzung. Das Resultat ist eine gestiegene Ineffizienz und die damit verbundene Problematik. Es braucht eine Veränderung! Der Automobilbranche steht die größte Veränderung ihrer Historie bevor. Der Elektroantrieb soll den Verbrennungsmotor ersetzen. In einer Epoche, in der die Ölpreise aufgrund der wachsenden Knappheit an diesem Rohstoff weiter steigen und die Vorschriften für Abgase immer strenger werden, führt kein Weg daran vorbei, dass die Autohersteller umdenken und eine Neuausrichtung in Angriff nehmen.
Ein Beitrag hierzu möchte die Bundesregierung leisten. Eines der Ziele der Bundesregierung ist es, bis 2022 eine Million zugelassene Elektrofahrzeuge zu erreichen, eine Veränderung in Form eines Megatrends, welcher alle Gesellschaftsbereiche beschäftigt, wie die Urbanisierung, Individualisierung, Globalisierung und Mobilität. Megatrends entfalten ihre volle Kraft erst im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Sie haben das Potenzial, den Alltag eines jeden Menschen zu beeinflussen und verfestigte Subsysteme zu verbessern.
Die E-Mobility ist vielseitig. Sie verspricht Unabhängigkeit vom Öl, CO2-Reduzierung sowie Wachstumsperspektiven in der Autobranche. Auf der anderen Seite besteht die Herausforderung, dass andere alternative Antriebe am Markt sind und Forschung und Entwicklung der Elektroautos voranschreiten, aber Defizite in deren Vermarktung vorzufinden sind. Auch müssen neue Minen und Abbaumethoden der benötigten Rohstoffe gefunden werden, damit es zu keinen Engpässen kommt. Allerdings ist selbst der Abbau dieser Rohstoffe umweltschädigend und geschieht unter menschenverachtenden Umständen. Weiter sagen Kritiker, dass die Batterieproduktion und der zu nutzende Strommix alles andere als "grün" sind. In diesem Sinne wird es das Ziel der Arbeit sein, eine passende Antwort auf die Frage "Ist E-Mobilität eine wirklich nachhaltige Lösung?" zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Geschichte des Automobils
- 1.2 Problemstellung
- 2. Die Welt der E-Mobilität
- 2.1 Marktanteil & Bedeutung der E-Mobilität in Deutschland
- 2.2 Aufbau & Funktionsweise eines Elektromobils
- 2.3 Aufladung & Infrastruktur
- 2.3.1 Ladevorgang & Dauer
- 2.3.2 Verwaltung & Abrechnung der Ladepunkte
- 2.4 Konkurrenz durch alternative Antriebe
- 3. Vergleich der Nachhaltig.- und Wirtschaftlichkeit der E-Autos mit Verbrenner über das Produktlebenszyklus hinaus
- 3.1 Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs
- 3.2 Abbau von Rohstoffen
- 3.3 Emissionen vor und während der Produktion
- 3.3.1 Kraftstoff- & Strombereitstellung
- 3.3.2 Herstellung eines PKW
- 3.4 Fahremissionen während der Nutzungsphase
- 3.4.1 Direkte Fahremissionen
- 3.4.2 Indirekte Emissionen
- 3.5 Reichweitenvergleich
- 3.6 Produktlebenszyklus
- 3.7 Recycling/Entsorgung
- 3.8 Wirtschaftlichkeit
- 4. Wichtige Stakeholder in Bezug auf Elektromobilität
- 4.1 Staatliche Förderung der Elektromobilität in Deutschland
- 4.2 Elektromobilität als Treiber des Arbeitsmarktes der Automobilindustrie
- 4.3 Strategische Handlungsempfehlungen
- 5. Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis befasst sich mit der Elektromobilität in Deutschland und untersucht die Frage, ob diese tatsächlich eine nachhaltige Lösung darstellt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der E-Mobilität, ihre technischen Eigenschaften und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekts von Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern über den gesamten Produktlebenszyklus.
- Analyse der Geschichte und des aktuellen Stands der E-Mobilität in Deutschland
- Vergleich der Nachhaltigkeitsaspekte von Elektroautos und Verbrennern
- Untersuchung der Wirtschaftlichkeit beider Antriebstechnologien
- Bewertung der Rolle staatlicher Fördermaßnahmen für die E-Mobilität
- Analyse der Bedeutung der E-Mobilität für den Arbeitsmarkt der Automobilindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Elektromobilität. Es beleuchtet die Geschichte des Automobils und die damit verbundene Problematik der Umweltverschmutzung. Die Problemstellung der Arbeit wird anhand der Frage nach der Nachhaltigkeit der E-Mobilität definiert.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird die Welt der E-Mobilität vorgestellt. Es werden der Marktanteil und die Bedeutung der E-Mobilität in Deutschland, der Aufbau und die Funktionsweise von Elektroautos sowie die Ladevorgänge und die dazugehörige Infrastruktur behandelt. Abschließend wird die Konkurrenz durch alternative Antriebe betrachtet.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel vergleicht die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Elektroautos und Verbrennern über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Dabei werden die Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs, der Abbau von Rohstoffen, Emissionen während der Produktion und Nutzung sowie der Reichweitenvergleich, die Recycling/Entsorgung und die Wirtschaftlichkeit der beiden Antriebstechnologien betrachtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel widmet sich den wichtigsten Stakeholdern in Bezug auf Elektromobilität. Es werden die staatliche Förderung der E-Mobilität in Deutschland, die Bedeutung der Elektromobilität für den Arbeitsmarkt der Automobilindustrie und mögliche strategische Handlungsempfehlungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Elektromobilität, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Produktlebenszyklus, Emissionen, Reichweite, staatliche Förderung, Automobilindustrie, Arbeitsmarkt, Stakeholder, alternative Antriebe, Verbrennungsmotor.
Häufig gestellte Fragen
Ist Elektromobilität wirklich nachhaltig?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und betrachtet dabei den gesamten Lebenszyklus, vom umweltschädlichen Rohstoffabbau bis hin zum Strommix und Recycling.
Welche Probleme gibt es beim Rohstoffabbau für E-Auto-Batterien?
Kritiker weisen auf menschenverachtende Umstände und starke Umweltschäden beim Abbau von Lithium und Kobalt in den Herkunftsländern hin.
Wie wirtschaftlich ist ein E-Auto im Vergleich zum Verbrenner?
Die Arbeit vergleicht Anschaffungskosten, staatliche Förderungen und Betriebskosten über den gesamten Produktlebenszyklus beider Antriebsarten.
Was ist das Ziel der Bundesregierung bezüglich E-Mobilität?
Ein Ziel war es, bis zum Jahr 2022 eine Million zugelassene Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zu erreichen.
Welche Rolle spielt der Strommix für die Umweltbilanz?
Ein Elektroauto ist nur dann wirklich "grün", wenn der genutzte Ladestrom aus erneuerbaren Energien stammt und nicht aus fossilen Quellen.
- Citar trabajo
- Mustafa Topal (Autor), 2019, Elektromobilität in Deutschland. Ist die Elektromobilität wirklich eine nachhaltige Lösung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507044