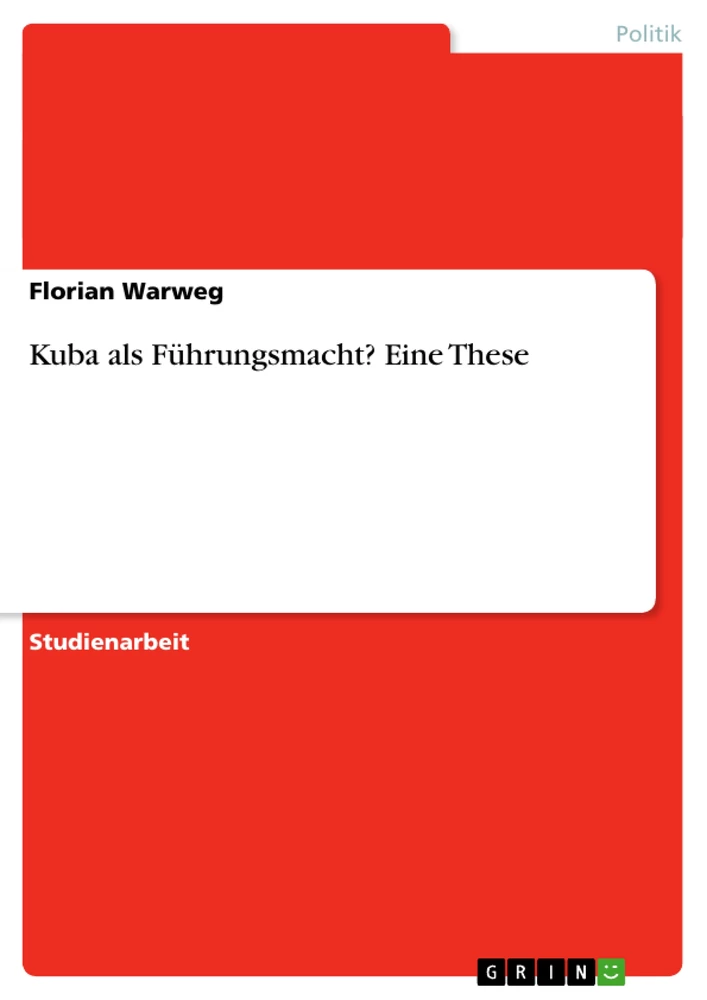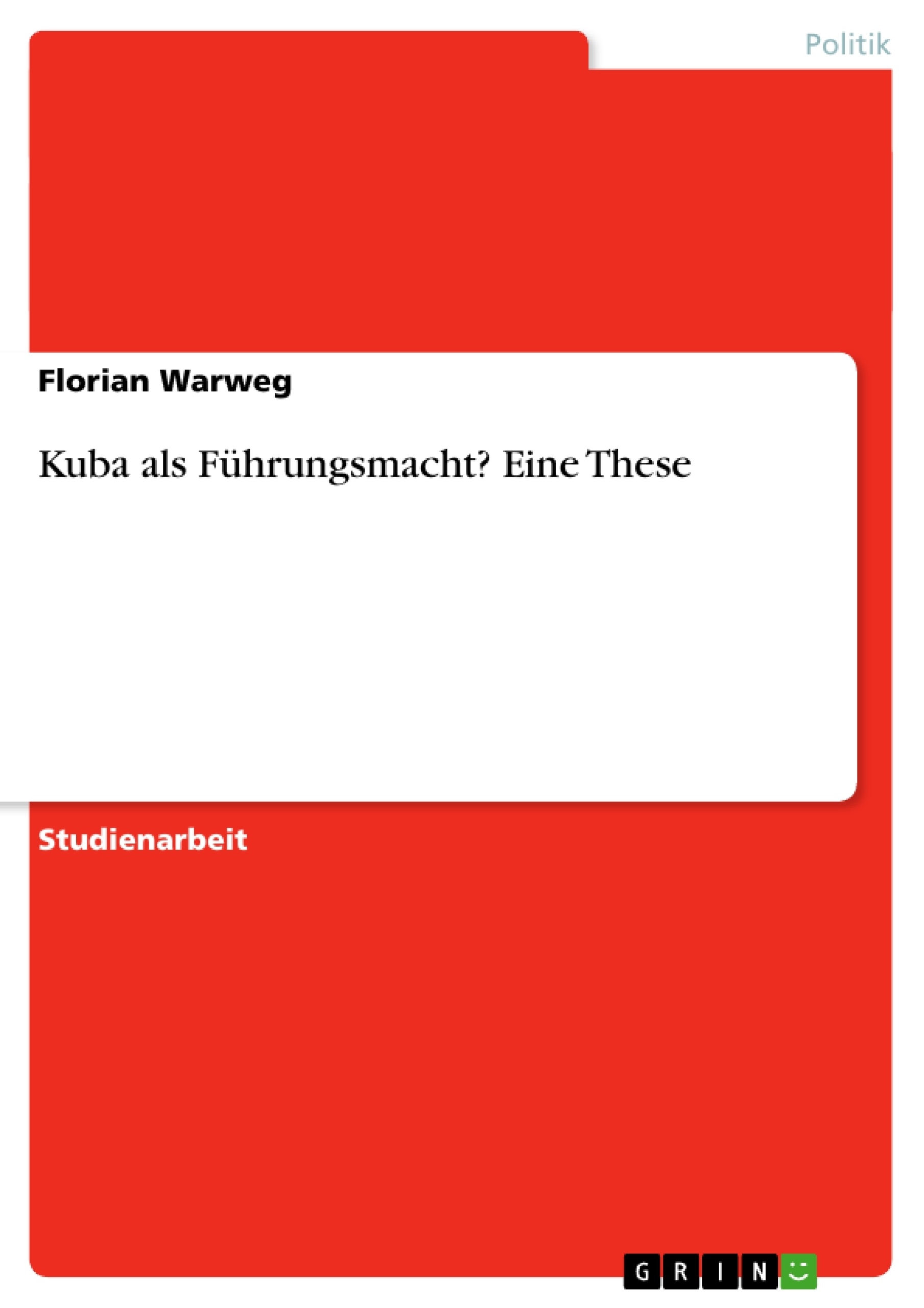Auseinandersetzung mit der Fragestellung, ob man Kuba als Führungsmacht in den Internationalen Beziehungen bezeichnen kann. Die Analyse fokussiert sich auf den Zeitraum von 1959 bis 1990. Aufbauend auf einer Operationalisierung des Terminus Führungsmacht wird die Entwicklung Kubas als regionale wie globale Führungsmacht, anhand von Machtressourcen im Bereich der Hart- und Softpower nachgezeichnet.
Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass Kuba zumindest in den untersuchten Bereichen der Hart- und Softpower über Führungsmachtstatus verfügte. Ausgehend von der Initialphase des kubanischen Strebens nach Führungsmacht in den Jahren 1959 bis 1967, über die dann folgende Verbreiterung des Wirkens als Führungsmacht bis zur endgültigen Etablierung Kubas als globale Führungsmacht ab dem Jahre 1975, wurde die Entwicklung Kubas zur Führungsmacht aufgezeigt sowie die Benennung als solche begründet und belegt, inklusive der Beweisführung, dass Kuba als autonomer Akteur in den internationalen Beziehungen zu bewerten ist. Während man in der Anfangsphase lediglich im Bereich der Ausbreitung des kubanischen Revolutionskonzeptes sowie eingeschränkt im Hartpowerbereich von einem Führungsmachtstatus sprechen konnte, steigerte sich das kubanische Führungsmachtpotenzial von 1968 bis 1975 und er erstreckte sich bereits auf Hartpower wie ein Großteil der Softpowerelemente und rechtfertigt die Benennung Kubas als Führungsmacht innerhalb der Entwicklungsländer. Von 1975 bis 1990 dienten mehr als 300.000 kubanische Soldaten und Militärberater in drei Kontinenten, sowie abhängig vom jeweiligen Jahr zwischen 11 000 bis 23 000 kubanische Entwicklungshelfer in 45 Ländern. Mittels der militärischen wie zivilen Präsenz wurde Einfluss genommen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, auf die politische wie auch sozioökonomische Entwicklung von 45 Ländern. Man kann folglich sowohl in quantitativen wie auch qualitativen Maßstäben Kuba in dieser Epoche im Hart- wie auch Softpowerbereich als eine Führungsmacht bezeichnen, denn, wie schon der Harvard Professors Jorge I. Domínguez, in seiner Einführung zu seinem 1989 verfassten Standardwerk über die kubanische Außenpolitik schrieb, „Cuba is a small country, but it has [had] the foreign policy of a big power“ (Dominguez 1989: 7).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Initial-Periode der kubanischen Führungsmacht: 1959-1967
- 1.1. Der Weg zur staatlichen Souveränität
- 1.2. Hartpower
- 1.2.1 In Lateinamerika
- 1.2.2. Im internationalen Umfeld
- 1.3. Softpower
- 1.3.1. Entwicklungshilfe
- 1.3.2. Revolutionskonzepte
- 1.3.3 Einfluss und Macht in internationalen Organisationen
- 2. Die aufsteigende Führungsmacht: 1968-1974
- 2.1. Hartpower
- 2.2. Softpower
- 2.2.1. Entwicklungshilfe
- 2.2.2. Einfluss und Macht in internationalen Organisationen
- 3. Kuba auf dem Höhepunkt seiner Führungsmacht: 1975-90
- 3.1. Hartpower
- 3.1.1. Zeitraum 1975-1987
- 3.1.2. Zeitraum 1987-1991
- 3.2. Softpower 1975-1987
- 3.2.1. Entwicklungshilfe
- 3.2.2. Einfluss und Macht in internationalen Organisationen
- 3.3. Softpower 1987-1990
- 3.1. Hartpower
- 4. Ende der Führungsmacht: 1990 bis heute
- 5. Kuba als Befehlsempfänger Moskaus?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass Kuba im internationalen und regionalen Umfeld als Führungsmacht betrachtet werden kann. Die Analyse konzentriert sich auf die Zeit von 1959 bis 1991 und analysiert die Ausübung von Führungsmacht durch Kuba mithilfe einer selbstentwickelten Definition.
- Kuba als souveräner Akteur und seine Fähigkeit zur Führungsmacht
- Die Rolle von Hartpower (militärische Macht) und Softpower (politische und sozioökonomische Einflussnahme) in der kubanischen Außenpolitik
- Die Entwicklung von Kubas Führungsmacht über verschiedene Zeitabschnitte
- Die Auswirkungen von Kubas Führungsmacht auf andere Staaten und Institutionen
- Die Analyse der kubanischen Außenpolitik anhand von Fallbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These von Kuba als Führungsmacht vor und erläutert die Methodik und den Fokus der Arbeit. Das erste Kapitel analysiert die Initial-Periode der kubanischen Führungsmacht von 1959-1967, fokussiert sich auf den Weg zur staatlichen Souveränität, die Anwendung von Hartpower, sowie die Ausübung von Softpower durch Kuba. Das zweite Kapitel befasst sich mit der aufsteigenden Führungsmacht von 1968-1974 und betrachtet die Anwendung von Hartpower und Softpower in dieser Periode. Kapitel 3 untersucht Kuba auf dem Höhepunkt seiner Führungsmacht von 1975-1990 und analysiert die Anwendung von Hartpower und Softpower während dieser Zeit. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Ende der Führungsmacht Kubas ab 1990 bis heute.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Führungsmacht, Kuba, Außenpolitik, Hartpower, Softpower, Entwicklungshilfe, Internationale Organisationen, Lateinamerika, Dritte Welt, Revolution, Kuba-Krise, Kalter Krieg, sowie die Analyse der kubanischen Außenpolitik in den verschiedenen Zeitabschnitten.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Kuba als Führungsmacht bezeichnen?
Ja, die Analyse zeigt, dass Kuba zwischen 1959 und 1990 aufgrund seiner massiven militärischen und zivilen Präsenz in über 45 Ländern den Status einer globalen Führungsmacht unter den Entwicklungsländern hatte.
Was versteht man unter kubanischer "Hartpower"?
Damit ist der Einsatz von über 300.000 Soldaten und Militärberatern auf drei Kontinenten (z.B. in Angola und Äthiopien) zur Unterstützung revolutionärer Bewegungen gemeint.
Was ist kubanische "Softpower"?
Kuba entsandte zehntausende Entwicklungshelfer, Ärzte und Lehrer in 45 Länder und übte großen Einfluss in internationalen Organisationen der Blockfreien Staaten aus.
War Kuba nur ein Befehlsempfänger der Sowjetunion?
Die Arbeit belegt, dass Kuba oft als autonomer Akteur handelte und eigene außenpolitische Ziele verfolgte, die teilweise sogar im Widerspruch zu Moskaus Interessen standen.
Wann endete Kubas Status als Führungsmacht?
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks um 1990 verlor Kuba seine wirtschaftliche Basis und damit auch die Ressourcen für seine weitreichende globale Außenpolitik.
- Quote paper
- Florian Warweg (Author), 2003, Kuba als Führungsmacht? Eine These, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50732