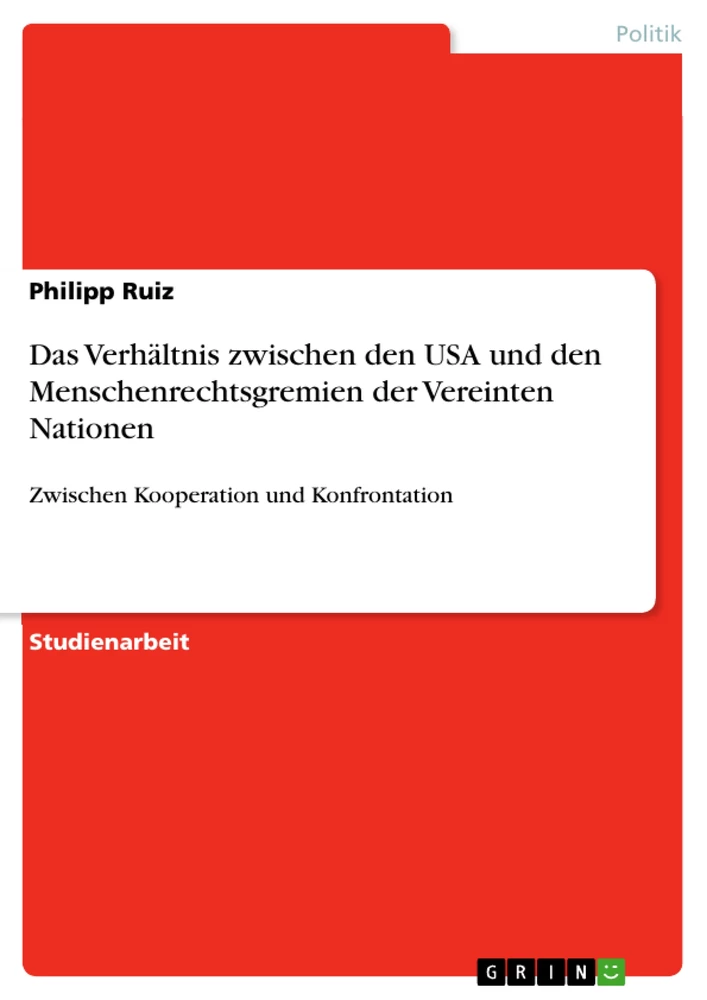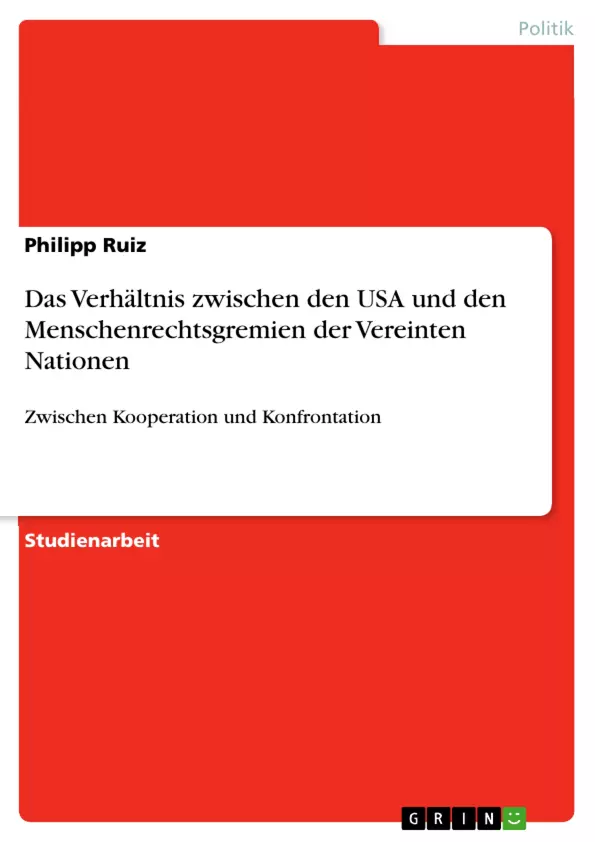Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den UN-Menschenrechtsgremien. Sie soll zu einem besseren Verständnis dieses Verhältnisses beitragen. Im Juni 2018 verkündete US-Präsident Donald Trump, dass sein Land den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verlassen wird. Das Gremium sei eine „heuchlerische und eigennützige Organisation“ (Spiegel Online 2018), sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley. Nachdem die USA bereits aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Atom-Abkommen mit dem Iran ausgestiegen waren, bedeutet der Rückzug aus dem Menschenrechtsrat einen weiteren Bruch mit der multilateralen Weltordnung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut hatten.
Dieser Rückzug kam aus der Sicht vieler Beobachter nicht überraschend: Schon lange hatten die Vereinigten Staaten mit dem Menschenrechtsrat bzw. dessen Vorgänger, der UN-Menschenrechtskommission, gehadert und schon öfter einen Ausstieg in Erwägung gezogen. Das Verhältnis zwischen den USA und den UN-Gremien für Menschenrechte kann daher durchaus als seit vielen Jahren schwierig bezeichnet werden.
Um Gräuel wie den Zweiten Weltkrieg und den Genozid an den europäischen Juden künftig zu verhindern, betrachteten die Autoren der Charta der Vereinten Nationen drei Themen als interdependente Kernaufgaben: Frieden, Entwicklung und Menschenrechte. Zur Förderung und zum Schutz Letzterer wurde 1946 die Menschenrechtskommission als Unterorgan des Wirtschafts- und Sozialrats der UN (ECOSOC) gegründet. Sie und ihr Nachfolgegremium, der Menschenrechtsrat, waren bzw. sind eine wichtige Säule im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen. Die Menschenrechtskommission bestand anfangs aus 18 Mitgliedstaaten, darunter alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Die Mitglieder der Kommission wurden vom ECOSOC für drei Jahre gewählt wurden und konnten sich einer unmittelbaren Wiederwahl stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsdesign
- Prinzipal-Agent-Theorie
- Probleme der Delegation
- Gründe für Delegation
- Autorität und Autonomie
- Die Menschenrechtskommission und der Menschenrechtsrat der UN
- Entstehung der Menschenrechtskommission
- Aufgaben und Funktionsweise der Menschenrechtskommission
- Von der Menschenrechtskommission zum Menschenrechtsrat
- Aufgaben und Funktionsweise des Menschenrechtsrats
- Delegation und Autonomie im Verhältnis zwischen den USA und den UN-Menschenrechtsgremien
- Gründe für und Probleme durch Delegation
- Autorität und Autonomie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen. Sie befasst sich mit der Delegation von Aufgaben und Macht an diese Gremien sowie mit den Herausforderungen, die sich aus dieser Beziehung ergeben. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Komplexität und Dynamik dieses Verhältnisses zu entwickeln.
- Die Prinzipal-Agent-Theorie als Analysewerkzeug für das Verhältnis zwischen Staaten und internationalen Organisationen
- Die Entstehung, Aufgaben und Funktionsweise der UN-Menschenrechtsgremien
- Die Gründe für die Delegation von Aufgaben und Macht an die UN-Menschenrechtsgremien aus Sicht der USA
- Die Herausforderungen, die sich aus der Delegation an die UN-Menschenrechtsgremien ergeben
- Die Frage nach Autorität und Autonomie der UN-Menschenrechtsgremien im Verhältnis zu den USA
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Rückzug der USA aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in den Kontext und verdeutlicht die Bedeutung des Themas. Sie führt den Prinzipal-Agent-Ansatz ein, der als theoretisches Fundament für die Analyse dient.
- Das zweite Kapitel erläutert die Prinzipal-Agent-Theorie als Analysewerkzeug für die Beziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen. Es werden die wichtigsten Elemente der Theorie, wie Delegation, Autorität und Autonomie, definiert.
- Das dritte Kapitel beschreibt die Entstehung, Aufgaben und Funktionsweise der UN-Menschenrechtsgremien. Es beleuchtet die Entwicklung von der Menschenrechtskommission zum Menschenrechtsrat.
- Das vierte Kapitel, der Kern der Arbeit, untersucht die Delegation von Aufgaben und Macht an die UN-Menschenrechtsgremien aus Sicht der USA. Es analysiert die Gründe für die Delegation und die Probleme, die sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Politik und des internationalen Rechts, darunter die Prinzipal-Agent-Theorie, die UN-Menschenrechtsgremien, die Delegation von Aufgaben und Macht, sowie die Frage nach Autorität und Autonomie internationaler Organisationen. Insbesondere die Beziehung zwischen den USA und den UN-Menschenrechtsgremien, die von Kooperation und Konfrontation geprägt ist, steht im Mittelpunkt der Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum verließen die USA 2018 den UN-Menschenrechtsrat?
Die Trump-Regierung bezeichnete den Rat als „heuchlerisch und eigennützig“. Der Rückzug war Teil eines Bruchs mit der multilateralen Weltordnung.
Was ist die Prinzipal-Agent-Theorie im Kontext der UN?
Diese Theorie dient als Analysewerkzeug, um das Verhältnis zwischen Staaten (Prinzipale) und internationalen Organisationen (Agenten) sowie die damit verbundene Delegation von Macht zu verstehen.
Wie unterscheiden sich die UN-Menschenrechtskommission und der Menschenrechtsrat?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von der 1946 gegründeten Kommission zum 2006 geschaffenen Rat und analysiert deren jeweilige Aufgaben und Funktionsweisen.
Welche Probleme entstehen durch die Delegation von Macht an UN-Gremien?
Es entstehen Spannungen zwischen der Autonomie des Gremiums und den Interessen des delegierenden Staates, was oft zu Konflikten über Autorität und politische Zielsetzungen führt.
Sind die USA dauerhaft gegen UN-Menschenrechtsgremien eingestellt?
Das Verhältnis ist historisch komplex und schwankt zwischen Kooperation (Mitbegründung nach dem Zweiten Weltkrieg) und Konfrontation (Rückzug unter Trump).
- Quote paper
- Philipp Ruiz (Author), 2018, Das Verhältnis zwischen den USA und den Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507372