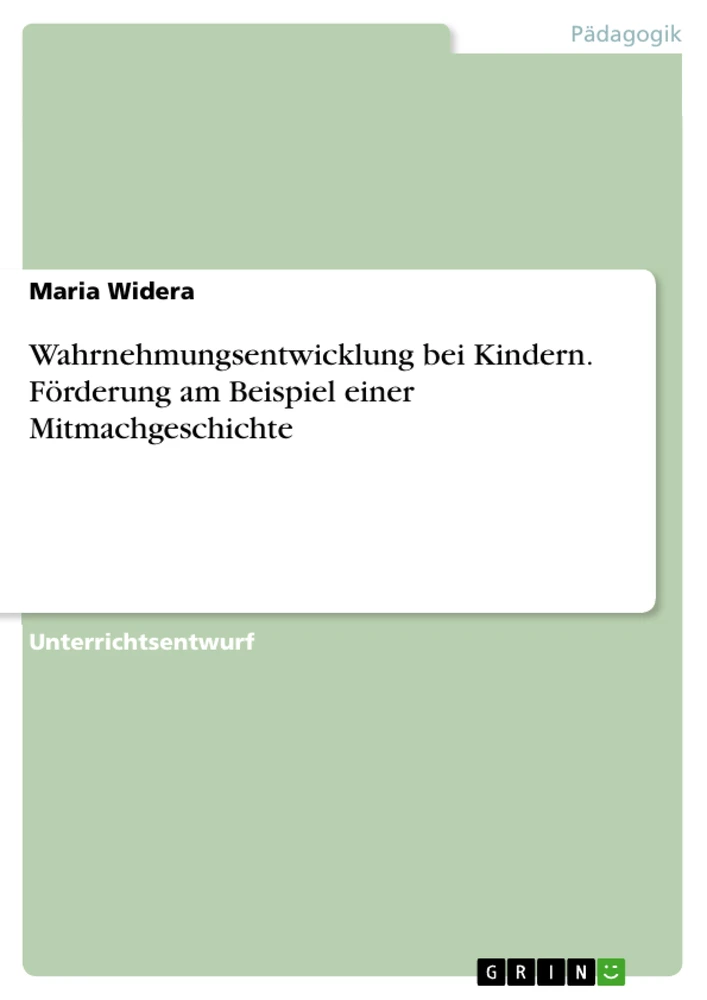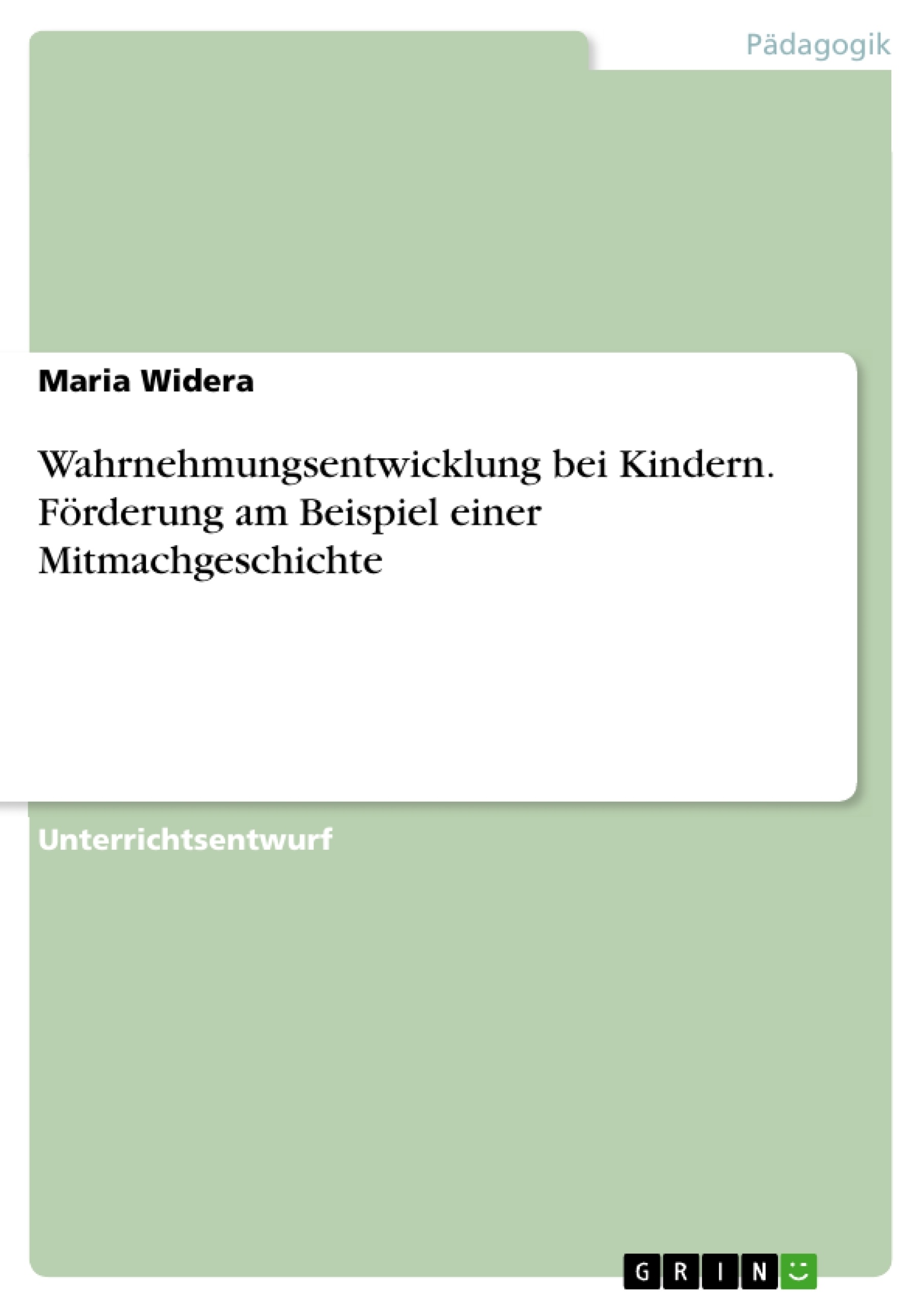Die geplante Unterrichtseinheit umfasst eine aktivierende Wiederholung der Sinnesorgane und deren Funktion sowie eine praktische Übung mit Beobachtungsauftrag. Diese soll es ermöglichen den Begriff der sensorischen Integration einzuführen und dadurch die Bedeutung für die Praxis abzuleiten.
Anschließend bearbeiten die Lernenden in Partnerarbeit die Aufgabenstellung, unterteilt in verschiedene Schwierigkeitsgrade, eine eigene Mitmachgeschichte zu erstellen und abschließend exemplarische Arbeitsergebnisse zu präsentieren und die Unterrichtseinheit zu reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Lernausgangslage
- Lernziele
- Didaktische Begründung
- Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, die Sinnesorgane und ihre Funktion im Kontext der Wahrnehmungsentwicklung von Kindern zu wiederholen und zu vertiefen. Sie soll den Begriff der sensorischen Integration einführen und seine Bedeutung für die Praxis in der Sozialpädagogik verdeutlichen.
- Wiederholung und Vertiefung der Sinnesorgane und deren Funktion
- Einführung des Begriffs der sensorischen Integration
- Bedeutung der sensorischen Integration für die Praxis in der Sozialpädagogik
- Praktische Übung mit Beobachtungsauftrag
- Entwicklung einer eigenen Mitmachgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Lernausgangslage: Die Unterrichtseinheit wird in der Klasse SAR 16a im 2. Ausbildungsjahr durchgeführt. Die Schüler haben bereits Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Sozialpädagogik gesammelt und befinden sich aktuell im Kinder- und Jugendhilfepraktikum. Der Fokus liegt auf der Wiederholung und Vertiefung der Sinnesorgane und der sensorischen Integration.
- Lernziele: Die Schüler sollen die Sinnesorgane und deren Funktion benennen können. Sie sollen den Begriff der sensorischen Integration verstehen und seine Bedeutung für die Praxis in der Sozialpädagogik einordnen können. Sie sollen in der Lage sein, eine eigene Mitmachgeschichte zu entwickeln, die die sensorische Integration thematisiert.
- Didaktische Begründung: Die Einheit ist so aufgebaut, dass die Schüler aktiv am Lernprozess beteiligt sind. Die Wiederholung der Sinnesorgane erfolgt durch eine aktivierende Übung, die praktische Anwendung findet in der Erstellung einer Mitmachgeschichte. Die Einheit knüpft an die Erfahrungen der Schüler aus dem Kinder- und Jugendhilfepraktikum an.
- Verlaufsplanung: Die Einheit ist in verschiedene Phasen unterteilt: Wiederholung der Sinnesorgane, Einführung der sensorischen Integration, praktische Übung, Partnerarbeit, Präsentation der Ergebnisse, Reflexion.
Schlüsselwörter
Sinnesorgane, Wahrnehmung, sensorische Integration, Mitmachgeschichte, Beobachtung, Kindertagesstätte, Sozialpädagogik, Förderung der Wahrnehmungsentwicklung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter sensorischer Integration bei Kindern?
Sensorische Integration ist der Prozess, bei dem das Gehirn Reize der verschiedenen Sinnesorgane aufnimmt, verarbeitet und zu einer sinnvollen Reaktion verknüpft.
Wie fördern Mitmachgeschichten die kindliche Wahrnehmung?
Mitmachgeschichten regen Kinder dazu ab, aktiv zuzuhören und die Inhalte durch Bewegungen oder Sinneserfahrungen umzusetzen, was die Verknüpfung von Reizen fördert.
Welche Rolle spielen die Sinnesorgane in der Sozialpädagogik?
Die Sinnesorgane sind die Basis für jede Interaktion mit der Umwelt. In der Sozialpädagogik ist die Förderung der Wahrnehmung essenziell für die kognitive und motorische Entwicklung.
Was ist das Ziel einer Unterrichtseinheit zur Wahrnehmungsentwicklung?
Lernende sollen die Funktionen der Sinnesorgane vertiefen, den Begriff der sensorischen Integration verstehen und praktische Methoden zur Förderung von Kindern erlernen.
Wie können Schüler eigene Förderangebote für Kitas entwickeln?
Durch die Erstellung eigener Mitmachgeschichten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden lernen Schüler, pädagogische Angebote gezielt auf den Entwicklungsstand von Kindern auszurichten.
- Citation du texte
- Maria Widera (Auteur), 2017, Wahrnehmungsentwicklung bei Kindern. Förderung am Beispiel einer Mitmachgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507407