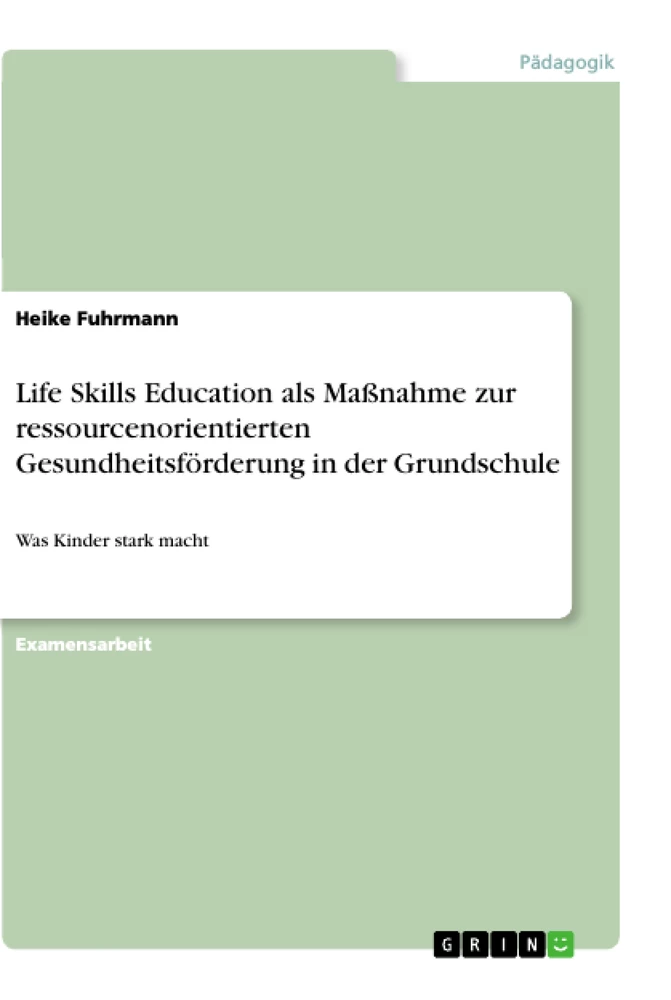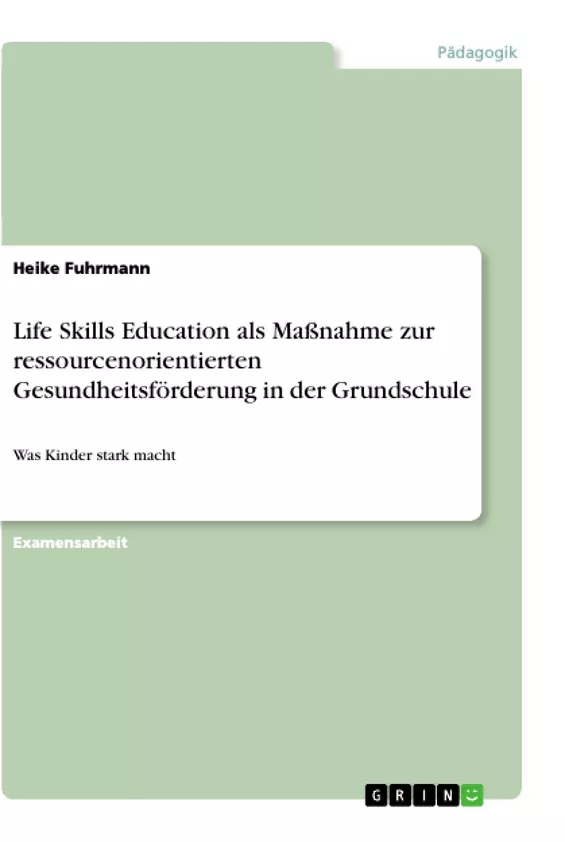Die vorliegende Arbeit möchte einen tiefergehenden Einblick in die ressourcenorientierte Betrachtungsweise bieten, indem zu Beginn grundlegende ressourcenbasierte Theorien und Ansätze samt dazugehöriger Studienergebnisse dargestellt und in Bezug auf ihren Erkenntniswert für die pädagogische Praxis hinterfragt werden. Wegweisend sind hierbei das Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky und die Resilienzforschung, sowie die Konsistenztheorie von Klaus Grawe, die Grundeinstellung der Positiven Psychologie und der Empowerment-Ansatz.
Im zweiten Teil wird zunächst analysiert, hinsichtlich welcher Aspekte sich Präventionsprogramme grundsätzlich unterscheiden und welche Kriterien sich Studien zufolge als wirksam erwiesen haben. Auf Basis dessen werden konzeptuelle und inhaltliche Anforderungskriterien an ressourcenstärkende Präventionsprogramme abgeleitet. Anschließend werden bereits existierende Präventionsprogramme für die Grundschule in Form von Steckbriefen vorgestellt und hinsichtlich dieser Kriterien kritisch miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Theorien der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung
- Das Konzept der Salutogenese
- Entstehung der salutogenetischen Fragestellung
- Von der Pathogenese zur Salutogenese Das Verständnis Antonovskys als Abgrenzung und Erweiterung zur Pathogenese
- Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- Generalisierte Widerstandsressourcen
- Stressorenverständnis
- Das Kohärenzgefühl
- Resilienz
- Begriffliche Annäherung und Definition
- Risikofaktorenkonzept versus Schutzfaktorenkonzept
- Empirische Studien der Resilienzforschung
- Konsistenztheorie
- Positive Psychologie
- Empowerment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung in der Grundschule. Der Fokus liegt dabei auf dem Konzept der "Life Skills Education" und deren Potenzial, Kinder zu stärken und ihre Widerstandsfähigkeit zu fördern.
- Das Konzept der Salutogenese und die Bedeutung des Kohärenzgefühls
- Die Rolle von Resilienz und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
- Die Bedeutung von Empowerment und Ressourcenstärkung in der Gesundheitsförderung
- Die Analyse von verschiedenen Präventionsprogrammen im Kontext der "Life Skills Education"
- Die Rolle von Lehrergesundheit und deren Einfluss auf die Schulgemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung und skizziert den theoretischen Rahmen der Arbeit.
- Das Konzept der Salutogenese: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Salutogenese-Konzepts und erläutert die Bedeutung des Kohärenzgefühls als zentralen Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden.
- Resilienz: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Resilienz und erläutert die Bedeutung von Schutzfaktoren und Ressourcen für die psychische Widerstandsfähigkeit.
- Konsistenztheorie: Dieses Kapitel stellt die Konsistenztheorie vor und beleuchtet deren Relevanz für die Gesundheitsförderung.
- Positive Psychologie: Dieses Kapitel behandelt die Konzepte und Ansätze der positiven Psychologie und deren Bedeutung für die Förderung von Glück und Wohlbefinden.
- Empowerment: Dieses Kapitel erläutert das Konzept des Empowerment und dessen Bedeutung für die Ressourcenstärkung und Selbstwirksamkeit.
- Ressourcenorientierte Präventionsprogramme: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über verschiedene Präventionsprogramme im Kontext der "Life Skills Education" und deren Wirksamkeit.
- Das „Stark!“-Programm: Dieses Kapitel stellt das Präventionsprogramm "Stark!" vor und beschreibt dessen Ziele, Konzeption und Aufbau.
- Lehrergesundheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Lehrergesundheit und beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Ressourcenstärkung von Lehrkräften.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen "Life Skills Education", Salutogenese, Resilienz, Empowerment, Gesundheitsförderung, Prävention, Lehrergesundheit und Schulentwicklung. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte wie Kohärenzgefühl, Schutzfaktoren, Ressourcenstärkung und Präventionsmaßnahmen im Kontext der Grundschule beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der "Life Skills Education" in der Grundschule?
Ziel ist die ressourcenorientierte Gesundheitsförderung, um die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Kindern durch die Vermittlung von Lebenskompetenzen zu stärken.
Was bedeutet "Salutogenese" nach Aaron Antonovsky?
Salutogenese ist das Konzept der Entstehung von Gesundheit. Im Zentrum steht das Kohärenzgefühl, das ausdrückt, wie sehr ein Mensch das Leben als verstehbar, handhabbar und bedeutsam empfindet.
Welche Rolle spielt die Resilienzforschung in diesem Kontext?
Die Resilienzforschung untersucht Schutzfaktoren, die Kindern helfen, trotz schwieriger Lebensbedingungen oder Risikofaktoren psychisch gesund zu bleiben.
Was ist der Empowerment-Ansatz?
Empowerment zielt darauf ab, die Selbstwirksamkeit von Menschen zu erhöhen, damit sie ihre Ressourcen entdecken und autonom für ihre Gesundheit eintreten können.
Welche Bedeutung hat die Lehrergesundheit für die Schule?
Lehrergesundheit ist ein wesentlicher Faktor für das Schulklima und die Qualität der pädagogischen Arbeit; nur gesunde Lehrkräfte können Ressourcenorientierung authentisch vorleben.
Was zeichnet wirksame Präventionsprogramme aus?
Wirksame Programme sind ressourcenstärkend, inhaltlich fundiert und lassen sich nachhaltig in den Schulalltag integrieren, wie z.B. das Programm "Stark!".
- Quote paper
- Heike Fuhrmann (Author), 2019, Life Skills Education als Maßnahme zur ressourcenorientierten Gesundheitsförderung in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507531