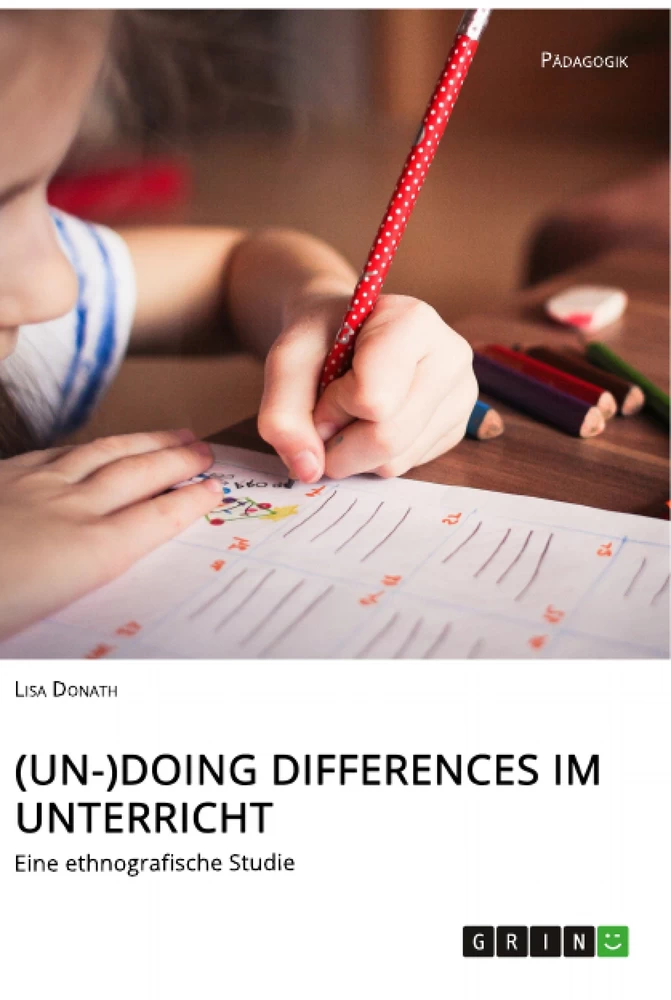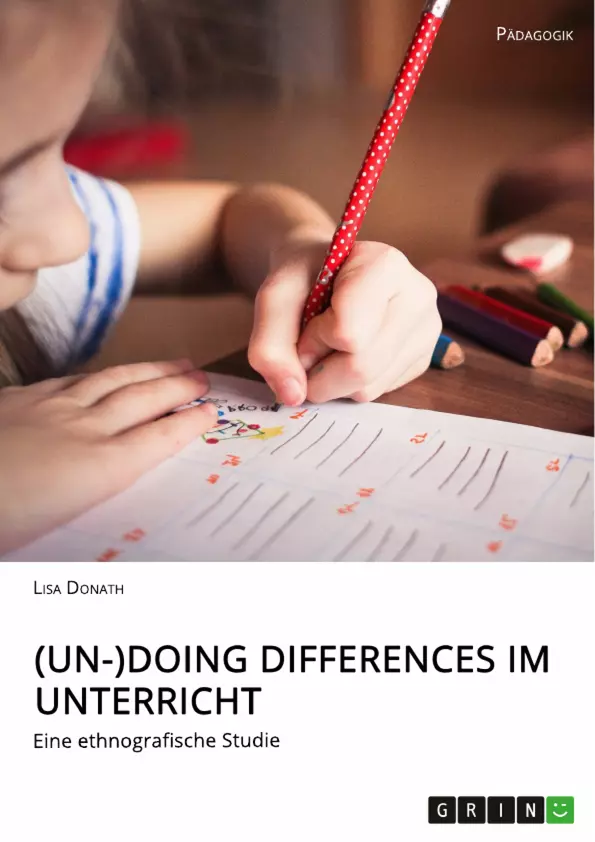Diese ethnografische Studie befasst sich mit den Humandifferenzierungen im Feld unterrichtlicher Situationen, die im Rahmen des Regelunterrichts einer vierten Grundschulklasse beobachtbar sind. Hierbei liegt der Fokus auf der Darstellung ausgewählter Fallbeispiele und der kleinschrittigen Analyse dieser Kategorisierungsprozesse entsprechend des Humandifferenzierungsansatzes nach Hirschauer (2017). Angelehnt an den aktuellen Forschungsstand sollen Differenzierungsverfahren so greifbar und als Reflexionsgrundlage des Lehrerhandelns handhabbar gemacht werden.
"Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an", sagte einst Theodor Fontane (1819 – 1898), deutscher Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker und griff schon damals die Relevanz von Gemeinschaft und Zugehörigkeit auf. Auch Pierre Bourdieu spricht zu Beginn seines Werkes Meditationen - Zur Kritik der scholastischen Vernunft beiläufig von den "unterschiedlichen Mitgliedschaften, Zugehörigkeiten, Involviertheiten", durch die wir "in die Welt verwickelt" seien (Bourdieu 2001). Doch so nebenbei lässt sich dieses Bedürfnis nach Mitgliedschaft und Zugehörigkeit nicht abtun. Unser soziales Miteinander bezieht sich stets auf die Zugehörigkeiten der Individuen zu Gruppierungen und Subgruppierungen der Gesellschaft. Verschiedene Arten von Verbindungen, die "Ways of Belonging" (Souza 1990), bilden den Grundstein der Sozialität. Für den Einzelnen bleibt dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht folgenlos: "Das bei seiner Geburt organisch und administrativ singularisierte Menschenmaterial wird erst durch seine multiplen Zugehörigkeiten sozialisiert und individualisiert" (Hirschauer 2017).
Jedoch sehnen sich die Gesellschaftsmitglieder nicht nur nach Zugehörigkeit. Sie zeichnen sich zudem durch einen hohen Ordnungsbedarf aus, um sich rückwirkend selbst im System verorten zu können. Das Konzept der Humandifferenzierung greift diese Mechanismen auf und versucht ihre Prozesse offenzulegen und aufzuzeigen, wie unterschiedliche Situationen verschiedene Differenzierungsrelevanzen zum Vorschein bringen. Im Rahmen schulischer Interaktionsgeschehen können Differenzierungen beispielsweise durch institutionell gegebene Strukturen, durch Materialien und Themen, durch Handlungen von Lehrkräften (LK) oder aber auch durch Reaktionen der Schülerinnen und Schüler (SuS) produziert, verstärkt oder minimiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Humandifferenzierung
- 3 Aktueller Forschungsstand
- 4 Ethnografieforschung
- 4.1 Selbstverständnis und Prinzipien
- 4.1.1 Gegenstandsbereich
- 4.1.2 Feldforschung
- 4.1.3 Methodenopportunismus
- 4.1.4 Verschriftlichungsprozess
- 4.2 Methodik und Forschungsprozess
- 4.2.1 Grounded Theory - Exkurs zur Datenanalyse
- 4.3 Umsetzung in der vorliegenden Studie
- 4.1 Selbstverständnis und Prinzipien
- 5 Humandifferenzierung im Unterrichtsgeschehen
- 5.1 Das Feld und seine Rahmenbedingungen
- 5.2 Differenzierungen aufgrund vermeintlicher Sprachbarrieren
- 5.3 Das Loben und Tadeln - Differenzierungen aufgrund von Störungen und Leistung
- 5.4 Der Fall Hüseyin – Wie erhält ein Kind einen Sonderstatus?
- 6 Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese ethnografische Studie untersucht Humandifferenzierungsprozesse im Kontext einer vierten Grundschulklasse. Ziel ist es, ausgewählte Fallbeispiele darzustellen und die Kategorisierungsprozesse anhand des Humandifferenzierungsansatzes nach Hirschauer (2017) zu analysieren. Die Ergebnisse sollen Differenzierungsverfahren greifbarer machen und als Reflexionsgrundlage für Lehrerhandeln dienen.
- Analyse von Humandifferenzierung im schulischen Alltag
- Untersuchung der Auswirkungen von Differenzierungsprozessen auf Schüler
- Anwendung des Humandifferenzierungsansatzes nach Hirschauer
- Reflexion von Lehrerhandeln im Hinblick auf Differenzierung
- Darstellung konkreter Fallbeispiele aus dem Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einführung beleuchtet die Relevanz von Zugehörigkeit und Ordnungsbedürfnis in sozialen Zusammenhängen und führt in das Konzept der Humandifferenzierung ein. Sie beschreibt den Fokus der Studie auf Humandifferenzierungen im Regelunterricht einer vierten Grundschulklasse und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Ansatz von Hirschauer (2017) wird als theoretische Grundlage vorgestellt, mit dem Ziel, Differenzierungsverfahren als Reflexionsgrundlage des Lehrerhandelns zu analysieren.
2 Humandifferenzierung: Dieses Kapitel erklärt den Ansatz der Humandifferenzierung nach Hirschauer, der Menschen nach verschiedenen Aspekten unterscheidet und in Kategorien sortiert. Es beschreibt die Funktionen dieser kategorialen Ordnung: Ordnungsleistung und Selbstverortung. Die Arbeit verdeutlicht, wie alltagsweltliche Unterscheidungskategorien (Ethnizität, Geschlecht, Leistung) funktionieren und wie sie im schulischen Kontext (laut/leise, sportlich/unsportlich) zum Tragen kommen. Die Vielseitigkeit der Funktionen von Humandifferenzierungen (Abwertung, Idealisierung, Vergleich) und der Unterschied zum soziologischen Ansatz werden ebenfalls erläutert.
4 Ethnografieforschung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie. Es erläutert das Selbstverständnis und die Prinzipien ethnografischer Forschung, einschließlich Feldforschung, Methodenopportunismus und Verschriftlichungsprozess. Ein Exkurs zur Grounded Theory als Methode der Datenanalyse wird ebenfalls gegeben. Das Kapitel beschreibt die konkrete Umsetzung des ethnografischen Ansatzes in der vorliegenden Studie.
5 Humandifferenzierung im Unterrichtsgeschehen: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert konkrete Fallbeispiele aus dem Unterricht der vierten Klasse. Es untersucht verschiedene Differenzierungsprozesse und deren Auswirkungen. Die einzelnen Unterkapitel (5.1-5.4) untersuchen spezifische Situationen und zeigen, wie Differenzierungen beispielsweise aufgrund von Sprachbarrieren, Leistungsunterschieden oder individuellen Schülermerkmalen entstehen und wirken.
Schlüsselwörter
Humandifferenzierung, Doing Differences, Undoing Differences, Ethnografie, Qualitative Forschung, Unterrichtsforschung, Grundschule, Lehrerhandeln, Schüler, Inklusion, Differenzierungsprozesse, Kategorisierung, soziale Zugehörigkeit, Fallstudien, Hirschauer.
Häufig gestellte Fragen zur ethnografischen Studie: Humandifferenzierung im Grundschulunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese ethnografische Studie untersucht Humandifferenzierungsprozesse im Kontext einer vierten Grundschulklasse. Der Fokus liegt auf der Analyse von ausgewählten Fallbeispielen und der Kategorisierungsprozesse anhand des Humandifferenzierungsansatzes nach Hirschauer (2017). Ziel ist es, Differenzierungsverfahren greifbarer zu machen und als Reflexionsgrundlage für Lehrerhandeln zu dienen.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine ethnografische Forschungsmethode. Dies beinhaltet Feldforschung im Klassenzimmer, Methodenopportunismus (flexible Anpassung der Methoden an die Situation) und einen detaillierten Verschriftlichungsprozess. Die Datenanalyse erfolgt unter Anwendung der Grounded Theory.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt die folgenden Themen: Analyse von Humandifferenzierung im schulischen Alltag, Untersuchung der Auswirkungen von Differenzierungsprozessen auf Schüler, Anwendung des Humandifferenzierungsansatzes nach Hirschauer, Reflexion von Lehrerhandeln im Hinblick auf Differenzierung und Darstellung konkreter Fallbeispiele aus dem Unterricht. Spezifische Beispiele beinhalten Differenzierungen aufgrund vermeintlicher Sprachbarrieren, Loben und Tadeln im Zusammenhang mit Störungen und Leistung, sowie die Untersuchung eines individuellen Falls ("Der Fall Hüseyin").
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung (Relevanz des Themas, Vorstellung des Ansatzes von Hirschauer), Humandifferenzierung (theoretische Grundlagen), Ethnografieforschung (methodische Vorgehensweise), Humandifferenzierung im Unterrichtsgeschehen (Fallbeispiele und Analysen) und Abschließende Betrachtung. Die Kapitel beinhalten detaillierte Beschreibungen der Methodik, der theoretischen Grundlage und der Ergebnisse der Fallstudien.
Welche theoretische Grundlage liegt der Studie zugrunde?
Die Studie basiert auf dem Humandifferenzierungsansatz nach Hirschauer (2017). Dieser Ansatz untersucht, wie Menschen in sozialen Kontexten nach verschiedenen Aspekten (Ethnizität, Geschlecht, Leistung etc.) unterschieden und kategorisiert werden und welche Funktionen diese Kategorisierungen haben (Ordnung, Selbstverortung, Abwertung, Idealisierung etc.).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Studie?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Humandifferenzierung, Doing Differences, Undoing Differences, Ethnografie, Qualitative Forschung, Unterrichtsforschung, Grundschule, Lehrerhandeln, Schüler, Inklusion, Differenzierungsprozesse, Kategorisierung, soziale Zugehörigkeit, Fallstudien, Hirschauer.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, Humandifferenzierungsprozesse im schulischen Kontext zu analysieren und die Auswirkungen dieser Prozesse auf Schüler zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen als Reflexionsgrundlage für Lehrerhandeln dienen und dazu beitragen, Differenzierungsverfahren transparenter und kritischer zu betrachten.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Lehrende, Lehramtsstudierende, Forschungsinteressierte im Bereich der Pädagogik und Sozialwissenschaften sowie alle, die sich mit Fragen der Inklusion, Differenzierung und sozialer Gerechtigkeit im Bildungskontext auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Lisa Donath (Auteur), 2019, (Un-)Doing Differences im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508013