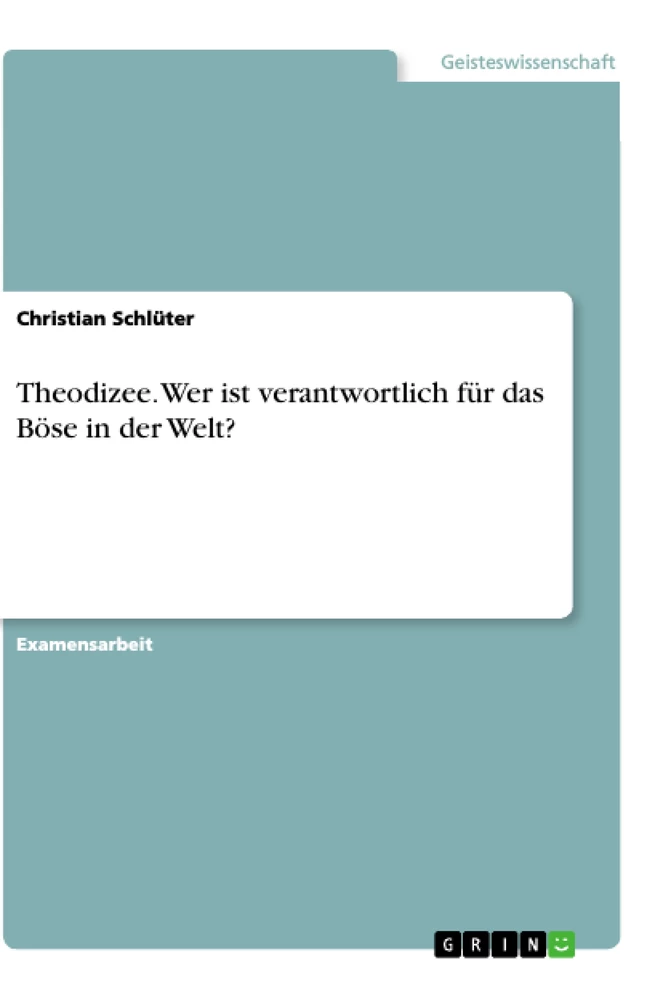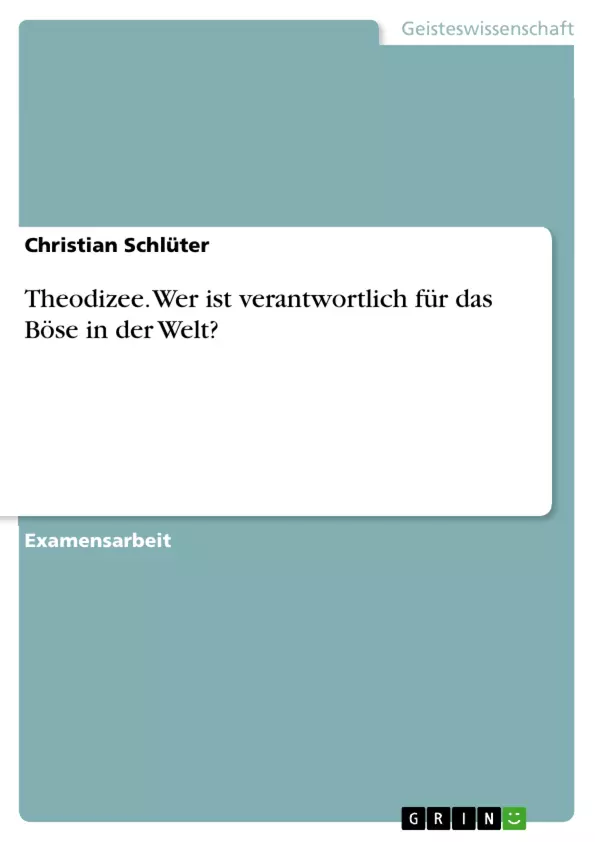Die 'Gottesrede' von Johann Baptist Metz ist nicht die eines Skeptikers, sondern die eines Gläubigen, der nach Auschwitz nach einer neuen Form der 'Gottesrede' sucht. Diese neue Form kennzeichnet er mit dem Titel der "Mystik des Leidens an Gott" und bezieht sich darin auf die Gebetstraditionen Israels. Sie ist die radikalisierte Form der Theodizeefrage.
Jeder Lösungsversuch der Theodizeefrage, so könnte man zunächst als Hypothese festhalten, muss in eine Depotenzierung Gottes einmünden, will man auch nur annähernd am tradierten Gottesbegriff festhalten. Keine Lösungsstrategie der Theodizeefrage ist daher geeignet, die historisch wie gegenwärtig geglaubten Attribute Gottes aufrechtzuerhalten, ohne in einen extremen Widerspruch zu geraten.
Diese These ist Hauptkennzeichen der modernen Theodizeedebatte, daher soll nachfolgend ein kurzer systematischer Überblick der Entlastungsstrategien Gottes angesichts des Übels einen Einblick in die historischen Argumentationsstrukturen bringen.
Im weiteren Verlauf soll dann das System Schellings bezüglich seines Lösungsversuches der Theodizee dargestellt, untersucht und diskutiert werden, um in einem Schlussteil nochmals die Wortführer der modernen Theodizeedebatte anklingen zu lassen.
Ziel eines ersten Hauptteils soll es sein, neben dem systematischen Überblick des Theodizee-Problems die philosophische Entwicklung Schellings kurz und thesenhaft darzustellen.
In einem zweiten Hauptteil sollen die Texte mit Hilfe der einschlägigen Schelling-Literatur interpretiert werden. Dabei konzentriere ich mich ausschließlich auf das Problem des 'Bösen' und der 'Freiheit' bei Schelling. Anthropologische Ansätze werden nur insofern berücksichtigt, als es für die Beschreibung des Freiheitsbegriffs notwendig erscheint.
In einem dritten Hauptteil sollen die Interpretationsergebnisse thesenhaft zusammengefasst werden, um so zu einer Begriffsbestimmung von 'Freiheit' und 'Böse' zu gelangen. Dabei soll anhand dieser Begriffe die Lösungsstrategie aufgedeckt werden, die Schelling in die Theodizeedebatte seiner Zeit einbringt.
Der Schlussteil schließlich soll die thesenhaft diskutierten Ansätze zu einem Gesamtüberblick vereinigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Problemkreis der Theodizee in der gegenwärtigen Diskussion
- 2.1. Der Begriff Theodizee als neuzeitliche Wortprägung
- 2.2. Thesenhafter Überblick
- 2.3 Zusammenfassung und kritische Würdigung
- 3. Schellings philosophische Entwicklung - ein skizzenhafter Überblick
- 3.1 Der Begriff des Bösen in der frühen
- 3.2 Der Begriff des Bösen in der Naturphilosophie
- 3.3 Der Begriff des Bösen in dem System des transzendentalen Idealismus
- 3.4 Das Problem des Bösen in der Epoche der Identitätsphilosophie
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.6 Ergebnis
- 4. Versuch einer Interpretation der Freiheitsschrift
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Formale Gliederung der Schrift
- 4.3 Der Problemkreis der Freiheit
- 4.4 Kritische Betrachtung
- 5. Der Problemkreis des Bösen und der Freiheit in der Spätphilosophie Schellings
- 5.1 Allgemeiner Charakter der Philosophie der Mythologie und Offenbarung
- 5.2 Der Mythosbegriff bei Schelling
- 5.3 Monotheismus als Grundlage des Polytheismus
- 5.4 Die Entwicklung des religiösen Bewusstseins
- 5.5 Die Stellung Gottes zur Schöpfung
- 5.6 Gott als absolutes Sein
- 5.7 Die Schöpfung als Verwirklichung Gottes
- 5.8 Der Trinitarische Gottesbegriff
- 5.9 Der Sündenfall in Schellings Spätphilosophie
- 5.10 Besprechung des Sündenfalltheorems
- 5.11 Die Auswirkung des Sündenfalls auf den Sohn
- 5.12 Der Problemkreis des Bösen in der Spätphilosophie
- 5.13 Etymologie des Begriffs 'Satan'
- 5.14 'Satan' als allgemeiner Begriff
- 5.16 Die Wirklichkeit des Bösen
- 5.17 Satans Verhältnis zum Vater als dialektisches Prinzip
- 5.18 Satans Verhältnis zum Sohn als Widersacher
- 5.19 Satan, als Versucher, in seinem Verhältnis zum idealen Menschen
- 5.20 Satan als böse Macht, in seinem Verhältnis zum einzelnen Menschen
- 5.21 Die Sünde als verkehrte Verselbständigung
- 5.22 Das Gute als Bindung an Gottes Willen
- 6. Schellings Lösungsversuch des Theodizeeproblems als abschließende Betrachtung der Philosophie der Mythologie und Offenbarung
- 6.1 Die Notwendigkeit des Falls für die Gottheit
- 6.2 Die Notwendigkeit des Falls für den Menschen
- 6.3 Mögliche Lösung des Theodizeeproblems bei Schelling
- 6.4 Abschließende kritische Fragen an Schelling
- 6.5 Das Problem des Leidens bei Schelling
- 6.6 Die Idee des leidenden Gottes
- 7. Zum Religionsbegriff Schellings
- 7.1 Zum Gottesbegriff Schellings
- 7.2 Zur Frage nach der 'wahren' und 'unwahren Wiedergeburt'
- 8. Abschließende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems. Ziel ist es, Schellings philosophische Entwicklung nachzuzeichnen und seine Argumentation im Kontext der modernen Theodizeedebatte zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf Schellings Begriff des Bösen und der Freiheit und deren Rolle in seinem Lösungsansatz.
- Schellings philosophische Entwicklung und seine Konzeption des Bösen
- Interpretation von Schellings Freiheitsschrift
- Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems
- Der Begriff von Freiheit und Böse bei Schelling
- Schellings Religions- und Gottesbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Theodizee ein und stellt die zentrale Frage nach Gottes Verantwortung für das Böse in der Welt. Sie betont die Aktualität des Problems nach Auschwitz und die Notwendigkeit einer neuen Gottesrede. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der einen systematischen Überblick über die Theodizeedebatte und eine detaillierte Analyse von Schellings Philosophie beinhaltet.
2. Der Problemkreis der Theodizee in der gegenwärtigen Diskussion: Dieses Kapitel bietet einen systematischen Überblick über verschiedene Lösungsstrategien des Theodizee-Problems in der Geschichte der Philosophie. Es analysiert den Begriff der Theodizee selbst und skizziert die wichtigsten historischen Argumentationslinien. Der Fokus liegt auf den Schwierigkeiten, einen traditionellen Gottesbegriff angesichts des Leidens in der Welt aufrechtzuerhalten.
3. Schellings philosophische Entwicklung - ein skizzenhafter Überblick: Dieses Kapitel zeichnet einen Überblick über Schellings philosophische Entwicklung nach und analysiert die Wandlung seines Verständnisses von "Böse" in seinen verschiedenen philosophischen Phasen. Es zeigt die Entwicklung seines Denkens von der frühen Philosophie bis zur Spätphilosophie und legt den Grundstein für die detaillierte Analyse seiner Theodizee-Auffassung.
4. Versuch einer Interpretation der Freiheitsschrift: Dieses Kapitel widmet sich einer Interpretation von Schellings Schrift zum Thema Freiheit. Es analysiert die formale Struktur des Textes und untersucht den Problemkreis der Freiheit in Schellings Werk. Die kritische Betrachtung beleuchtet die Stärken und Schwächen von Schellings Argumentation in Bezug auf die Verbindung von Freiheit und Verantwortung.
5. Der Problemkreis des Bösen und der Freiheit in der Spätphilosophie Schellings: Dieser Abschnitt befasst sich mit Schellings Spätphilosophie und der Rolle von Bösem und Freiheit in seinem System. Es analysiert seine Konzeption des Mythos, des Monotheismus und Polytheismus, und die Bedeutung des Sündenfalls in seinem Denken. Es untersucht Satans Rolle und das Verhältnis von Gut und Böse in Bezug auf Gottes Willen und die menschliche Freiheit.
6. Schellings Lösungsversuch des Theodizeeproblems als abschließende Betrachtung der Philosophie der Mythologie und Offenbarung: Dieses Kapitel stellt Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems dar. Es analysiert die Notwendigkeit des Falls sowohl für Gott als auch für den Menschen in Schellings System. Es präsentiert eine mögliche Lösung des Problems aus Schellings Perspektive und unterzieht diese einer kritischen Prüfung, unter Berücksichtigung des Problems des Leidens und der Idee eines leidenden Gottes.
7. Zum Religionsbegriff Schellings: Dieses Kapitel analysiert Schellings Religionsbegriff, insbesondere seinen Gottesbegriff und die Frage nach der "wahren" und "unwahren Wiedergeburt". Es vertieft das Verständnis seiner theologischen Position und seiner Antwort auf das Problem des Bösen.
Schlüsselwörter
Theodizee, Schelling, Böse, Freiheit, Gott, Leid, Sündenfall, Mythologie, Offenbarung, Transzendentaler Idealismus, Identitätsphilosophie, Religionsbegriff, Gottesbegriff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schellings Theodizee
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems. Sie analysiert seine philosophische Entwicklung und seine Argumentation im Kontext der modernen Theodizeedebatte, mit Schwerpunkt auf Schellings Begriff des Bösen und der Freiheit und deren Rolle in seinem Lösungsansatz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Schellings philosophische Entwicklung und seine Konzeption des Bösen, eine Interpretation seiner Freiheitsschrift, seinen Lösungsversuch des Theodizee-Problems, seinen Begriff von Freiheit und Böse, sowie seinen Religions- und Gottesbegriff. Sie umfasst auch einen Überblick über die gegenwärtige Theodizeedebatte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Kapitel 1 ist eine Einleitung. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Theodizeedebatte. Kapitel 3 skizziert Schellings philosophische Entwicklung. Kapitel 4 interpretiert Schellings Freiheitsschrift. Kapitel 5 analysiert das Problem von Böse und Freiheit in Schellings Spätphilosophie. Kapitel 6 präsentiert und kritisiert Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems. Kapitel 7 behandelt Schellings Religionsbegriff. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte von Schellings Philosophie werden besonders untersucht?
Besonders untersucht werden Schellings Begriff des Bösen in seinen verschiedenen philosophischen Phasen (frühe Philosophie, Naturphilosophie, transzendentaler Idealismus, Identitätsphilosophie, Spätphilosophie), seine Konzeption des Mythos, des Monotheismus und Polytheismus, der Sündenfall in seinem Denken, Satans Rolle, das Verhältnis von Gut und Böse, Gottes Wille und menschliche Freiheit, sowie Schellings Gottes- und Religionsbegriff.
Welche Schlüsselkonzepte werden verwendet?
Schlüsselkonzepte sind Theodizee, Schelling, Böse, Freiheit, Gott, Leid, Sündenfall, Mythologie, Offenbarung, Transzendentaler Idealismus, Identitätsphilosophie, Religionsbegriff und Gottesbegriff.
Wie wird Schellings Lösungsversuch des Theodizee-Problems dargestellt?
Schellings Lösungsversuch wird im Kontext seiner Philosophie der Mythologie und Offenbarung dargestellt. Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit des Falls sowohl für Gott als auch für den Menschen und untersucht die Möglichkeit einer Lösung des Problems aus Schellings Perspektive, unter Berücksichtigung des Problems des Leidens und der Idee eines leidenden Gottes. Die Arbeit unterzieht diesen Lösungsversuch auch einer kritischen Prüfung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen systematischen Ansatz, der einen Überblick über die Theodizeedebatte mit einer detaillierten Analyse von Schellings Philosophie verbindet. Sie beinhaltet eine Interpretation von Schellings Texten und eine kritische Betrachtung seiner Argumentation.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Philosophie, Theologie und die Geschichte der Philosophie interessieren, insbesondere für Schellings Werk und das Theodizee-Problem. Sie ist besonders relevant für akademische Zwecke und die Analyse philosophischer Themen.
- Citar trabajo
- Christian Schlüter (Autor), 1990, Theodizee. Wer ist verantwortlich für das Böse in der Welt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508161