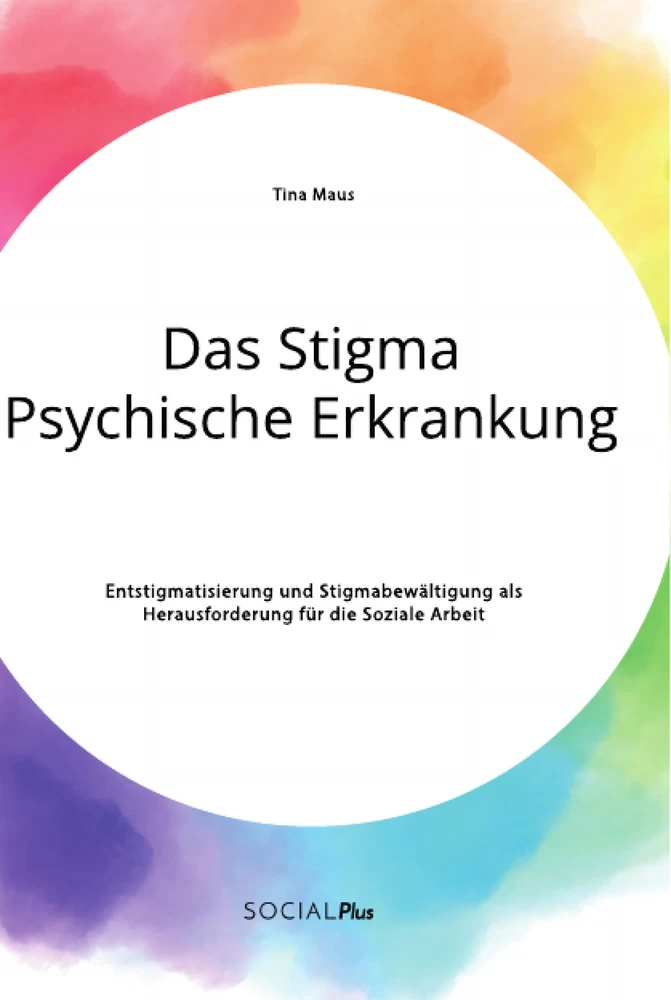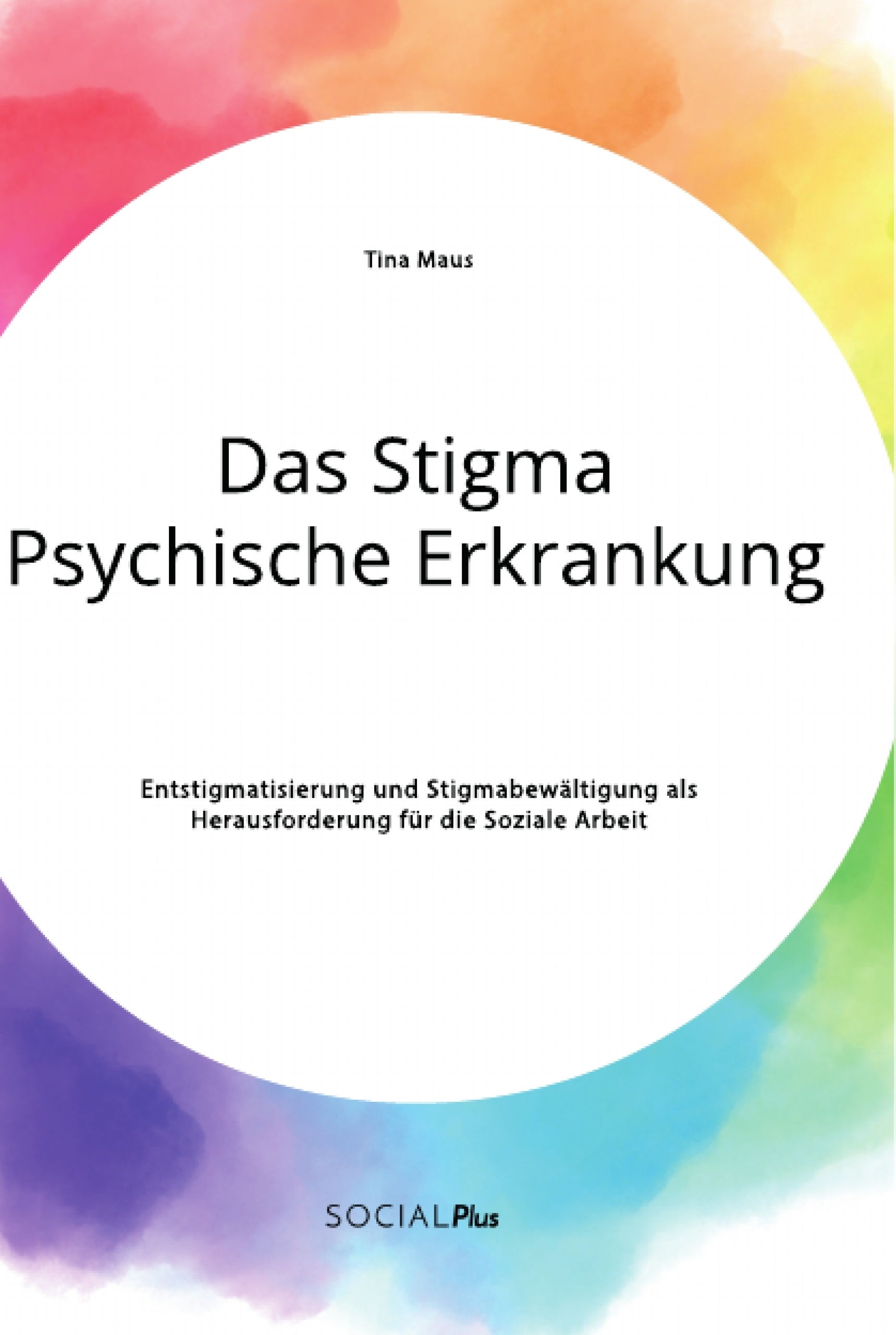Psychische Erkrankungen stellen in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema dar. So haben Betroffene neben der Erkrankung häufig auch mit negativen Vorurteilen, Diskriminierung und Stigmatisierung zu kämpfen. Die Diagnose wirkt als soziales Urteil, das gesellschaftliche Isolation und Armut zur Folge haben kann.
Die Autorin Tina Maus untersucht in dieser Publikation, inwieweit Menschen mit psychischen Erkrankungen nach wie vor in unserer Gesellschaft diskriminiert und stigmatisiert werden. Dabei geht sie der Frage auf den Grund, wieso es so schwer erscheint, die psychische Ausdehnung einer Erkrankung zu betrachten und die richtigen Schlussfolgerungen zu treffen.
Welche Möglichkeiten kommen aus sozialarbeiterischer Sicht in Frage, um das Ansehen psychischer Erkrankungen zu verbessern? Kann es gelingen, Betroffene wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ohne dass sie einer Stigmatisierung zum Opfer fallen?
Aus dem Inhalt:
- Stigmatisierung;
- psychische Erkrankung;
- Vorurteile;
- Tabuthema;
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischer Erkrankung in unserer Gesellschaft
- Was versteht man unter einer psychischen Erkrankung?
- Zur Bedeutung von Stigma, Stigmatisierung und Diskriminierung
- Entstehungsprozess von Stigmatisierung
- Erscheinungsformen von Stigmatisierung
- Folgen und Auswirkungen von Stigmatisierung
- Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozesse in der Gesellschaft
- Historische Stigmatisierungsprozesse und gesellschaftliche Stellung von Menschen mit psychischer Erkrankung
- Entwicklung im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen seit dem 19. Jahrhundert bis heute
- Stigmatisierung und Diskriminierung am Beispiel der Depression
- Depressionen im Profifußball
- Der Suizid des Fußballspielers Robert Enke
- Entstigmatisierung und Stigmabewältigung aus dem Blickwinkel der Sozialen Arbeit
- Rechtliche Grundlagen für die Soziale Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Aufgaben der Sozialen Arbeit
- Ansätze zur Intervention auf der gesellschaftlichen Ebene
- Individuelle Stigmabewältigung durch Empowerment
- Interprofessionelle Zusammenarbeit
- Teilhabechancen Betroffener am Beispiel Arbeitsmarkt
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Sie untersucht, warum es so schwer erscheint, die psychische Ausdehnung einer Erkrankung zu betrachten und angemessene Schlussfolgerungen zu treffen. Die Arbeit analysiert die Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen von Stigmatisierung, sowie die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Schließlich betrachtet sie die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Entstigmatisierung und Stigmabewältigung.
- Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Erscheinungsformen und Folgen von Stigmatisierung
- Historische und gesellschaftliche Entwicklungen im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen
- Rolle der Sozialen Arbeit bei der Entstigmatisierung und Stigmabewältigung
- Individuelle Stigmabewältigung durch Empowerment und Teilhabechancen Betroffener
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Tabuisierung psychischer Erkrankungen und ihre negativen Folgen wie Stigmatisierung und Diskriminierung. Es stellt die These auf, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen trotz Fortschritten in der medizinischen Versorgung und gesellschaftlichen Einstellungen weiterhin Diskriminierung und Stigmatisierung erleben.
- Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischer Erkrankung in unserer Gesellschaft: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „psychische Erkrankung“, „Stigma“, „Stigmatisierung“ und „Diskriminierung“. Es beleuchtet den Entstehungsprozess und die Auswirkungen von Stigmatisierung und beschreibt die verschiedenen Erscheinungsformen, die in der Gesellschaft auftreten können.
- Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozesse in der Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert historische und gesellschaftliche Entwicklungen im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Es betrachtet die Veränderungen in der gesellschaftlichen Stellung von Menschen mit psychischen Erkrankungen über die letzten Jahrhunderte und untersucht, wie sich der Umgang mit ihnen gewandelt hat.
- Stigmatisierung und Diskriminierung am Beispiel der Depression: Dieses Kapitel untersucht die Stigmatisierung von Depressionen, insbesondere im Profifußball. Es beleuchtet den Fall des Fußballspielers Robert Enke und die Folgen von Stigmatisierung und Diskriminierung auf Sportler, die an einer psychischen Erkrankung leiden.
- Entstigmatisierung und Stigmabewältigung aus dem Blickwinkel der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit in der Entstigmatisierung und Stigmabewältigung. Es beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, Aufgaben und Ansätze der Sozialen Arbeit, die der Verbesserung der Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen dienen. Es stellt auch die Bedeutung von Empowerment und interprofessioneller Zusammenarbeit sowie die Teilhabechancen Betroffener am Arbeitsmarkt in den Vordergrund.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie psychische Erkrankung, Stigmatisierung, Diskriminierung, Entstigmatisierung, Stigmabewältigung, Soziale Arbeit, Empowerment, Teilhabe und Integration. Sie analysiert die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen, beleuchtet die Ursachen und Folgen von Stigmatisierung und untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Entstigmatisierung und Stigmabewältigung.
- Quote paper
- Tina Maus (Author), 2020, Das Stigma Psychische Erkrankung. Entstigmatisierung und Stigmabewältigung als Herausforderung für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508242