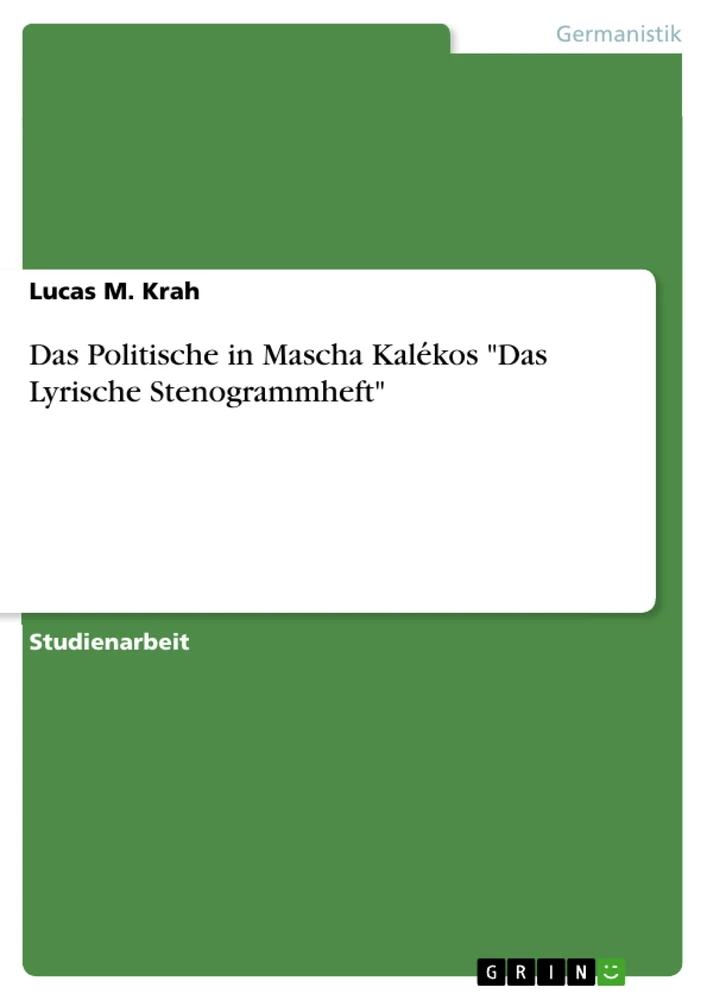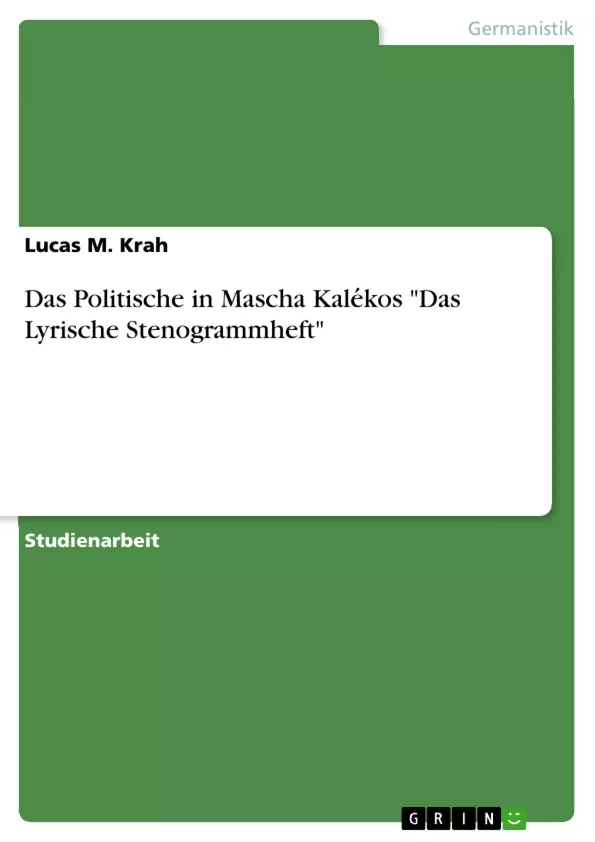Die erfolgreichste deutschsprachige Lyrikerin des 20. Jahrhunderts Mascha Kaléko emigrierte 1937 nach New York. Als Jüdin konnte sie nicht mehr in Nazi-Deutschland bleiben, sie hat sich danach auf ihren Besuchen nie wieder in Deutschland heimisch gefühlt, und auch die Germanistik hat sie nie wirklich "repatriiert". Die leichte Verständlichkeit ohne politische Apelle, wie man sie beispielsweise bei Tucholsky findet, haben wohl mit dazu beigetragen, dass ihr von Seiten der Literaturwissenschaft lange Zeit wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Auch die Kritik Walter Benjamins an vielen neusachlichen Autoren – allen voran Erich Kästner – darf wohl auch auf Kalékos Werk bezogen werden, wird sie doch als weiblicher Kästner bezeichnet.
Diese Arbeit untersucht anhand von drei exemplarischen Gedichten aus "Das Lyrische Stenogrammheft" den politischen Gehalt von Mascha Kalékos Lyrik. Zu diesem Zweck beginnt die Arbeit mit einer definitorischen Annäherung an den Begriff "politisch". Aus diesem Grund wird – unter Rückgriff auf Aristoteles und Hannah Arendt – eine Arbeitsdefinition für die weitere Arbeit formuliert. Die Gedichte, die auf ihren politischen Gehalt hin analysiert werden, sind zunächst Mannequins und Der Herr von Schalter Neun. Sie zeigen das Verhältnis von Einzelpersonen bzw. Personengruppen zu ihrem Beruf.
Inwiefern sich hieran Kritik am ökonomischen und gesellschaftlichen System zur Zeit der Weimarer Republik findet, soll im Detail untersucht werden. Die so servile wie bestimmende Art des Beamten wird hierzu mit dem Konzept des autoritären Charakters aus der Kritischen Theorie verglichen. In Großstadtliebe schließlich zeigen sich bereits im Titel zwei Leitthemen Kalékos. Das lyrische Ich beschreibt hierin abgeklärt und distanziert den Verlauf einer Romanze, die in der Schnelllebigkeit des großstädtischen Trubels stattfindet. Das Schicksal von alltäglichen Einzelpersonen in Der Herr von Schalter Neun und Mannequins und das Fehlen von jugendlichen Leidenschaften vor dem Hintergrund der anonymen Großstadt in Großstadtliebe sind Motive, die im "Lyrischen Stenogrammheft" häufig vorkommen und bilden deswegen eine für diesen Umfang repräsentative Auswahl. Abschließend werden die Gedichte mit Benjamins Kritik in Bezug gesetzt und allgemein die Frage beantwortet, auf welche Weise das Werk Kalékos als politisch werden betrachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist „politisch“?
- Walter Benjamins Linke Melancholie als Beispiel für Kritik an neusachlicher Lyrik
- Die Beschränkung auf Das Lyrische Stenogrammheft
- Der warenförmige Körper der Mannequins
- Charakterstudie am Vorabend des Dritten Reiches: Der Herr von Schalter Neun
- Verdinglichung oder Befreiung? Liebeskonzeption in Großstadtliebe
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem politischen Gehalt der Lyrik Mascha Kalékos, einer deutschen Dichterin, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1937 nach New York emigrierte. Die Arbeit untersucht, inwiefern Kalékos Werk als politisches Handeln betrachtet werden kann, und analysiert exemplarisch drei Gedichte aus ihrem Band "Das Lyrische Stenogrammheft".
- Definition des Begriffs "politisch" im Kontext von Kalékos Lyrik
- Analyse von Kalékos Gedichten im Hinblick auf Kritik an gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen der Weimarer Republik
- Bezugnahme auf Walter Benjamins Kritik an neusachlicher Lyrik und deren Relevanz für Kalékos Werk
- Untersuchung der Themenbereiche Liebeskonzeption und Anonymität in der Großstadt in Kalékos Lyrik
- Die Rolle der Sprache und des individuellen Wunsches im Kontext von politischer Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Mascha Kalékos Leben und Werk vor, beleuchtet die bisherige literaturwissenschaftliche Rezeption ihrer Lyrik und führt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit ein.
- Was ist "politisch"?: Dieses Kapitel widmet sich der begrifflichen Klärung des Politischen und betrachtet verschiedene Definitionen des Begriffs, darunter Aristoteles' Konzept des zoon politikon und Hannah Arendts Theorie der vita activa.
- Walter Benjamins Linke Melancholie als Beispiel für Kritik an neusachlicher Lyrik: In diesem Kapitel analysiert die Arbeit Walter Benjamins Kritik an der neusachlichen Lyrik, insbesondere an Erich Kästner, und untersucht, inwiefern sich diese Kritik auf Mascha Kalékos Werk anwenden lässt.
- Der warenförmige Körper der Mannequins: Dieses Kapitel untersucht Kalékos Gedicht "Mannequins" im Hinblick auf die Darstellung von Arbeit und gesellschaftlichen Verhältnissen in der Weimarer Republik.
- Charakterstudie am Vorabend des Dritten Reiches: Der Herr von Schalter Neun: Dieses Kapitel analysiert Kalékos Gedicht "Der Herr von Schalter Neun" und untersucht die Rolle des Beamten in der Weimarer Republik im Kontext von Kritik am autoritären Charakter.
- Verdinglichung oder Befreiung? Liebeskonzeption in Großstadtliebe: Dieses Kapitel analysiert Kalékos Gedicht "Großstadtliebe" und untersucht die Liebeskonzeption in Kalékos Lyrik vor dem Hintergrund der Schnelllebigkeit und Anonymität der Großstadt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der deutschen Literatur der Weimarer Republik, darunter die Kritik am ökonomischen und gesellschaftlichen System, die Rolle der Sprache in der Politik, die Anonymität der Großstadt und die Liebeskonzeption. Weitere Schlüsselwörter sind: Mascha Kaléko, Walter Benjamin, Neusachlichkeit, "Das Lyrische Stenogrammheft", politische Dichtung, individuelle Wünsche, Gemeinwesen.
- Citation du texte
- Lucas M. Krah (Auteur), 2019, Das Politische in Mascha Kalékos "Das Lyrische Stenogrammheft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508327