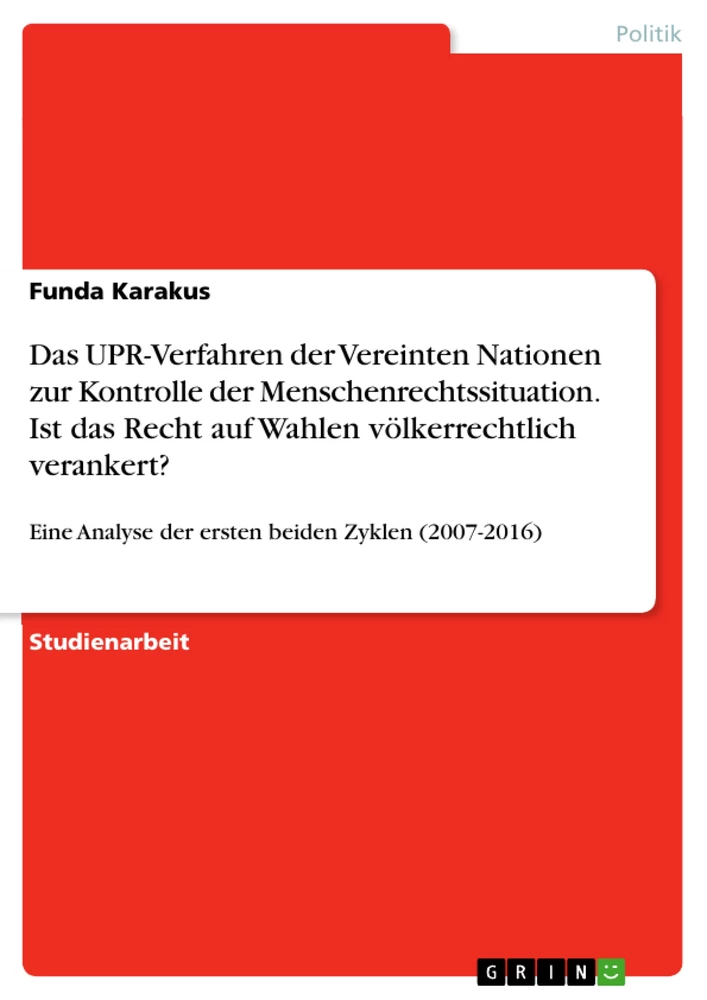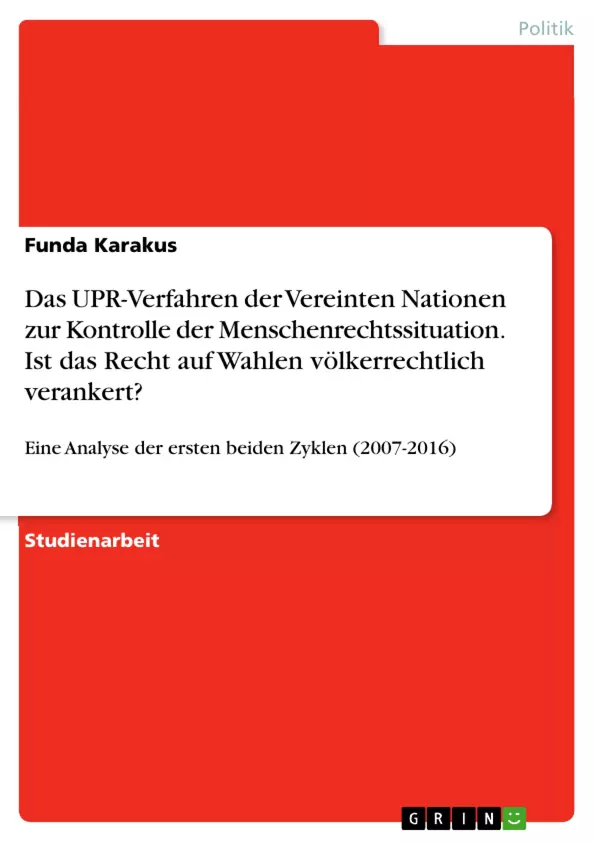Diese Arbeit befasst sich mit dem UPR-Verfahren der Vereinten Nationen zur Kontrolle der Menschenrechtssituation. Die Vereinte Nationen verfügen zwar über keine eigenen militärischen Mittel, ihre Macht im Bereich der Kommunikation ist dagegen umso höher. Sie gelten nicht nur als Normsetzer von Menschenrechten, sondern müssen auch regelmäßig die Einhaltung derer kontrollieren. Ein zusätzliches Instrument zur Individualbeschwerde und zum Staatenberichtsverfahren zur Kontrolle der Menschenrechtssituation in den einzelnen Staaten wurde vor zehn Jahren eingeführt: das UPR-Verfahren (universal periodic review), das zur periodischen und universalen Überprüfung dienen soll. Im Rahmen des Verfahrens sollte eine Diskussion globaler Probleme auf Augenhöhe ermöglicht werden.
Bisher wurden die Staaten erst aufgrund von Individualbeschwerden und dem Staatenbericht, den jeder Staat in regelmäßigen Abständen beim Menschenrechtsrat einreichen muss, auf Menschenrechtsverletzungen überprüft. Die Verfahren brachten diverse Defizite mit sich, unter anderem, dass Staaten ihre Berichte erst verspätet einreichten. Welche Themen werden dabei am häufigsten kritisiert? Ist das Recht auf Wahlen völkerrechtlich verankert? Kritisieren Staaten im Rahmen des Verfahrens Wahlsysteme anderer Staaten?
Zur Beantwortung der Fragen ist es zwingend notwendig, die Struktur und Organisation des Verfahrens zu beschreiben. Außerdem werden mithilfe einer von der Nichtregierungsorganisation upr-info zur Verfügung gestellten Datenbank die ersten beiden Zyklen des Verfahrens ausgewertet und anhand einer Auswahl von Ländern ein Gesamtkontext hergestellt. Alle Statistiken und Zahlen zu den Empfehlungen und Themenbereichen stützen sich auf die Informationen aus der Datenbank des upr-info. Das UPR-Verfahren wurde im Jahr 2007 durch die Resolution 60/251 vom Menschenrechtsrat geschaffen. Das Verfahren dient dazu, die Staaten hinsichtlich ihrer Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte universal und periodisch zu überprüfen. Ausgangspunkt für die Überprüfung bilden gemäß Artikel 1 der Menschenrechtsrat-Resolution A/HRC/5/1: die UNO-Charta, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, sowie alle internationalen Menschenrechtsverträge, die ein Staat ratifiziert habe. Universell bedeutet, dass sich alle Staaten dem Verfahren gleichermaßen unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das UPR-Verfahren - Einführung, Ablauf und Struktur
- Einführung des Instruments
- Chronologischer Ablauf und Struktur
- Eine Bilanz der ersten beiden Zyklen des UPR-Verfahrens
- Bewertung des Verfahrens
- Statistiken und Daten zum Thema Wahlen im Vergleich zu anderen Themen
- Wahlen und Wahlrecht im UPR-Verfahren
- Das Wahlrecht - eine völkerrechtliche Verpflichtung?
- Empfehlungen zum Thema Wahlen anhand von Länderbeispielen
- Erklärungsversuch der geringen Thematisierung von Wahlen im UPR-Verfahren
- Wahlen und Demokratie
- Die Verpflichtung der Teilnahme von Staaten am UPR-Verfahren
- Empfehlungen im Kontext aktueller Ereignisse
- Politische Partizipation - wichtige Faktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das UPR-Verfahren (Universal Periodic Review) der Vereinten Nationen und untersucht die Rolle von Wahlen und Wahlrecht in diesem Kontext. Ziel ist es, die Bedeutung von Wahlen für die Einhaltung von Menschenrechten zu beleuchten und zu untersuchen, warum Wahlen im UPR-Verfahren bisher nur eine geringe Rolle spielen.
- Die Struktur und Organisation des UPR-Verfahrens
- Die Bedeutung des Wahlrechts für die Einhaltung von Menschenrechten
- Die Analyse von Empfehlungen zum Thema Wahlen in den ersten beiden Zyklen des UPR-Verfahrens
- Die Identifizierung von Faktoren, die die geringe Thematisierung von Wahlen im UPR-Verfahren erklären
- Empfehlungen zur Verbesserung der Einbindung von Wahlen im UPR-Verfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das UPR-Verfahren als ein wichtiges Instrument der Menschenrechtsüberwachung der Vereinten Nationen ein und beleuchtet die Notwendigkeit der periodischen Überprüfung von Staaten hinsichtlich ihrer Menschenrechtsverpflichtungen.
Kapitel 2 erklärt die Struktur und Organisation des UPR-Verfahrens, beginnend mit der Einführung des Instruments und der Beschreibung seines chronologischen Ablaufs. Es stellt die drei Hauptdokumente dar, die der Überprüfung zugrunde liegen, sowie den Ablauf des interaktiven Dialogs zwischen der UPR-Arbeitsgruppe und den Delegierten des jeweiligen Staates.
Kapitel 3 bietet eine Bilanz der ersten beiden Zyklen des UPR-Verfahrens, einschließlich einer Bewertung der Gesamteffektivität des Verfahrens. Hier wird auch die Bedeutung von Wahlen und Wahlrecht in den Empfehlungen der UPR-Arbeitsgruppe untersucht und in Bezug zu anderen Themenbereichen gesetzt.
Kapitel 4 konzentriert sich auf das Wahlrecht im UPR-Verfahren und stellt die Frage, ob das Wahlrecht eine völkerrechtliche Verpflichtung darstellt. Anhand von Länderbeispielen werden Empfehlungen zum Thema Wahlen untersucht.
Kapitel 5 untersucht, warum Wahlen im UPR-Verfahren bisher nur eine geringe Rolle spielen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie und die Verpflichtung der Staaten zur Teilnahme am UPR-Verfahren. Außerdem werden aktuelle Ereignisse im Kontext des UPR-Verfahrens beleuchtet und Faktoren zur Erklärung der geringen Thematisierung von Wahlen untersucht.
Schlüsselwörter
UPR-Verfahren, Menschenrechte, Wahlen, Wahlrecht, Völkerrecht, Demokratie, Politische Partizipation, Staatenüberprüfung, Empfehlungen, Universal Periodic Review, Human Rights, Elections, Electoral Rights, International Law, Democracy, Political Participation, State Review, Recommendations
Häufig gestellte Fragen
Was ist das UPR-Verfahren der Vereinten Nationen?
Das Universal Periodic Review (UPR) ist ein Mechanismus des UN-Menschenrechtsrats zur regelmäßigen Überprüfung der Menschenrechtssituation in allen UN-Mitgliedstaaten.
Ist das Recht auf Wahlen völkerrechtlich verankert?
Die Arbeit untersucht diese Frage und analysiert, inwieweit Wahlrecht und demokratische Prozesse Teil der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten sind.
Wie läuft ein UPR-Prüfzyklus ab?
Der Ablauf umfasst die Einreichung von Berichten, einen interaktiven Dialog im Menschenrechtsrat und die Abgabe von Empfehlungen durch andere Staaten.
Warum spielen Wahlen im UPR-Verfahren bisher eine eher geringe Rolle?
Die Arbeit versucht dies durch Faktoren wie politische Partizipation, die Art der staatlichen Souveränität und die Priorisierung anderer Menschenrechtsthemen zu erklären.
Welche Dokumente bilden die Grundlage für die UPR-Überprüfung?
Grundlagen sind die UNO-Charta, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und alle vom jeweiligen Staat ratifizierten Menschenrechtsverträge.
Was bedeutet "universell" im Zusammenhang mit dem UPR?
Es bedeutet, dass sich absolut jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen dem Verfahren unterziehen muss, ohne Ausnahme.
- Quote paper
- Funda Karakus (Author), 2017, Das UPR-Verfahren der Vereinten Nationen zur Kontrolle der Menschenrechtssituation. Ist das Recht auf Wahlen völkerrechtlich verankert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508360