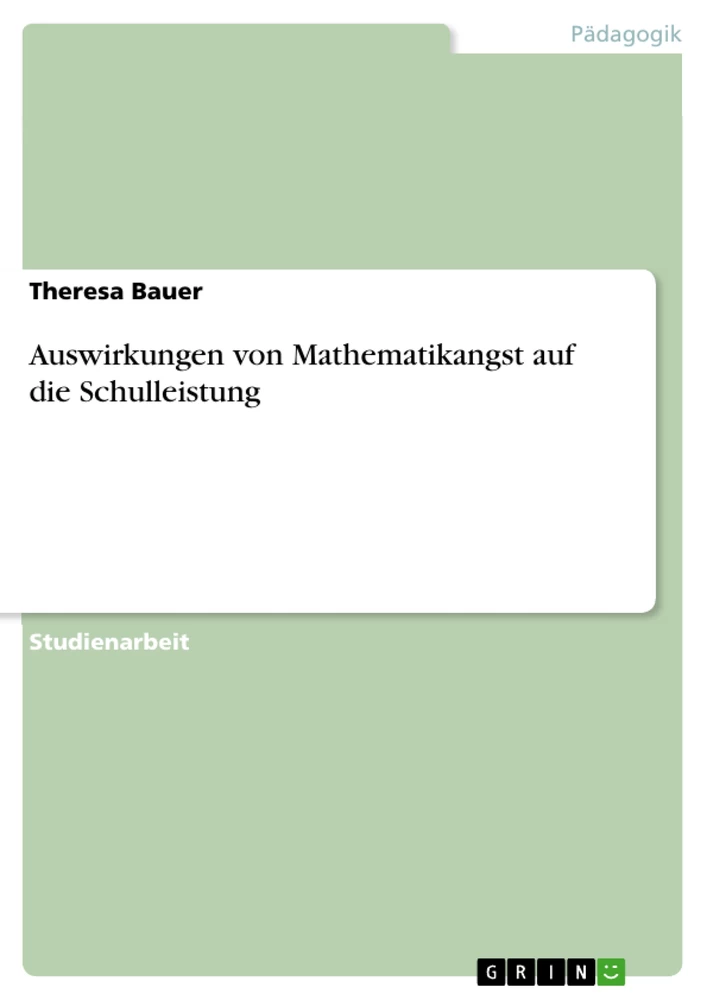Im Rahmen dieser Arbeit wird der Zusammenhang zwischen Mathematikangst und der Schulleistung näher beleuchtet. Ziel dieser Ausarbeitung ist die Ableitung von Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Mathematikangst in Bezug auf die Fallvignette "Tim". Bevor die Fallvignette und das Konstrukt der Mathematikangst näher vorgestellt werden, folgt zunächst eine Diskussion bezüglich subjektiver Theorien im Lehrberuf.
Prüfungen und prüfungsähnliche Situationen begleiten Menschen ihr ganzes Leben lang. Insbesondere in der Schulzeit, in der beruflichen Ausbildung und im Studium entscheiden Prüfungen in hohem Maße über die berufliche Laufbahn eines Individuums. Die hohe Bedeutsamkeit von Prüfungsergebnissen spiegelt den hohen Stressfaktor und die zum Teil gravierende Rolle von Angst in Prüfungssituationen wider. Neben allgemeinen schulbezogenen Ängsten können sich vor allem auch schulfachspezifische Leistungsängste entwickeln, die sich nur auf einen bestimmten schulischen Teilbereich beziehen. Eine Vielzahl der Schüler/innen weist eine Angst in logisch-analytischen Fächern auf - eine sogenannte Mathematikangst - die jedoch nicht nur im schulischen Lern- und Leistungsumfeld, sondern auch in Alltagssituationen auftreten kann.
Grundsätzlich besteht heutzutage ein großer Bedarf an mathematisch gut ausgebildeten Fachkräften, weshalb mathematische Kompetenzen für den schulischen und beruflichen Erfolg von hoher Bedeutung sind. Der Erwerb von Kompetenzen als Ziel des lebenslangen Lernens ist ein wichtiger Bestandteil in der beruflichen Bildung. Deshalb hat der von beruflichen Schulen angestrebte Bildungsauftrag zum Ziel, ein differenziertes Bildungsangebot zu gewährleisten, eine individuelle Förderung der Schüler/innen sicherzustellen sowie den Erfordernissen der Arbeitswelt gerecht zu werden, was wiederum gute diagnostische Kompetenzen der Lehrkräfte voraussetzt. Jedoch weisen Schüler/innen zunehmend Teilleistungsschwächen in Mathematik auf, was sich auch in den Ergebnissen der PISA-Studie zeigt. Es berichten 30 Prozent der 15-jährigen Schüler/innen, dass sie während des Rechnens sehr nervös werden und sich hilflos fühlen. Die Konfrontation mit mathematischen Sachverhalten ist häufig mit negativen Emotionen verbunden und löst bei vielen Menschen Angst aus.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Subjektive Theorien von Lehrkräften
- Fallvignette und Hypothesenbildung
- Theoretischer Hintergrund
- Begriffsabgrenzung „Prüfungsangst“ und „Mathematikangst“
- Diagnostische Methoden
- Handlungsempfehlungen
- Positive Fehlerkultur in mathematischen Unterrichtsfächern
- Individualisierung in mathematischen Unterrichtsfächern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mathematikangst und der Schulleistung. Das Hauptziel dieser Ausarbeitung ist die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Bewältigung von Mathematikangst, basierend auf der Fallvignette "Tim". Der Fokus liegt dabei auf der Hypothese, dass Mathematikangst sich negativ auf die Schulleistung in logisch-analytischen Unterrichtsfächern auswirkt.
- Die Bedeutung von subjektiven Theorien im Lehrberuf
- Der Einfluss von Mathematikangst auf die Schulleistung
- Diagnostische Methoden zur Erkennung von Mathematikangst
- Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte im Umgang mit Mathematikangst
- Die Relevanz von individualisiertem Unterricht für Schüler mit Mathematikangst
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung
Dieser Abschnitt beleuchtet die hohe Bedeutung von Prüfungen in der Bildungslandschaft und die damit einhergehende Problematik von Prüfungsangst, insbesondere im Kontext von schulfachspezifischen Leistungsängsten, wie der Mathematikangst. Die Studie hebt die Relevanz von mathematischen Kompetenzen für schulischen und beruflichen Erfolg hervor und betont den Bedarf an differenzierten Bildungsangeboten, die individuelle Förderung und eine Berücksichtigung der Anforderungen der Arbeitswelt ermöglichen.
Subjektive Theorien von Lehrkräften
Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit den positiven und negativen Aspekten von subjektiven Theorien im Lehrberuf. Subjektive Theorien, die aus Erfahrungswerten resultieren, beeinflussen die Lehrprofessionalität und das Lehrerhandeln im Unterricht. Während sie eine Basis für erfolgreiches Lehrerhandeln darstellen können, ist gleichzeitig die Gefahr von Urteilsfehlern und verzerrten Wahrnehmungen zu beachten. Die Notwendigkeit einer objektiven Fundierung von Urteilen und einer kritischen Reflexion des eigenen Handelns wird betont.
Fallvignette und Hypothesenbildung
Die Fallvignette "Tim" präsentiert den Fall eines Schülers mit Schwierigkeiten im Fach "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle", die möglicherweise auf Mathematikangst zurückzuführen sind. Das Modell von Hesse & Latzko (2017) zur Erklärung von Schulleistung wird vorgestellt, und es wird eine Hypothese formuliert, die den Zusammenhang zwischen Mathematikangst und der Schulleistung untersucht. Die Hypothese lautet: "Mathematikangst wirkt sich negativ auf die Schulleistung in logisch-analytischen Unterrichtsfächern aus."
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser wissenschaftlichen Arbeit sind Mathematikangst, Schulleistung, Lehrprofessionalität, subjektive Theorien, Handlungsempfehlungen, Fallvignette, diagnostische Methoden, individualisierter Unterricht und die Relevanz mathematischer Kompetenzen für den schulischen und beruflichen Erfolg.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Mathematikangst auf die Schulleistung aus?
Mathematikangst wirkt sich laut der zentralen Hypothese negativ auf die Schulleistung in logisch-analytischen Unterrichtsfächern aus, da sie Blockaden und Stress in Prüfungssituationen auslöst.
Was ist der Unterschied zwischen Prüfungsangst und Mathematikangst?
Während Prüfungsangst allgemein in Leistungssituationen auftritt, ist Mathematikangst eine fachspezifische Leistungsangst, die sich gezielt auf mathematische Inhalte bezieht, aber auch im Alltag vorkommen kann.
Wie viele Schüler sind von negativen Emotionen beim Rechnen betroffen?
Laut PISA-Studien berichten etwa 30 Prozent der 15-jährigen Schüler, dass sie sich während des Rechnens hilflos fühlen oder nervös werden.
Welche Rolle spielen subjektive Theorien von Lehrkräften?
Subjektive Theorien basieren auf Erfahrungswerten und beeinflussen das Lehrerhandeln. Sie bergen jedoch die Gefahr von Urteilsfehlern und verzerrten Wahrnehmungen bei der Beurteilung von Schülern.
Welche Handlungsempfehlungen gibt es für den Unterricht?
Die Arbeit empfiehlt die Etablierung einer positiven Fehlerkultur sowie eine stärkere Individualisierung im Mathematikunterricht, um Ängste abzubauen.
Warum sind mathematische Kompetenzen heute so wichtig?
Es besteht ein hoher Bedarf an mathematisch ausgebildeten Fachkräften; diese Kompetenzen sind entscheidend für den beruflichen Erfolg und lebenslanges Lernen.
- Quote paper
- Theresa Bauer (Author), 2019, Auswirkungen von Mathematikangst auf die Schulleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508530