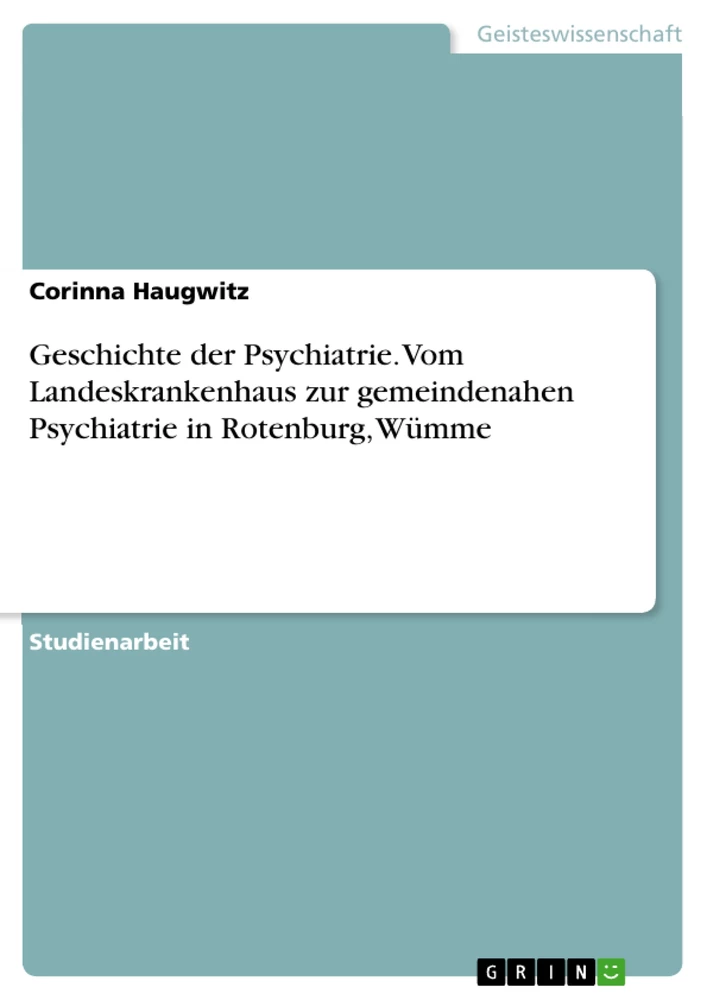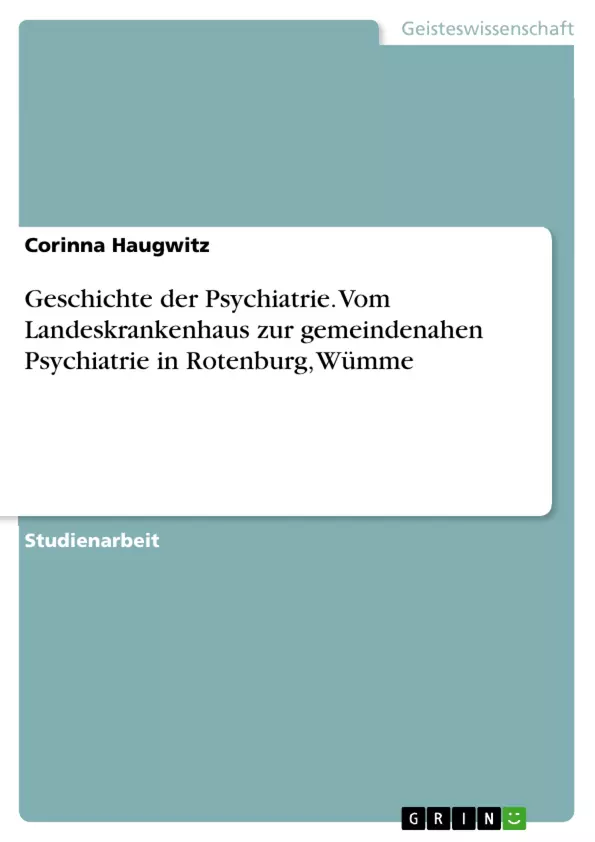Die Arbeit versucht aufzuzeigen, wie sich die psychiatrische Versorgung in Rotenburg (Wümme) vom Landeskrankenhaus Lüneburg zur gemeindenahen Psychiatrie vor Ort entwickelt hat. Des Weiteren wird untersucht, welchen Einfluss der Bericht der Enquete-Kommission von 1975 auf die Soziale Arbeit in der psychiatrischen Arbeit hatte.
Mit der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Psychiatrie-Enquete wurde der Grundstein für eine bis heute weitreichende Veränderung im Bereich der Psychiatrie in Deutschland gelegt. Selbst wenn die zusammengetragenen Daten der Enquete-Kommission als nicht vollständig bewertet werden, wirft das Ergebnis ein erschreckendes Bild auf die Psychiatrie in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Ungeschönt wurden unhaltbare Zustände im Bereich der Psychiatrie offengelegt. Zum Teil unmenschliche Zustände herrschten in den Nerven-Heil-Anstalten und anderen Einrichtungen, in denen psychisch- und geisteskranke Menschen stationär behandelt wurden. Aber auch die ambulante Versorgung durch Nervenärzte war schlecht. Eine gemeindenahe Versorgung war in weite Ferne gerückt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Psychiatrie-Enquete von 1975
- Das 19. Jahrhundert bis zur Enquete
- Die Enquete
- Das Landeskrankenhaus Lüneburg und die psychiatrische Versorgung
- Gemeindenahe Psychiatrie
- Die gemeindenahe Versorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Fazit
- Literaturliste/Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung in Rotenburg (Wümme) vom Landeskrankenhaus Lüneburg zur gemeindenahen Psychiatrie aufzuzeigen. Dabei wird insbesondere untersucht, welchen Einfluss der Bericht der Psychiatrie-Enquete von 1975 auf die soziale Arbeit in der psychiatrischen Versorgung hatte.
- Die Geschichte der Psychiatrie in Deutschland und die Entwicklung der gemeindenahen Versorgung
- Die Ergebnisse der Psychiatrie-Enquete von 1975 und deren Auswirkungen auf die psychiatrische Versorgung
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der psychiatrischen Versorgung
- Die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung in Rotenburg (Wümme)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den persönlichen Hintergrund der Verfasserin. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Psychiatrie-Enquete von 1975. Zunächst wird ein Überblick über die Entwicklung der Psychiatrie vom 19. Jahrhundert bis zur Enquete gegeben, wobei auch auf den Einfluss des Nationalsozialismus auf die psychiatrische Versorgung hingewiesen wird. Anschließend werden die Ergebnisse der Enquete vorgestellt, insbesondere die desolate Personalsituation in den psychiatrischen Fachkrankenhäusern.
Schlüsselwörter
Psychiatrie-Enquete, gemeindenahe Psychiatrie, Landeskrankenhaus, soziale Arbeit, psychiatrische Versorgung, Rotenburg (Wümme), Geschichte der Psychiatrie, Sozialpsychiatrie.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Psychiatrie-Enquete von 1975?
Es war eine von der Bundesregierung beauftragte Untersuchung, die unhaltbare und teils unmenschliche Zustände in deutschen psychiatrischen Einrichtungen offenlegte.
Was versteht man unter "gemeindenaher Psychiatrie"?
Ein Konzept, bei dem psychisch Kranke nicht in fernen Großkrankenhäusern isoliert, sondern vor Ort in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden.
Wie entwickelte sich die Versorgung in Rotenburg (Wümme)?
Die Arbeit zeigt den Wandel von der Unterbringung im Landeskrankenhaus Lüneburg hin zu dezentralen, wohnortnahen Angeboten im Landkreis Rotenburg auf.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Psychiatrie?
Soziale Arbeit ist zentral für die Wiedereingliederung, die Alltagsbewältigung und die psychosoziale Unterstützung der Betroffenen außerhalb von Kliniken.
Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf die Psychiatrie?
Die Arbeit beleuchtet historisch, wie die Zeit des Nationalsozialismus das Bild und die Behandlung psychisch Kranker in Deutschland nachhaltig belastet hat.
- Citar trabajo
- Corinna Haugwitz (Autor), 2013, Geschichte der Psychiatrie. Vom Landeskrankenhaus zur gemeindenahen Psychiatrie in Rotenburg, Wümme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508558