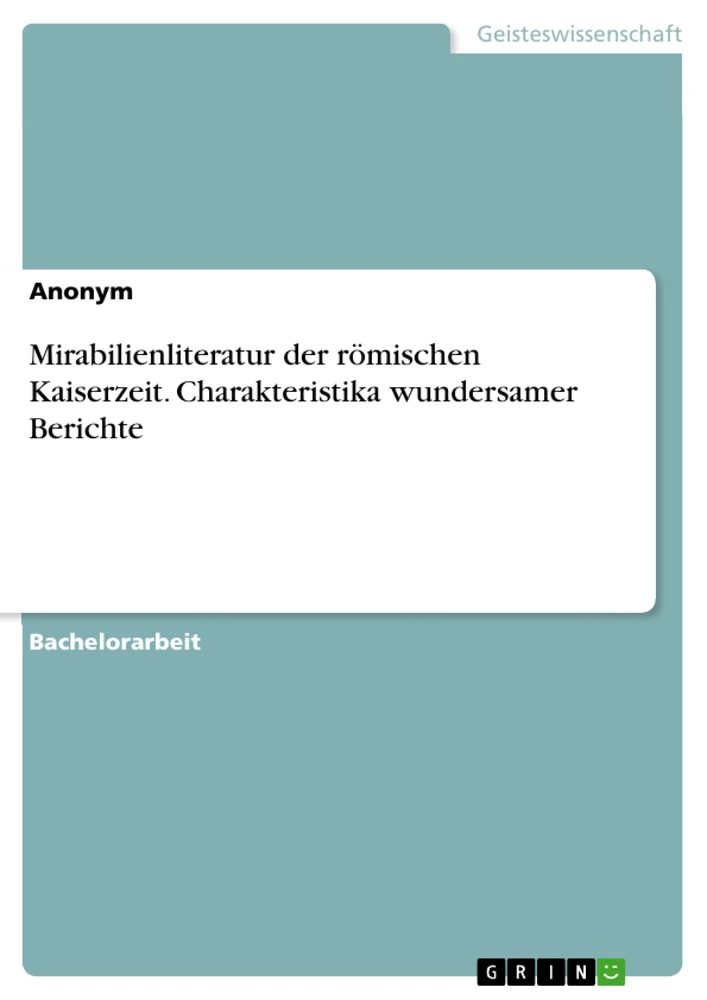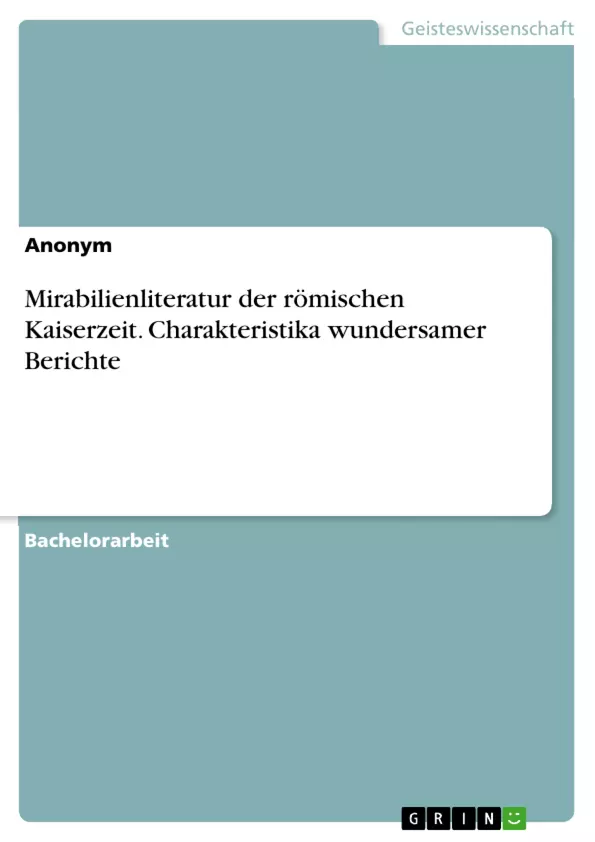Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer in der Forschung eher spärlich behandelten Form der Geschichtenerzählung: der Mirabilienliteratur. Speziell steht dabei mit Texten von Plinius dem Jüngeren und Aulus Gellius die Mirabilienliteratur der römischen Kaiserzeit im Vordergrund. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Thema eher selten behandelt wurde, gibt es auch keinen umfassenden Überblick über die Mirabilienliteratur. Vereinzelt finden sich kleine Anspielungen auf Mirakulöses in der lateinischen Literatur. Dass diese mirabilia aber gesammelt und ihr Grundcharakter bzgl. Komposition und Inhalt herausgearbeitet werden, wurde bislang in der Forschung noch nicht behandelt. Dazu wird einerseits untersucht, ob es bestimmte Themen gibt, auf die sich diese Art der Literatur beschränkt oder ob ihr Spektrum der Themen so weit gefasst ist wie bei anderen Gattungen. Diese Untersuchung beinhaltet auch eine Analyse der Art des Erzählens und der Beschreibung des Geschehens. Diese Arbeit gibt einen Überblick, welche Form, welcher Aufbau und welche Thematik charakteristisch für die mirabilia sind und welche Intention der Verfasser mit der Darstellung dieser Geschichte jeweils verfolgte.
Abgeleitet ist das Wort mirabile von den Adjektiven mirabilis und mirus, die wunderbar, erstaunlich, sonderbar bedeutet. Davon leitet sich auch das in den hier betrachteten Texten häufig vorkommende miraculum ab, was mit Wunder oder Wunderding übersetzt werden kann. Dabei besteht aber trotzdem ein Wahrheitsanspruch der Erzählung, denn sie beschreibt lediglich das, was außerhalb der Erwartung geschieht. Wenn man nun aufgrund dieser Abhängigkeit das mirabile als etwas definiert, was wunderbar ist oder was etwas Wunderbares beschreibt, muss man sich die Frage stellen, in welchen Punkten es sich von der Fabel, der Buntschriftstellerei, der Mythographie oder der Paradoxographie unterscheidet und worin Überschneidungspunkte liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist ein mirabile?
- 3 Konkrete Geschichten
- 3.1 Naturschauspiele
- 3.1.1 Das intermittierende Gewässer (Plin. epist. 4,30)
- 3.1.2 Schwimmende Inseln (Plin. epist. 8,20; Sen. nat. 3,15,8)
- 3.1.3 Zusammenfassung
- 3.2 Wundersame Beziehungen zwischen Menschen und Tieren
- 3.2.1 Die Freundschaft eines Delphins (Plin. epist. 9,33)
- 3.2.2 Freundschaft in einer aussichtslosen Situation (Gell. 5,14)
- 3.2.3 Zusammenfassung
- 3.3 Geschichten über merkwürdige Menschen
- 3.3.1 Der Aufbau von Gell. 9,4
- 3.3.2 Die Kuvoкèqaλoι und der weibliche Mann (Gell. 9,4,9.14-15)
- 3.3.3 Zusammenfassung
- 3.1 Naturschauspiele
- 4 Gemeinsame Merkmale der Erzählungen
- 5 Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Mirabilienliteratur der römischen Kaiserzeit, insbesondere mit Texten von Plinius dem Jüngeren und Aulus Gellius. Das Ziel ist es, diese Gattung, die in der Forschung nur spärlich behandelt wurde, genauer zu untersuchen und ihre Charakteristika hinsichtlich Komposition, Inhalt und Themenbereich zu erforschen.
- Erarbeitung einer Definition des Begriffs „mirabilia“ und Abgrenzung zu anderen Gattungen.
- Analyse von konkreten mirabilia, um Themenbereiche, Erzählstrukturen und stilistische Merkmale zu identifizieren.
- Untersuchung des Naturverständnisses in der römischen Kaiserzeit im Kontext der mirabilia.
- Bedeutung der Sensationsgier des Publikums für die Verbreitung von Mirabilienliteratur.
- Identifizierung gemeinsamer Merkmale von Mirabilienliteratur, die eine allgemeine Definition und Charakterisierung der Gattung ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Definition des Begriffs „mirabilia“ und stellt verschiedene ähnliche Gattungen wie Fabel, Paradoxographie, Mythographie und Buntschriftstellerei vor. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 analysieren konkrete Geschichten über Naturschauspiele, wundersame Beziehungen zwischen Menschen und Tieren sowie merkwürdige Menschen. Dabei wird auf das Naturverständnis der römischen Kaiserzeit, die Sensationsgier des Publikums und die sprachlichen und stilistischen Merkmale der Texte eingegangen. Schließlich werden im vierten Kapitel die gemeinsamen Merkmale der Erzählungen zusammengefasst, um eine allgemeine Definition von Mirabilienliteratur zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Mirabilienliteratur, römische Kaiserzeit, Plinius der Jüngere, Aulus Gellius, Naturverständnis, Sensationsgier, Fabel, Paradoxographie, Mythographie, Buntschriftstellerei.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Mirabilienliteratur?
Mirabilienliteratur befasst sich mit wundersamen, erstaunlichen oder sonderbaren Berichten (mirabilia), die trotz ihres außergewöhnlichen Inhalts oft einen Wahrheitsanspruch erheben.
Welche römischen Autoren werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Texte von Plinius dem Jüngeren und Aulus Gellius aus der römischen Kaiserzeit.
Welche Themen sind charakteristisch für mirabilia?
Typische Themen sind Naturschauspiele (z.B. schwimmende Inseln), ungewöhnliche Beziehungen zwischen Mensch und Tier (z.B. Delphinfreundschaften) und Berichte über merkwürdige Menschen.
Wie unterscheidet sich die Mirabilie von der Fabel?
Während die Fabel oft fiktiv und belehrend ist, beschreibt die Mirabilie Ereignisse, die außerhalb der Erwartung liegen, aber als real geschehen dargestellt werden.
Welche Rolle spielt die Sensationsgier des Publikums?
Die Arbeit analysiert, wie die Intention der Verfasser und das Interesse des Publikums an Kuriositäten die Komposition und Verbreitung dieser wundersamen Geschichten beeinflussten.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Mirabilienliteratur der römischen Kaiserzeit. Charakteristika wundersamer Berichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508595